Eislingen ist Avantgarde: Hier ist die Kunst so politisch, so unerschrocken, so umstritten wie sonst nur auf der Documenta. Woran es liegt? Ausgerechnet an den Verkehrskreiseln.
Aus der ZEIT Nr. 36/2025 Aktualisiert am 25. August 2025, 14:51 Uhr

Am allerschönsten wäre es, man würde Eislingen, ganz Eislingen, nach Kassel verlegen: um das kleine Städtchen auf der nächsten Documenta auszustellen, als größtes Exponat aller Zeiten und denkbar bestes Beispiel dafür, wie man eine andere, höchst ungewohnte Kunst in die Welt setzt. Eine Kunst, die im klassischen Museum nichts zu suchen hat. Schon aus Platzgründen nicht, denn wie sollte Eislingen, diese soziale Skulptur, in irgendeine Vitrine passen?
Soziale Skulptur – der Begriff stammt von Joseph Beuys, mit dem man in Eislingen nur wenig zu schaffen hat. Und wollte man die 22.000 Menschen, die hier leben, tatsächlich als Kunstwerke ihrer selbst präsentieren, ob in Kassel oder irgendwo anders, sie würden sich höflich bedanken und schwäbisch gelassen ihrer Wege ziehen. Eislingen, unweit von Stuttgart gelegen, will nicht Avantgarde sein. Und sucht doch das ästhetische Wagnis, sehr politisch, sehr sozial, unerschrockener als viele Biennalen – und das alles ausgerechnet auf den Verkehrskreiseln der Stadt.
Bis nach Indien hat sich das schon herumgesprochen, was Anja Luithle noch immer verblüfft. Gerade schaut sie noch einmal auf das Buch, das auf Hindi verfasst wurde und ihr Kunstwerk auf dem Umschlag zeigt, ein tanzendes, schwebendes, rotes Kleid. In Eislingen kennen es alle, gleich am Ortseingang steht es weithin sichtbar auf einem Kreisel oder genauer: dreht dort seine Runden. Gelegentlich muss Luithle, die Künstlerin, vorbeischauen, weil der kleine Motor mal wieder ausgefallen ist, den aber braucht es, damit die Skulptur sich um die eigene Achse dreht. "Es gibt da so eine Art Garantie", sagt sie. Eine Garantie auf Kunst.
Seit 2009 steht die Wegweiserin schon auf ihrer Insel, immerzu umrundet, umbraust von den Autos, die hineindrängen nach Eislingen und hinaus. Einmal musste die Skulptur frisch gestrichen werden, und jetzt platzt die Farbe schon wieder ab. "Rot ist die am wenigsten lichtechte Farbe", sagt Luithle, "sie verblasst." Rot aber sollte es sein, unbedingt, denn die Kunst will ja gesehen werden. Erst recht hier, wo sie fürs Vorbeirauschen gemacht ist, für Beifahrer, für Fußgänger, für alle, die auf dem Weg sind. Manche allerdings, erzählt Luithle, sind gleich so begeistert, dass sie die Skulptur immer wieder umkreisen, rum, rum und rum, ohne je anzuhalten oder abzubiegen.
Die rote Frau, so wird sie in Eislingen genannt, und da muss Luithle schon ein wenig lachen. "Keine Hände, keine Beine, kein Kopf, was soll das für eine Frau sein? Nur ein Kleid, mehr ist da nicht, das habe ich den Leuten auch erklärt: nur ein Kleid. Und das hat sie dann doch interessiert." Denn wie geht so etwas, dass dort, an ihrer Ortseinfahrt, eine Frau sich dreht, die keine Frau ist. Und dass diese Wegweiserin immer andere Wege weist, als wüsste sie selbst nicht, wohin es eigentlich gehen soll. Oder als wollte sie alle, die vorbeifahren, kurz ein wenig verwirren. Damit sie ebenfalls ins Rotieren geraten und sich am Ende, wer weiß, auf eine Route begeben, die nicht ihre Route ist, kopflos wie die Keine-Frau-Frau und ohne ein rechtes Ziel zu kennen. "Die Leute mögen das", sagt Luithle. "Mich wundert’s auch manchmal."
Vielleicht liege es daran, dass sie die Skulpturen selbst baut in ihrer Werkstatt. Vielleicht aber auch an der Philosophie, die in der Kunst steckt, in der ewigen Wohin-geht’s-im-Leben-Frage, die einem hier so beschwingt, so wunderbar spielerisch entgegenkommt. Einmal war sogar Rita Süssmuth da, die CDU-Politikerin, und hat sich mit lauter Frauen in roten Kleidern fotografieren lassen. Und überhaupt ist die Wegweiserin immer beliebter geworden, es gibt sie in Form kleiner Süßigkeiten mit rotem Guss und ebenso als begehrtes Multiple, also als Miniatur, damit man das Spiel mit der Einbildung und dem Richtungswechsel auch daheim, am eigenen Schreibtisch, noch spielen kann. Luithles Kunst führt ein Inseldasein, einsam am Wegesrand. Und ist zugleich bei den Eislingern eingezogen.
Eigentlich eine ganz unwahrscheinliche Geschichte, denn als es so richtig losging mit den Verkehrskreiseln und der Kunst, vor gerade mal einem Vierteljahrhundert, galt das eine wie das andere als programmiertes Debakel. Und als schlimmer Traditionsbruch.
Denn wie sollte das Leben verlaufen? Natürlich in klaren Bahnen, das war ausgemacht. Hier in Eislingen wie im restlichen Deutschland glaubte man fest an den linearen Fortschritt, und der Straßenbau hatte dem eigenen Geradeausdenken zu gehorchen. Sich selbst im Kreis zu drehen, kam nicht infrage.

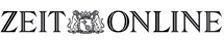 vor 6 Stunden
1
vor 6 Stunden
1

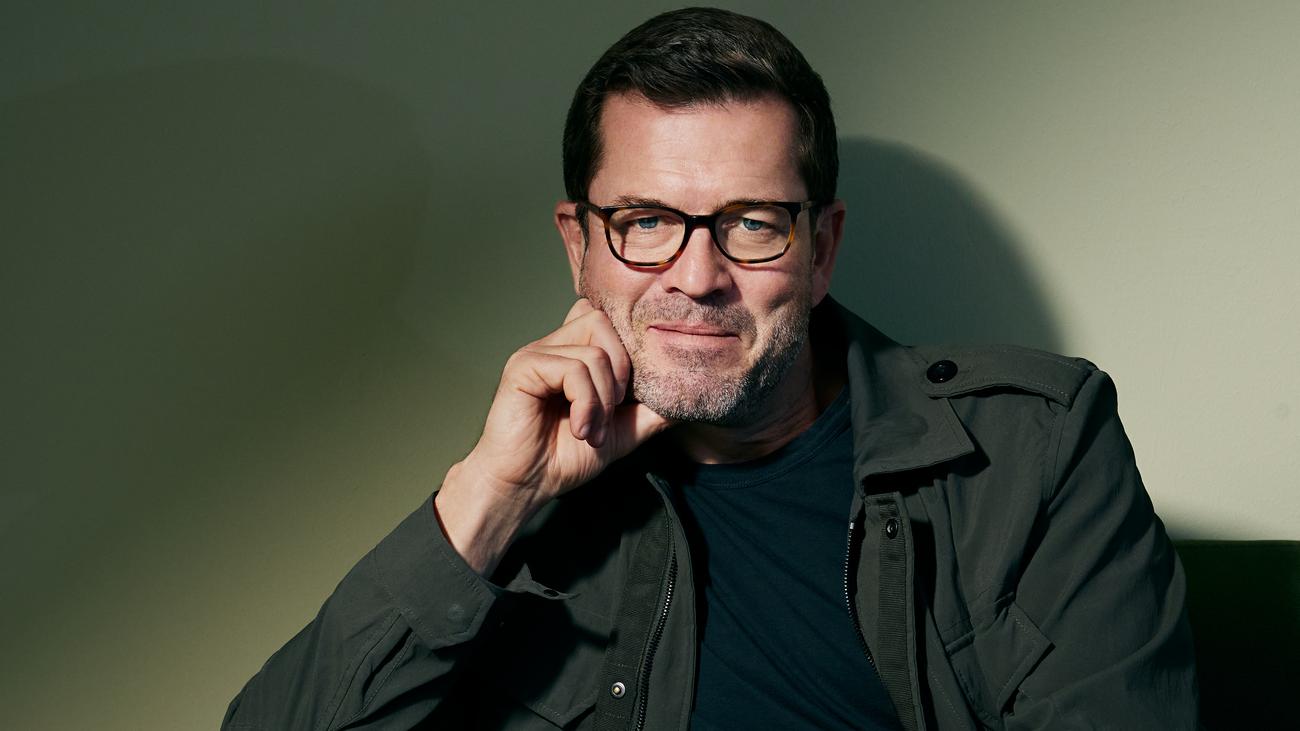









 English (US) ·
English (US) ·