Dmitri Schostakowitsch siedelte die Ehebruchs- und Mordgeschichte seiner „Lady Macbeth von Mzensk“, der literarischen Vorlage Nikolai Leskows folgend, in der russischen Provinz an. Doch anders, als es das gängige Gedankenkino will, verlegt Regisseur Barrie Kosky diese Handlung nun in seinem immer wieder gern aufgesuchten Ex-Heimathaus nicht in die Zeit langer Nächte und krachender Fröste, sondern in einen glühenden Hochsommer mit schwitzigem Krawatten- oder Uniformzwang für Honoratioren und Amtsträger sowie leichten Negligés für die Nachtstunden.
So ist Kosky nun mal – baut Pointen selbst dort, wo er selbst gar nichts davon ahnen konnte. Denn für die Premierenbesucher, die nun tatsächlich bei eisigen Minustemperaturen und schneidenden Ostwinden im Interimshaus an der Bismarckstraße zusammenströmten und seit Wochen kaum mehr wussten, wie die Sonne aussieht, war dieser krasse atmosphärische Wechsel schon ein erster, fast hämischer Verfremdungseffekt. Ambur Braid aber, Gestalterin der Titelheldin Katerina Ismailowa, gab er Gelegenheit, gleich in der Einstiegsszene dieser schwer gelangweilten und sexuell frustrierten Kaufmannsfrau zusätzlich zur gut tragenden Stimme auch noch viel Bein und Körperbeherrschung zu zeigen: alles fein ausgereizt und Auftakt einer eindringlichen Leistung.
Ironie, Sentimentalität und brutaler Jähzorn
Wie da eine schwer lastende Lebenssehnsucht explosiv am völlig falschen Objekt ausbricht und im Wortsinne tödlich wird; wie die Nuancen von Begehren, Hass, wühlender Angst und abgrundtiefer Enttäuschung je nach Situation und Gegenüber wechseln; wie ihre immer expressive Stimme nach Tönen kahler, gleichsam herausgewürgter Verachtung, lodernder Sinnlichkeit und hoffnungslosen Leides schließlich gegen Stückende als geborstener und ausgeleerter Schatten gleichsam einfriert: Das wurde abendprägend. Auf der männlichen Seite des Ensembles konnte da, bis zu seinem kotzenden Rattengifttod, allein Dmitry Ulyanovs Boris dagegenhalten, und das nicht nur dank seiner Vokalgestaltung mit vielen Nuancen zwischen Ironie, Sentimentalität und brutalem Jähzorn, sondern vor allem, weil sich damit ein wirklicher, bei aller Antipathie kraftvoller Charakter formte: ein ins zynisch Nihilistische gekippter Falstaff, ebenso genuss- wie klarsichtig und von den Verhältnissen womöglich ähnlich angeödet wie seine Schwiegertochter.
Weil indessen deren beide Männer – Elmar Gilbertsson als Sinowi zwischen Schwächlichkeit und Ausbrüchen kaum mehr als ein Schattenbild sowie Sean Panikkars Sergej, sportlich-drahtig als Erscheinung, hinterhältig als Charakter und mit falsch gefühliger Tenorkälte auch vokal entsprechend eingestellt, kurzum: ein ziemliches Ekel – ähnlicher Differenzierungen höchstens andeutungsweise fähig waren, entwickelten sich eher James Gaffigan (gerade mit Chefvertragsverlängerung bis 2030) und das Hausorchester zum dritten tragenden Pfeiler des Abends.
Den Wodka trinkt die Hausdame aus dem Glas
Sie zeigten viel Sinn für die Brüche zwischen trocken-sarkastischen, vor allem im Holz oft tückisch schillernden Szenenbegleitungen – die Klänge beim Verstecken der Leiche Sinowis haben fast kriminalkomödiantische Züge – und emphatisch mitschwingenden Kantilenen rings um die Titelheldin, unterstrichen zudem durch Diskretion und klare Differenzierung immer wieder die kammermusikalischen Qualitäten der Partitur. Gute Arbeit. Etliche der kleineren Rollen setzten vor allem szenisch Akzente: voran Caspar Krieger mit der Durchdringung eines in seiner Dauerdemütigung versoffenen, kindhaft-verpetzten und ins Bösartige ausbrechenden Außenseiters, daneben Dimitry Ivashchenkos immer nahe am Delirium balancierender Pope, Susan Zarrabis herzlos zynische Sonjetka oder Mirka Wagners gedemütigte Aksinja.
Was Barrie Koskys Regie ihnen allen in Rufus Didwiszus’ antiatmosphärisch gehaltenem Bühnenbild und Victoria Behrs spielfreundlichen, die Handlung ins vordigitale 20. Jahrhundert versetzenden Kostümen an Spielangeboten mitgab, schloss feine Detailbeobachtungen ein (wenn Katerina sich für die Liebesnacht mit Sergej vorwärmt, trinkt sie, ganz bürgerliche Hausdame, den Wodka aus dem Glas, während dieser umweglos zur Flasche greift), ging die Sex-, Prügel- und Mordszenen eher deftig-plakativ an, enttäuschte aber vor allem in der Führung der stereotyp zwangskollektivierten, betriebsam leerlaufenden Massenszenen. Weil davon im letzten Teil des Werkes gleich drei aufeinanderfolgen – Polizeirevier, Hochzeitsfeier, Sträflingsmarsch nach Sibirien – wurde der Abend am Ende ziemlich lang und öde; da hat man, nicht zuletzt bei Kosky selbst, schon haufenweise bessere Choreographien gesehen als etwa die infantil kopfwackelnde und revolverfuchtelnde Ordnungshüter-Dödeltruppe.
Musikalisch indessen war der Chor (Einstudierung David Cavelius) rundum auf der Höhe des Geschehens. Keine gute Idee war es schließlich, die Leere der letzten Dreiviertelstunde, als sei da pflichtschuldig noch einiges nachzuholen, durch drastische Schockbilder „anzureichern“. Erst muss ein Frosch zertreten und ein unschuldig neugieriger Naturforscher über den Haufen geschossen werden, dann entleibt sich Katerina nicht im stillen Waldsee, sondern ebenfalls mithilfe eines Schießeisens; das findet zwar in der Musik keinerlei Echo, knallt aber viel schöner. Die Jahreszeiten übrigens haben inzwischen offenkundig gewechselt. Keine Hitze mehr: fungieren doch als Symbolstücke für den endgültigen Verlust des Geliebten ein Paar körperwechselnde wollene Langstrümpfe. Womit also alle zusammen, milieu- und gefühlsgerecht, doch wieder im Winter angekommen sind. Passt vielleicht auch besser.

 vor 19 Stunden
2
vor 19 Stunden
2

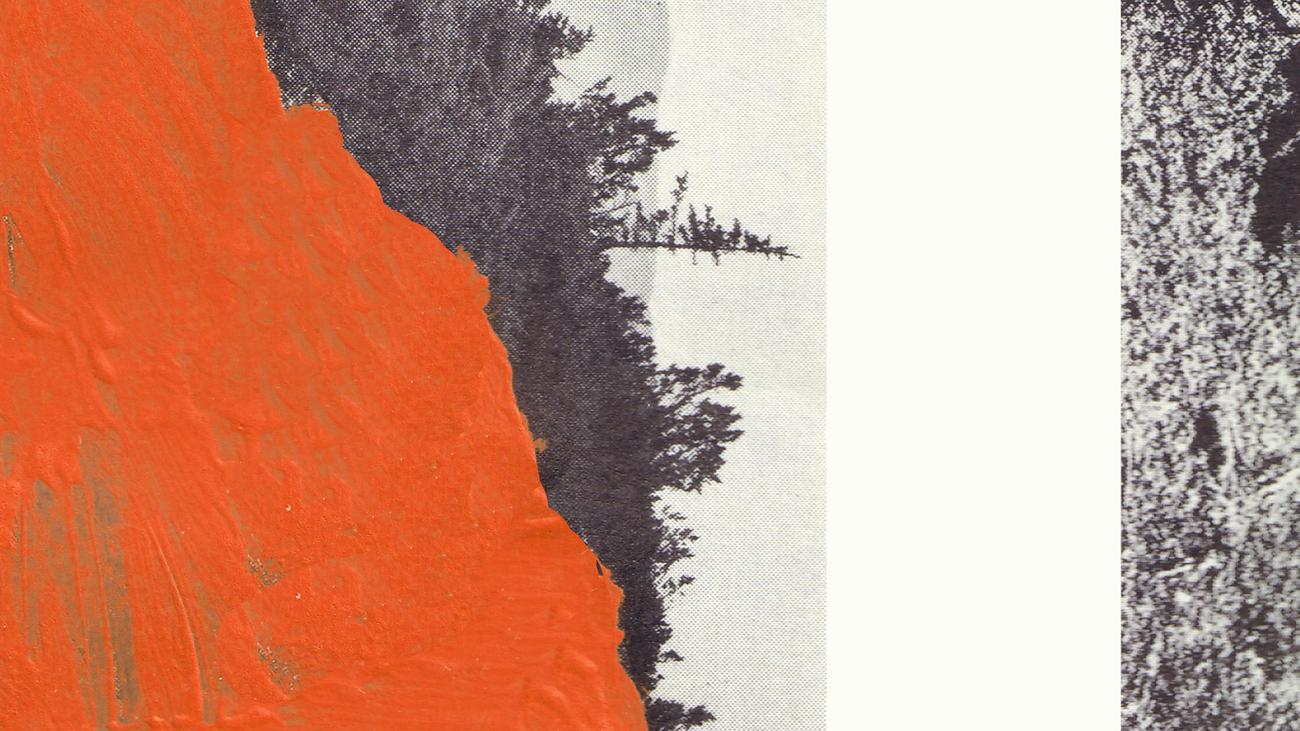









 English (US) ·
English (US) ·