Immerhin zweimal, in seiner Romanze über die „Gloire“ im ersten Akt und, als seine Sache, kurz vor dem dann doch triumphalen Ende, schon verloren scheint, gönnte Hector Berlioz seinem ersten Opernhelden Momente der Introspektion, der Besinnung, sogar des Zweifels. Ansonsten regiert in „Benvenuto Cellini“ römischer Karnevalstrubel. Darin schert sich der begnadete Renaissance-Bildhauer und Goldschmied, vom Papst persönlich beauftragt, ein Hauptwerk zu schaffen, vor allem um seine Liebe zur schönen Teresa, nicht um Abgabetermine. Cellini, ein Raufbold und Mann der genialen Tat, muss dauernd den minderbegabten Kollegen Fieramosca ausstechen, was für einen wie ihn eine Kleinigkeit ist und vor allem Anlass für allerhand Standardsituationen der Bühnenkomik und schöne Liebesduette.
Aber dann, als eine Entführungsintrige aus dem Ruder läuft, tötet Cellini den Fieramosca-Kumpel Pompeo, und es liegt ein toter Mann auf der Komödienbühne. So kann es gehen in einer „Opera semiseria“: Plötzlich ist es nicht mehr so lustig. Und hinter all dem Jubeltrubel scheint das Künstlerdrama durch, das nicht zuletzt wohl Berlioz’ eigenes war; die Feier eines erotischen und schöpferischen Siegertypen, der den Papst nicht fürchtet und nicht die Gewerkschaft (kurz vor dem alles entscheidenden Guss der später weltberühmten Perseus-Bronze wollen die Arbeiter streiken).

In Brüssel inszeniert der amerikanisch-italienische Regisseur Thaddeus Strassberger Berlioz’ Theater der Maßlosigkeit als schwer augenzwinkernden Versuch der Überbietung, ein Horror Vacui füllt die Bühne des Théâtre Royal de la Monnaie mit einer drehbaren Fake-Marmor-Showtreppe, auf der immer was los ist. Noch die Säulenfiguren und die Allegorien des Deckengemäldes im Zuschauerraum werden lebendig und kommentieren tanzend das Geschehen, es wird jongliert und akrobatisiert, und wenn sonst nichts ist, fliegen Pizzen durch die Luft.
Das Theater im Theater von Cassandros Truppe, ein Sängerduell, in dem lustigerweise nicht gesungen wird, ist hier eine muntere Travestieshow. Eine römische Revue, zusammengepuzzelt aus Antike, Klassizismus, Renaissance bis zum Fascismo italiano, Papstkitsch, Hippietum und knalliger Gegenwart. Teresa, die Tochter des päpstlichen Schatzmeisters Balducci, schaut unentwegt Soap-Operas im Fernsehen, der Papa lieber Urbi-et-orbi-TV.

Es gibt also, überausgeleuchtet, immer was zu sehen, das hebt die zwei Momente der Besinnung des Cellini umso deutlicher aus den – zweifelsfrei virtuos realisierten – Tableaus des Klamauks heraus. Der amerikanische Tenor John Osborn ist der Cellini der Stunde, der die in dieser Partie geforderte staunenswerte Höhen- und Intonationssicherheit mitbringt, gerade in den zwei Arien doch angedeuteten Rückseite des Superheldentums aber ein paar Nuancen schuldig bleibt. So wie Ruth Iniesta der Teresa etwas Jugendfrische. Jean-Sébastien Bou sucht in der Partie des in der Liebe wie in der Kunst ewig unterlegenen Fieramosca nach Zwischentönen, zeigt aber, ähnlich Tijl Faveyts’ Vater Balducci, nur die Karikatur eines Spießertums, das dem Genie das Wasser nicht reichen kann. Makellos Florence Losseau als Cellinis treuer Assistent Ascanio, markant Gabriele Nanis Pompeo. Ante Jerkunica gibt dem Papst Clemens VII. die nötige Bass-Gravitas; dessen Großmut reicht ja am Ende so weit, dem Mörder Cellini zu vergeben: Er hat ja sein Werk vollendet, und als das Metall auszugehen droht, sein (fast) komplettes Frühwerk in einem kühnen Akt miteingeschmolzen. Gott sei Dank wird in Brüssel im letzten Moment die „Saliera“ gerettet, das berühmte Salzfass, und als Benvenuto und Teresa im weißen Hochzeitsstaat gefeiert werden, trägt Cellini es in der Tüte bei sich, glücklich lächelnd, alles gut.
Die Komödie ist damit beendet, doch die weiter gehenden Fragen, die sich, schon bei Berlioz, an das Künstlertum der befreienden Tat knüpfen, bleiben in Strassbergers so sehr glänzen wollender Cellini-Show unterbelichtet, übrigens auf Kosten der Unterhaltsamkeit. Dabei wäre eine Befragung des Genie-Konzepts der erlösenden Tat aus heutiger Sicht durchaus vielversprechend. Es bleibt aber beim Bling-Bling.
Der Brüsseler Musikdirektor Alain Altinoglu, zugleich Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt am Main, wirft das Orchestre Symphonique mit gutem Schwung in Berlioz’ über alle Maßen ehrgeizige Partitur; wie er dann im Vorspiel für das Pizzicato der Bässe das Tempo sofort bremst, gibt schon eine Ahnung für die kommende, extreme Kontrastdramaturgie der Musik. Altinoglu bleibt Herr des Geschehens noch in den intrikatesten Ensembles, zumal die Holzbläser brillieren mit flinker Eloquenz; der Chor darf glänzen, ebenso Berlioz’ Instrumentations-Raffinement. Gelegentlich gerät es dann, in den Finali, doch zu laut, doch insgesamt trifft Altinoglu den Ton dieses zwischen Opéra comique und Grand Opéra so eigenartig zwitternden Werks. Gespielt wird die 1838 zur Uraufführung gelangte Fassung „Paris 2“, mit komponierten Rezitativen.
Es ist die erste von der neuen Brüsseler Chefin Christina Scheppelmann selbst geplante Neuproduktion; sie startete die Saison mit einem noch von ihrem Vorgänger Peter de Caluwe programmierten „Falstaff“. Die Wahl des nicht populären, aufwendigen und musikalisch so heiklen Stücks ist ohne Zweifel mutig, der Ertrag von Strassbergers Deutung überschaubar. Was erzählt uns die Geschichte dieses Cellini heute, womöglich ja auch über das Potential von Kunst, zumal Oper, im 21. Jahrhundert? – Die Intendantin berichtet, wie sie einmal inkognito Passanten auf der Place de la Monnaie gefragt habe, ob sie wüssten, was das wohl für ein Gebäude sei und was hinter dem Säulenportal stattfinde. Es hätten nicht wenige getippt, es müsse sich um eine Bankfiliale handeln; das wolle sie ändern. Dafür braucht es kluge Kommunikation; auch den Mut, die richtigen Fragen zu stellen.

 vor 8 Stunden
1
vor 8 Stunden
1

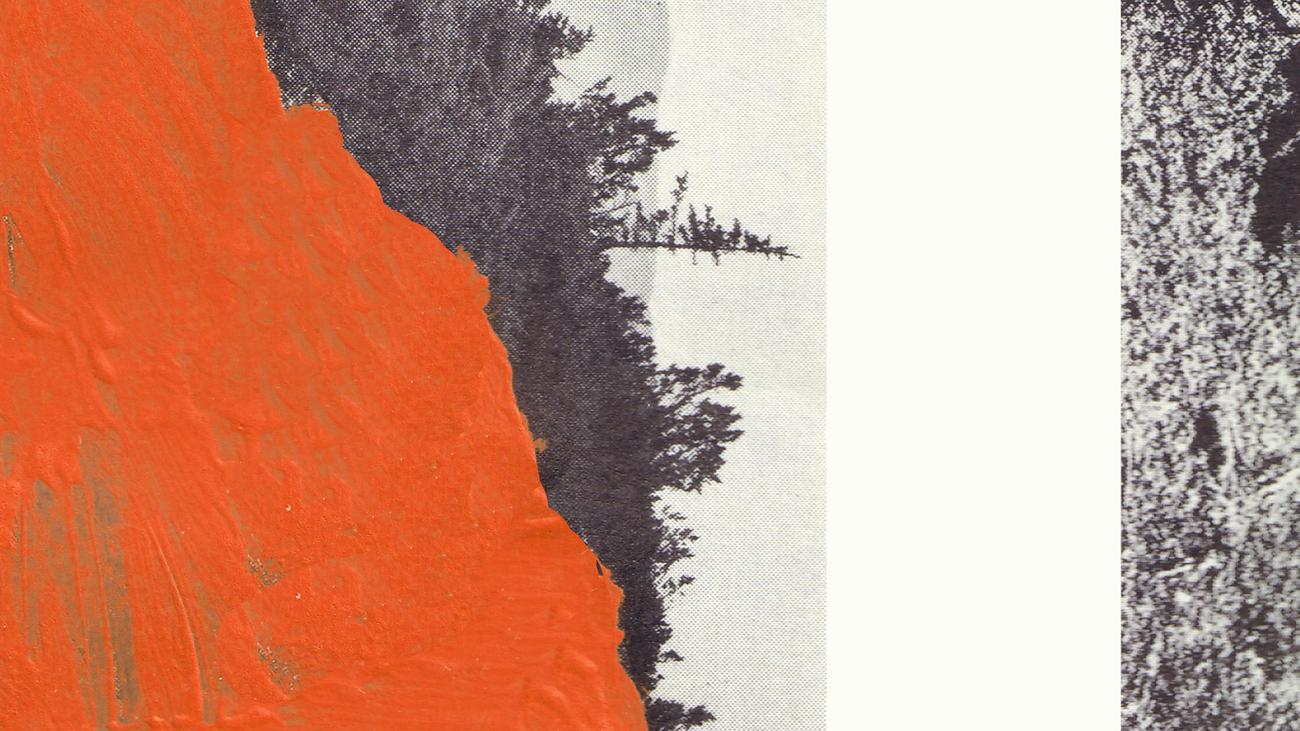









 English (US) ·
English (US) ·