Ein Gigant der Weltliteratur wurde hierzulande immer ignoriert. Endlich erscheint der Roman "Die Puppe" von Bolesław Prus in neuer Übersetzung.

Auch die Liebe unterliegt der Mode. Heutzutage besonders populär: die toxische Beziehung. Im Grunde kommt derzeit, wenn es um Liebe geht, etwas anderes gar nicht mehr infrage. Wer auf sich hält, hat eine toxische Beziehung oder diagnostiziert wenigstens bei anderen eine solche. Und wie der Zeitgeist so spielt, ist auch gerade der große, der denkbar größte Roman zum Thema erschienen. Er stammt aber nicht aus unserer Zeit, sondern vom Ende des 19. Jahrhunderts, er heißt Die Puppe, und sein Autor ist Bolesław Prus, in Polen der Klassiker schlechthin, Pflichtstoff an Schulen – aber in Deutschland fast unbekannt. Was er in seinem zweibändigen Monumentalwerk schildert, ist aber im Kern nichts anderes als die fortschreitende Zerrüttung, ja buchstäblich lebensbedrohliche Vergiftung eines Mannes durch das kapriziöse On-off-Verhalten der angebeteten Frau.
So könnte man es jedenfalls in der Terminologie von heute ausdrücken. In der Ausdrucksweise der älteren Zeit würde man sagen: Die Frau hält ihn hin. Sie lässt sich die Verehrung des Mannes gefallen, erwidert sie aber nur gerade so weit, dass er nicht abspringt. Izabela ist die Tochter einer verarmten Adelsfamilie, Wokulski ein reicher Kaufmann; insofern bewahrt sie die Option einer finanziellen Sanierung der Familie, wenn sie ihn bei der Stange hält. Die Heirat zwischen einer Aristokratin und einem vermögenden Bürger wäre im Warschau der 1860er-Jahre durchaus schon möglich gewesen, von den Standesunterschieden haben fast nur die Vorurteile überlebt. Die allerdings sind erheblich, und Izabela ist von gesteigertem Herkunftsstolz. Als sie erfährt, dass ihr Vater bereits erhebliche Geldsummen von Wokulski erhalten hat, fühlt sie sich zutiefst gedemütigt – gewissermaßen schon vorab in eine Ehe verkauft.
Man kann die Kränkung nachvollziehen. Die dialektische Psychologie des Romans macht es dem Leser leicht, auch die nicht miterzählte Perspektive der Frau einzunehmen. In dieser Perspektive ist der Mann, wie man heute sagen würde, ein Stalker. Er verfolgt die Frau, die ihn, zumindest anfänglich, keineswegs ermuntert hat. Weder kennt er sie wirklich, noch versteht er sie, und wenn er gelegentlich doch etwas von ihrer Persönlichkeit mitbekommt, gefällt es ihm nicht einmal. Er ist ein moderner Mann nach den Begriffen der Zeit, er fühlt sich spontan auch eher zu modernen, emanzipierten Frauen hingezogen. Sie dagegen ist konventionell durch und durch, sie plappert, wie er einmal bitter bemerkt, nichts als die Plattitüden ihrer Adelswelt nach. Sie ist für ihn in doppeltem Sinne eine Puppe: zum einen nur Projektionsfläche seines Begehrens, zum anderen Puppe im Sinne einer Marionette, die von außen gelenkt wird, an den Strippen ihres sozialen Milieus hängt.
Was also soll das werden? Die Enttäuschung ist programmiert, und man wundert sich, dass es dem Autor gelingt, sie bis zum bitteren Ende auf 1.200 Seiten zu strecken. Es gelingt aber, weil Prus seine Liebesgeschichte, oder besser gesagt: Nichtliebesgeschichte, mit zahllosen Figuren und Episoden in das ökonomische und soziale Abhängigkeitssystem der Zeit einbettet, gewissermaßen die ganze Bühnenmaschinerie zeigt, von der die Frau gesteuert wird und die der Mann zu zerstören versucht. Sein trotziger Kampf um die Liebe Izabelas ist zugleich eine Revolte gegen die Machtverhältnisse in der damals russischen Provinz Polen (dem sogenannten Kongresspolen), wo reaktionäre Feudalstrukturen und kapitalistisches Wirtschaftsleben widerstreiten, aber auch autoritär zusammenfinden.
In diesem Geflecht – dem toxischen Urgrund der toxischen Affäre – will sich Wokulski durchsetzen, es gelingt ihm aber nur als Geschäftsmann, nicht als Liebhaber. Es ist, wie sich erst im Laufe der Handlung zeigt, gar keine Liebes-, sondern eine Machtfrage – die Verwechslung macht die Tragik der Geschichte aus. Wokulski muss scheitern, weil er die Machtfrage nicht politisch stellt, sondern individuell, für sich allein, vor dem Traualtar entscheiden möchte. Er ist kein Bel Ami wie in Maupassants Roman, der die Klassenschranken widerstandsarm als Spielzeug der Frauen überwindet, sondern er will es auf Biegen und Brechen, als Triumph des Willens.
Aber wie immer er es anstellt: Kaputt geht dabei nichts, nur er selbst. Die Tragik seines Liebeswütens steigert sich vielmehr noch dadurch, dass er am Ende selbst tut, was er bei seinen Zeitgenossen verachtet, nämlich einen der Marionettenfäden der Konvention zieht, an denen die Puppe seiner Begierde hängt, und Izabela zu einem halbherzigen Eheversprechen bringt.
Für einen Moment taumelt er im Glück des Sieges, aber wirklich nur einen Moment lang. Wenig später zeigt sich, dass die Puppe doch über einen Rest von Eigenleben verfügt. Vielleicht zieht auch ein anderer mit leichterer Hand und kundiger an den Fäden – jedenfalls beginnt sie vor seinen Augen im Eisenbahnabteil mit einem Nebenbuhler zu poussieren. Die beiden fühlen sich unbeobachtet, sie sitzen im Halbdunkel und sprechen englisch, aber Wokulski sieht sie im Spiegel gegenüber – und er beherrscht die Sprache sehr wohl. Es ist eine der berühmtesten Szenen der polnischen Literatur, und man versteht auch sofort, warum. Vergleichbar virtuos Geschildertes findet sich höchstens bei Flaubert in der Verführungsszene zwischen Emma Bovary und Rodolphe oder bei Stendhal in der nächtlichen Mutprobe Julien Sorels, Madame de Renal bei Tisch zu berühren. Es sind minutiöse Protokolle einer Verschränkung von äußerer Wahrnehmung und innerem Erleben, nur dass sich darin bei Prus keine Liebe entfaltet, sondern zersetzt.

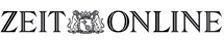 vor 5 Stunden
1
vor 5 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·