Verbale Erniedrigungen, Ende der Entwicklungshilfe, Zölle für alle Welt: Wie Trump die internationalen Beziehungen gefährdet
29. April 2025, 11:29 Uhr

Als Joe Biden 2020 das Präsidentenamt von Donald Trump übernahm, verkündete er: "Amerika ist wieder da!" Es war ein klares Bekenntnis zu den internationalen Bündnissen der USA, die sein Vorgänger verprellt hatte. Vier Jahre später versprach Trump in der Antrittsrede seiner zweiten Präsidentschaft dann, das Land werde seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zurückerobern – die ganze Welt werde dabei in Ehrfurcht und Bewunderung versetzt.
Von Bewunderung kann heute keine Rede sein. Die ersten Wochen seiner zweiten Präsidentschaft waren von Aufkündigungen internationaler Kooperationen geprägt. Und wie eine dunkle Wolke hängt der Zollstreit über den diplomatischen Beziehungen der USA. Heute gilt wieder, was Trump schon in seiner ersten Amtszeit verkündete: "America First!"
Der von den USA eingeschlagene Kurs könnte die Welt destabilisieren und die eigene Macht langfristig untergraben, schrieb der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Beckley kürzlich in einer Analyse für das Foreign Affairs Magazine. Ein großer Teil der Welt ist abhängig von den USA – ob wirtschaftlich, sicherheitspolitisch oder durch Entwicklungshilfe. Welche Regionen sind besonders von Trumps Außenpolitik betroffen?
Übersicht:
Verwehrte Hilfe: Der Globale Süden
Eines der größten Wirkungsgebiete der trumpschen Politik im Ausland ist der Globale Süden. Kein Land der Welt gibt mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit aus als die USA. Dieses Geld, sagt Trump, soll künftig in den Vereinigten Staaten bleiben, bei den US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern. Tausende Mitarbeitende der Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) wurden deshalb entlassen und Milliarden an Geldern gestrichen. Die Einsparungen in der Entwicklungshilfe der USA werden vielen Menschen das Leben kosten. Das Center for Global Development (CGD) geht davon aus, dass die amerikanische Entwicklungszusammenarbeit jährlich zwischen zwei bis fünf Millionen Menschenleben rettet – etwa durch Malariaimpfungen, Medikamente gegen HIV oder humanitäre Hilfe in Katastrophengebieten. Trump beendete zahlreiche der Programme – USAID ist ausgehöhlt.
Die CGD identifizierte 26 Länder, die wegen ihrer Abhängigkeit von amerikanischer Entwicklungshilfe nun besonders unter Druck stehen. An der Spitze stehen Afghanistan, Somalia, Südsudan und Malawi. Die amerikanische Hilfe im Gesundheitsbereich übersteigt in vielen dieser Länder die Gelder, die dem Gesundheitssystem von staatlicher Seite zur Verfügung stehen. Die fehlende Hilfe aus dem Ausland können sie kaum kompensieren – sie sind zu abhängig von ihr. Im Sudan etwa zeigt sich wie abhängig. Suppenküchen in dem Bürgerkriegsland wurden kurz nach Trumps Ankündigung, die Entwicklungszusammenarbeit einzustellen, geschlossen. Für viele Bewohner waren sie die letzte Möglichkeit, an Essen zu kommen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung leidet Hunger, täglich sterben Kinder an Unterernährung.
Auch die EU wird die wegfallende amerikanische Hilfe nicht kompensieren können. Die Einschnitte durch Trump kommen in einer Zeit, in der auch viele europäische Regierungen ihre Entwicklungszusammenarbeit zurückfahren, um etwa ihre Verteidigung auszubauen.
Alte Freunde: Die EU und die Nato
Schon während seiner ersten Amtszeit forderte Donald Trump mit Nachdruck höhere Verteidigungsbudgets der europäischen Nato-Mitgliedstaaten. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel machte 2017 klar: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei." Acht Jahre später sind "diese Zeiten" wohl vollends vorüber.
Dass US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres den europäischen Verbündeten "Demokratieverlust" vorwarf, zeigte, dass die Trump-Regierung ihren europäischen Verbündeten heute nicht mehr nur den Vorwurf macht: Ihr nehmt uns wirtschaftlich aus (Handelsdefizit!) und lasst euch von uns beschützen – sondern sich auch ideengeschichtlich einem anderen Lager zugehörig fühlt. Vance beklagt die Bestrafung von "Gedankenverbrechen" in Europa und übergeht dabei die Festnahme von ausländischen Studierenden in den USA, die sich propalästinensisch positioniert haben. Vance warnt vor "Brandmauern", während die USA außenpolitisch dem Isolationismus anheimfallen und im Inland Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel aus Angst das Haus nicht mehr verlassen. Und in dem geleakten Militärchat im März war gar zu lesen, dass Vance Europäer als "Schmarotzer" bezeichnete.
Joe Bidens Präsidentschaft, und seine gute Beziehung vor allem zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), kann in den transatlantischen Beziehungen des letzten Jahrzehnts damit höchstens als Zwischenhoch gelten.
Wer ist Freund und wer ist Feind? Die Ukraine und Russland
100 Tage ist Trump jetzt im Amt – und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert immer noch an. Dabei hatte der US-Präsident bereits im Wahlkampf versprochen, den Krieg "binnen 24 Stunden" beenden zu können. Und so langsam scheint Trump die Geduld zu verlieren. Angeblich liegt das vor allem am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem er (nach dessen Demütigung im Ovaloffice) "aufhetzerische Äußerungen" vorwirft, die die laufenden Friedensverhandlungen erschwerten. Gemeint ist damit Selenskyjs Weigerung, die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krim im Rahmen eines Abkommens abzutreten – wobei sich Trump nach einem Gespräch mit Selenskyj im Vatikan optimistisch zeigte, dass ein "Deal bevorsteht".
Mit Russlands Präsident Wladimir Putin ist Trump hingegen immer wieder erstaunlich nachsichtig, zeigt sich mal "sehr wütend und verärgert"; Putins demokratische Legitimität hat Trump, anders als Selenskyjs, bisher aber nicht angezweifelt. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kritisierte zuletzt, dass die US-Regierung zu wenig Druck auf Russland ausübe.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass Trump davor zurückschreckt, Aggressor und Opfer klar zu benennen, weil das zulasten eines möglichen "Deals" gehen könnte, den er vermittelt hätte. Ein Deal, der ihn dazu befähigte, sich als großen Friedensbringer zu inszenieren. Eine fadenscheinige Taktik, und eine, die das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer ausblendet. Die erste Auslandsreise nach der russischen Vollinvasion seines Landes führte Wolodymyr Selenskyj nach Washington, D. C. Wohin würde er wohl heute fliegen?
Mit dem Tiger um sein Fell verhandeln: China und Asien
Trump hatte Zölle im Wahlkampf angekündigt, doch das Ausmaß seiner Handelspolitik hat die weltweiten Finanzmärkte aufschrecken lassen. Viele der Zölle hat der US-Präsident inzwischen pausiert, doch der Handelsstreit mit China drohte zwischenzeitlich zu eskalieren. Mit seiner üblichen Taktik, Autokraten wie Putin oder Kim Jong Un durch Drohungen und Druck an den Verhandlungstisch zu bringen, scheint Trump bei dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Leere zu laufen: Anders als andere Staatschefs will Xi ihn einfach nicht anrufen. Das geht so weit, dass Trump behauptet, seine Regierung spreche mit einer chinesischen Delegation – und China das bestreitet.
Stattdessen reist Xi durch Asien, wirbt um vertiefte Handelspartnerschaften und droht anderen Staaten, sollten die den Handel mit China auf Druck der USA einschränken. Für viele asiatische Länder wird das zu einer Gratwanderung. Die USA und China sind zum Beispiel die größten Handelspartner Japans. Das Land kann wirtschaftlich auf keinen der beiden verzichten. Auch Taiwan befindet sich in einer unangenehmen Lage. Das Land ist auf den Schutz der USA angewiesen, während der Nachbar auf der anderen Seite der Taiwanstraße militärisch immer stärker wird. Gleichzeitig wurde Taiwan mit hohen Zöllen belegt. Das Kabinett der taiwanischen Regierung bezeichnete diese als "zutiefst unangemessen" und "höchst bedauerlich", verzichtete aber auf Gegenzölle. Bereits jetzt zeigt sich jedoch, wie sich die Zollpolitik auch auf die USA auswirkt: Das Datenanalyseunternehmen Global Data geht davon aus, dass etwa die Produktion medizinischer Geräte unter den Zöllen auf taiwanesische Halbleiter leiden wird. Und die Rüstungs- oder Fahrzeugindustrie ist auf Seltene Erden aus China angewiesen, deren Export die Volksrepublik seit Beginn des Handelskonflikts faktisch komplett eingestellt hat.
Das chinesische Handelsministerium ließ kürzlich verlauten: Nach sogenannten Ausnahmeregelungen zu suchen, die den Interessen anderer schadeten, um eigene egoistische und kurzsichtige Vorteile zu erzielen, sei, als würde man mit einem Tiger um sein Fell verhandeln. Am Ende führe das zu einer Lose-lose-Situation. Letztlich sieht die chinesische Führung in der aktuellen Handelspolitik des amerikanischen Präsidenten wohl auch die Chance, der Welt zu zeigen: "Schaut her, die USA sind kein verlässlicher Partner mehr. Wir schon."
Bester Baugrund und ein Atomabkommen: Der Nahe Osten
In den letzten Monaten hat wenig außenpolitisch für mehr Kopfschütteln gesorgt als Trumps Pläne für den Gazastreifen. Bei einem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu schlug er vor, dass Palästinenser den Küstenstreifen freiwillig verlassen sollten, US-Truppen übernehmen und dort eine "Riviera des Nahen Ostens" aufbauen könnten. Gaza sei ein "außergewöhnliches Baugrundstück". Die internationale Kritik war heftig, doch die rechte Regierung Israels nahm die Pläne gerne auf: Im Verteidigungsministerium von Israel Katz soll eine spezielle Abteilung gegründet werden, die sich um eine "freiwillige" Migration von Palästinensern aus dem Gazastreifen kümmert.
Einen Erfolg sucht Trump unterdessen im Iran. 2018 hatte er das bestehende Atomabkommen mit dem Land einseitig aufgekündigt. Nun fordert er ein neues – und droht dem Iran mit Bombenangriffen, sollte das Land einer Lösung nicht zustimmen. Dass der Iran heute deutlich näher dran ist, eigene Atomwaffen bauen zu können, hängt dabei natürlich mit Trumps Austritt aus dem Abkommen zusammen. Die USA fordern, dass die islamische Republik vollständig auf ihre Urananreicherung verzichtet, ihr Waffenentwicklungsprogramm beendet und die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah nicht weiter unterstützt. Der Iran hat das bisher zurückgewiesen, ist aber offen dafür, ein Abkommen darüber zu unterzeichnen, dass das Land frei von Atomwaffen bleibt.
Auf gute Nachbarschaft? Kanada und Mexiko
Während Trumps erster Amtszeit wären die USA beinahe aus dem Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko ausgestiegen. Gefordert hatte das unter anderem der ultrarechte Publizist und frühere Präsidentenberater Steve Bannon. Doch der US-Präsident hatte noch ausreichend gemäßigtes Personal um sich, das ihn vor einem solch radikalen Schritt warnte. Trump hörte zu, Nafta wurde neu verhandelt. Heute sind diese mäßigenden Stimmen in Trumps Beraterstab verstummt: Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko setzte Trump teilweise aus, auch weil Mexiko versprach, im Gegenzug zusätzliche Grenzsoldaten zu entsenden. Trump unterstellt, aus Mexiko und Kanada kämen Drogen in "sehr hohen und nicht hinnehmbaren Mengen" in die USA – von seinen Unterstellungen gegenüber irregulären Migrantinnen und Migranten ganz zu schweigen.
Über eine
Verlängerung des Nafta-Nachfolgers USMCA um weitere 16 Jahre soll
bis Anfang Juli 2026 entschieden werden. Bei Trumps derzeitigem Vorgehen
ist anzunehmen, dass er Kanada und Mexiko schon deutlich früher in
Verhandlungen zwingen wird. Gute Nachbarschaft sieht anders aus.
Das liegt auch daran, dass Trump in den vergangenen Wochen mehrfach damit gedroht hat, das nördliche Nachbarland zu annektieren. Den ehemaligen Premierminister Kanadas, Justin Trudeau, verspottete er als "Gouverneur" eines künftigen "51. Bundesstaats" der USA. Mit diesem Verhalten habe er die Beziehung zwischen den Nachbarstaaten nachhaltig verändert, sagte Trudeaus Nachfolger Mark Carney im März. "Die alte Beziehung, die wir zu den Vereinigten Staaten hatten und die auf einer vertiefenden Integration unserer Volkswirtschaften und einer engen sicherheitspolitischen und militärischen Zusammenarbeit beruhte, ist vorbei", sagte Carney. "Es gibt kein Zurück."

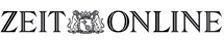 vor 7 Stunden
1
vor 7 Stunden
1










 English (US) ·
English (US) ·