Seit mehr als 30 Jahren liegen Conni-Bücher in deutschen Kinderzimmern, jetzt hat das Mädchen mit der roten Haarschleife seine Identität gewechselt: „Ronni ändert aus rechtlichen Gründen seinen Namen“, steht über einem Bild des Kindes, das nun einen Schnurrbart trägt. Das auf der Plattform X geteilte Bild ist kein echtes Cover einer neuen Conni-Folge, es ist eines der berühmten Conni-Memes, die seit vergangener Woche für Schlagzeilen sorgen.
Memes sind Bilder oder Videos, die in Kombination mit einem Text oft als parodistischer Kommentar verbreitet werden. Im Fall der Conni-Memes werden die Original-Titel, die oft mit einer erzieherischen Botschaft einhergehen („Conni sagt Stopp“), in ihr Gegenteil verkehrt: „Conni klaut bei Rewe“. Kombiniert wird solch ein Text mal mit passenden Original-Titelbildern, mal mit Covern, die durch Künstliche Intelligenz erstellt wurden.
Die Conni-Memes gibt es schon lange, im Juni hat der Carlsen-Verlag, in dem die Conni-Büchlein erscheinen, „Informationen zu Conni-Memes“ veröffentlicht. Darin heißt es: „Für keines der im Umlauf befindlichen Conni-Memes liegt eine Genehmigung oder Freigabe des Verlages vor.“ Man werde „rechtliche Schritte prüfen“. Daraus wurden vergangene Woche Schlagzeilen wie: „Carlsen-Verlag verbietet Conni-Memes und verschickt Abmahnungen.“ Seitdem ist die Aufregung in den sozialen Medien groß – was sich vor allem in noch mehr Conni-Memes ausdrückt.
 Keine echten Cover: Diese Memes sind Parodien auf die beliebten Conni-Kinderbücher – und dürfen als solche verbreitet werden.connimeme/Instagram
Keine echten Cover: Diese Memes sind Parodien auf die beliebten Conni-Kinderbücher – und dürfen als solche verbreitet werden.connimeme/InstagramDer Carlsen-Verlag hat gegenüber der F.A.Z. nun zum ersten Mal ein konkretes Meme bestätigt, gegen dessen Verbreiter er Anzeige erstattet hat. Die Anzeige richtete sich demnach gegen den Rechtsextremen Thomas Brauner, der während der Corona-Pandemie als Busfahrer bekannt geworden war, weil er Kinder aufgefordert hatte, im Bus die Masken abzuziehen. In seinem Telegram-Kanal veröffentlichte er 2024 dann ein Meme im Stil von Conni-Büchern, ein schwarzer Junge hält darauf ein weißes Mädchen beim Spielen im Wasser im Arm. Dazu hieß es: „Matumbo erforscht Mädchenkörper im Freibad“. Auf dem Cover war das Logo des Carlsen-Verlags zu sehen. Der Fall liegt noch bei der Staatsanwaltschaft, in dem Telegram-Kanal ist das Bild gelöscht. Insgesamt habe man bis heute eine zweistellige Zahl von Personen aufgefordert, eine unzulässige Verwendung der Conni-Figur zu löschen, teilte eine Verlagssprecherin mit.
„Wenn es ein Meme ist, ist es in der Regel erlaubt.“
Der Verlag hatte am Wochenende schon klargestellt, dass man nicht allen Conni-Meme-Erstellern mit Klagen drohe, sondern nur „in bestimmten Fällen“ dazu auffordere, ein Meme zu löschen. Und zwar erstens bei menschenverachtenden, rassistischen, gewaltverherrlichenden und pornographischen Conni-Memes. Und zweitens bei der Nutzung von Conni-Memes zu kommerziellen Zwecken, für Werbung also zum Beispiel. In der Klarstellung hieß es weiter, dass es den Verlag freue, dass die Figur Conni so beliebt sei, dass sie Menschen zu lustigen Beiträgen inspiriere – „doch auch vor diesem Hintergrund gelten klare Regeln“. Zumindest den letzten Punkt kann man getrost als falsch bezeichnen – es lässt sich vieles über Gesetze zu dem Treiben auf Social-Media-Plattformen sagen, dass sie „klar“ seien, aber bestimmt nicht.
Das weiß auch Urs Verweyen. Er ist Rechtsanwalt in Berlin und wurde schon als Fachmann für Urheberrecht in den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags geladen. Er sagt: „Wenn es ein Meme ist, ist es in der Regel erlaubt.“ Im Urheberrechtsgesetz heiße es unter Paragraph 51a ganz klar, dass die Verbreitung eines veröffentlichten Werks „zum Zweck der Karikatur, der Parodie oder des Pastiche“ zulässig ist. Als „Pastiche“ werden Werke bezeichnet, die verschiedene Elemente anderer Werke nachahmen oder miteinander kombinieren, zum Beispiel als Samples in Liedern. „In der Begründung der Bundesregierung zu dem Gesetz werden Memes ausdrücklich als Beispiel für Parodie oder Pastiche genannt“, sagt Verweyen.
Juristisch betrachtet müsse ein Meme kein eigenes Werk sein, sondern sich nur mit dem Originalwerk oder einem sonstigen Bezugsgegenstand auseinandersetzen. Deswegen hält er zumindest einen Punkt in der Erklärung des Carlsen-Verlags für „nicht richtig“: „Auch kommerzielle Nutzungen, zum Beispiel in der Werbung, sind grundsätzlich erlaubt.“ Verweyen interpretiert das Gesetz so, dass Urheber nicht nach Belieben darüber bestimmen können sollten, wie sich Andere mit ihrer Kunst auseinandersetzten – und auch kommerzielle Kommunikation sei von der Meinungs- und Kunstfreiheit umfasst.
Wer definiert, was menschenverachtend ist?
Damit ein Meme keine Urheberrechte verletzt, müssen laut Verweyen drei Kriterien erfüllt sein: Erstens müsse es sich um eine Parodie oder ein Pastiche handeln. Zweitens dürfe „kein unmittelbarer Wettbewerb zur üblichen Nutzung des Originals“ bestehen. „Die Conni-Memes konkurrieren ja nicht mit Conni-Büchern, im Gegenteil: Sie machen das Original noch bekannter.“ Drittens dürften durch ein Meme „sonstige berechtigte Interessen des Rechteinhabers nicht unzumutbar beeinträchtigt werden“ – das sei bei einer kommerziellen Nutzung nicht der Fall. „Aber bei menschenverachtenden Inhalten schon“, sagt Verweyen.
Der Verlag könne mit Erfolg gegen menschenverachtende Memes vorgehen, weil er nicht hinnehmen müsse, dass er oder die Autoren in Verbindung mit solchen Inhalten gebracht werden. Der Europäische Gerichtshof hatte 2014 dem Rechteinhaber an der Titelseite einer in Belgien beliebten Comicfigur recht gegeben. Er hatte gegen einen rechtsradikalen Politiker geklagt, der in Belgien im Wahlkampf die Titelseite so verfremdet hatte, dass dort ein Politiker zu sehen war, der Münzen in die Luft warf, die verschleierte und dunkelhäutige Menschen aufsammelten. Bei solch einer rechtswidrigen Nutzung ist man verpflichtet, das Meme herunterzunehmen, man kann auf Schadenersatz verklagt werden und die Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen müssen.
Aber wer definiert denn nun, was genau menschenverachtend ist? Der Verlag, der alle konservativen Conni-Memes einfach verbieten lasse, wie in der rechtspopulistischen Blase gefolgert wurde? Schnell wurden Bezüge zu der Diskussion um die Begriffe „Hass und Hetze“ hergestellt, auf deren Grundlage Inhalte in den sozialen Netzwerken ausgemacht werden sollen, die dann von Plattformbetreibern gelöscht werden müssen. Vergangenes Jahr war Mitgliedern der Ampelregierung vorgeworfen worden, diese Begriffe sehr weit auszulegen, um andere politische Meinungen zu unterdrücken.
Dabei haben Politiker in Deutschland nicht die Macht, zu entscheiden, was noch zulässig und was rechtswidrig ist – das machen am Ende Gerichte. Und so ist es auch bei Conni-Memes.

 vor 8 Stunden
1
vor 8 Stunden
1


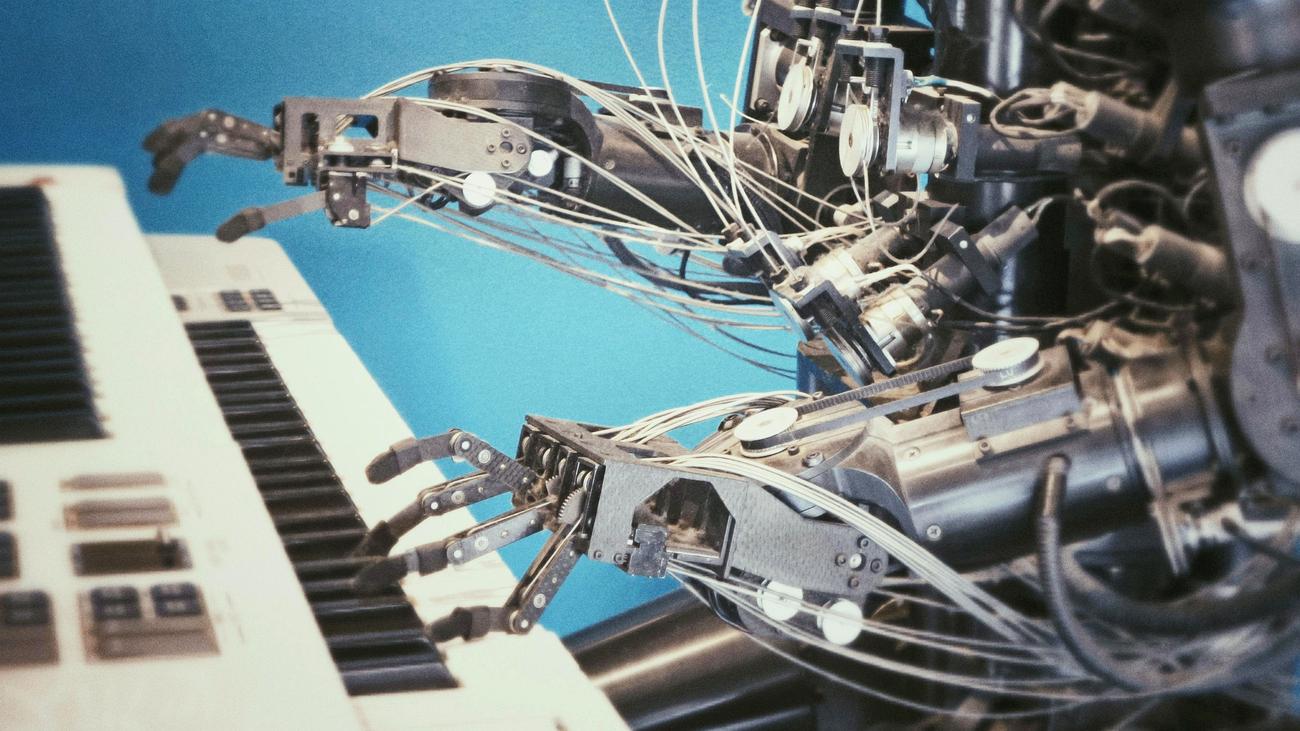








 English (US) ·
English (US) ·