Der spätere Namensgeber des Museums war ein großer Freund von Zoos. 1907 entdeckte Franz Marc den Berliner Tiergarten für sich, zeichnete Bären, Seeadler, Flamingos, Löwen, Elefanten, schrieb seiner späteren Ehefrau Maria Franck, er empfinde den Zoo als „voll des Wunderbaren, voll ,Geist‘.“ Zwei Jahre später malte er Hanni und Schlick, Rehe, die er in seinem Garten in Sindelsdorf hielt und die Maria und er wie Kinder umsorgten. Sein berühmtes Bild „Affenfries“ von 1911 zeigt eine Gruppe von Makaken. Ob er eine solche im Münchner Tierpark Hellabrunn gesehen hat, der im gleichen Jahr eröffnet wurde, ist nicht bekannt.
Dass Tiere fühlen, das war für Marc eine Binse. Seine Zeit aber hatte ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Tier-Mensch-Beziehung und nicht durchgehend artgerechte oder ethisch vertretbare. Die Ausstellung „Die Moderne im Zoo“ erkundet im Franz-Marc-Museum Tierparks als Orte künstlerischer Inspiration. Eingerichtet hat die Schau die Direktorin des Hauses, Jessica Keilholz-Busch, gemeinsam mit K. Lee Chichester von der Universität Bochum. Die Kuratorinnen wollen den Spagat zwischen Kulinarik und seriösem Forschungsbeitrag leisten, und der gelingt auch.
 Eine Gruppe von Makaken hat der begeisterte Maler im Zoo studiert: Franz Marc „Affenfries“ (1911)bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke Walford
Eine Gruppe von Makaken hat der begeisterte Maler im Zoo studiert: Franz Marc „Affenfries“ (1911)bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke WalfordZunächst mit Bildern aus dem eigenen Bestand, der rund zweitausend Werke umfasst, dann mit Leihgaben großer Häuser wie Belvedere, Städel, Lenbachhaus und des Berliner Kupferstichkabinetts. In den beiden Obergeschossen werden auf 550 Quadratmetern 170 Exponate gezeigt, darunter Werke von August Macke, Paul Klee, Gabriel von Seidl, Adolph Menzel, Paul Meyerheim, Max Slevogt, Alfred Kubin und Lovis Corinth, dazu Skulpturen von Wera von Bartels, Max Esser, August Gaul und Renée Sintenis.
Der Zuspruch ist für ein Museum, das ein wenig versteckt in einem Winkel des Oberlandes steht, bemerkenswert. Keilholz-Busch rechnet in diesem Jahr mit 50.000 Besuchern, an Spitzentagen kommen an die fünfhundert in das in Hanglage mit See- und Bergblick gelegene Haus nebst Skulpturenpark, das 2008 eröffnet wurde – mehr sei gar nicht zu verkraften. Getragen von der Franz Marc Stiftung und der Stiftung Etta und Otto Stangl, spielt das Museum vierzig Prozent seiner Kosten selbst ein.
 Friedrich Seidenstücker war Spezialist für humorvolle Tierfotografie. Aufnahme aus dem Zoologischen Garten von Berlin (1925).bpk / Friedrich Seidenstücker
Friedrich Seidenstücker war Spezialist für humorvolle Tierfotografie. Aufnahme aus dem Zoologischen Garten von Berlin (1925).bpk / Friedrich SeidenstückerDer Zoo als Paradiesgarten, als Gegenentwurf zur Industriemoderne? Das klingt zumutungsreich, und doch haben um die vorletzte Jahrhundertwende viele Besucher die neuen Tierparks so empfunden. Als Flucht aus dem Alltag boten Zoos Großstadtbewohnern das Gefühl, für ein paar Stunden in die Wildnis zu gelangen. Nicht nur Künstler ließen sich von Illusionisten wie dem Hamburger Carl Hagenbeck verführen, der seinen Tierpark so gestaltete, als würden die Tiere miteinander leben, als wären Nahrungskette und Fressfeindschaft überwundene Konzepte. Emotionen, die auch heute erfolgreich bedient werden. Unlängst kursierte ein Video, das die Elefantenkuh Magda zeigte, wie sie ihre langjährige Gefährtin Jenny „wie ein Mensch“ betrauerte. Und im Nürnberger Zoo wird diskutiert, ob man Paviane tötet – aus Platzgründen.
Zunächst aber regiert der Reiz der Exotik. Maler sind begeistert, wilde Tiere studieren zu können, sie so zu malen, wie es ihnen gefällt, weil keine Konvention für die Darstellung von Hyänen, Zebus, Giraffen oder Mandrills existiert, anders als bei Pferden, Pfauen, Hirschen. Der Fotograf Ottomar Anschütz inszeniert Raubtiere im Breslauer Zoo vor Leinwänden, die monochromen Hintergründe erzeugen unfreiwillig seltsame Effekte: Der Tiger sieht aus, als lebe er in der Savanne und nicht im Dschungel. Am Eingang der Zoos stehen meist Männer, wie sie unter anderem Max Liebermann schon 1900 mit seinem „Papageienmann“ verewigt hat. Im Jahr darauf malt Paul Klimsch das Bild „Max Slevogt malt den Papageienwärter“, eine Plein-Air-Porträtsitzung, aus deren gedeckten Erdfarben das Gefieder der Papageien heraussticht.
 Mit einer gewissen Melancholie: August Mackes Gemälde „Kleiner Zoologischer Garten in Braun und Gelb“ (1912)Museum Frieder Burda
Mit einer gewissen Melancholie: August Mackes Gemälde „Kleiner Zoologischer Garten in Braun und Gelb“ (1912)Museum Frieder BurdaPaul Meyerheim, der von 1883 an die Tiermalklasse der Berliner Kunstakademie leitet, fängt das enthemmte Staunen der Zuschauer ein, zeigt den menageriehaften Charakter wandernder Tierschauen. Inklusive der indigenen Pfleger, die mit den Tieren nach Europa exportiert werden und zusammen mit diesen ausgestellt werden, etwa wenn ein Schwarzer in Lendenschurz ein Krokodil auf den Schultern trägt, Zebu, Affen und ein Elefant garnieren die Szene. Oder wenn in Meyerheims „Die eifersüchtige Löwin“ (1886/90) eine vollbusige Dompteuse den Löwen krault und dafür wütendes Fauchen der Löwin kassiert. Menschliche Gefühle in Tieren und umgekehrt?
Rassismusverdachtsmomente werden selbstredend kontextualisiert, Meyerheim, so liest man, bediene „ein voyeuristisches Begehren“, seinem Publikum werde „ein Gefühl kultureller Überlegenheit vermittelt“, das letztlich dazu diene, die bestehende Ordnung zu stabilisieren. Dabei schwingt auf manchen Bildern eine Melancholie mit, wie in August Mackes „Kleiner Zoologischer Garten in Braun und Gelb“ (1912), verschwommene menschliche Gestalten, den Blick zu Boden gerichtet, die Köpfe geneigt, als würden sie sich in Gegenwart der Papageien nicht wohlfühlen.
 Ihren Bären kennt man als Trophäe der Berlinale: Renée Sintenis schuf die Skulptur „Junges Lama“ im Jahr 1924.Sammlung Karl H. Knauff/VG Bild-Kunst, Bonn 2025
Ihren Bären kennt man als Trophäe der Berlinale: Renée Sintenis schuf die Skulptur „Junges Lama“ im Jahr 1924.Sammlung Karl H. Knauff/VG Bild-Kunst, Bonn 2025Auch gebiert die Verführung durch Exotik gelegentlich ungedeckte Schecks. Oskar Kokoschkas Hybridwesen „Tigerlöwe“ (1926) springt schier aus dem Rahmen, der Farbauftrag ist expressiv, mit blauen Striemen und rot-weißen Aufhellungen im gescheckten Fell. Die gerissene Antilope zu seinen Füßen wirkt wie eine zu klein geratene Fußnote, dem Betrachter des Bildes sollte es so ergehen wie Kokoschka vor dem Käfig im Londoner Zoo, der eine „flammende, gelbe Bombe“ auf sich zustürmen sah, die ihn „in Fetzen reißen wollte“. Dabei kannte der Tigerlöwe von Geburt an nur das Leben hinter Gittern, war vermutlich lethargisch.
Die Abteilung „Aquariummanie“ widmet sich der Unterwasserwelt, über die man noch weniger wusste, auch wenn Ernst Haeckel an der Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst schon zeichnerische Höchstleistungen vollbracht hatte. Alfred Kubin imaginierte noch die Monster der Tiefsee („Meeresgrund“, 1906), bis Mitte der Zwanzigerjahre der Franzose Jean Painlevé mit den ersten Dokumentarfilmen Licht ins Dunkel brachte. Da hatte Paul Klee mit „Guter Fischplatz“ (1922) schon sanft ironisch seine blauen Phantasiefische schwimmen lassen.
Skeptiker gab es damals wie heute. Rilkes Panther-Gedicht („Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe / so müd geworden, daß er nichts mehr hält“) grundiert als Leitmotiv die Schau. Die besten Panther liefert Otto Dill, seine um 1918 entstandenen Raubkatzen sind bedrohlich schimmernde, dynamisierte Geschosse, pure Wildheit. Zum ultimativen Prüfstein aber wird wie im richtigen Leben die Verwandtschaft – die Affen. Da menschelt es richtig. Schon 1863 hatte Meyerheim den „Geigenden Affen“ gemalt, bei Gabriel von Max’ „Affen als Kunstrichter“ (1889) werden dreizehn Affen zu einem Knäuel von Körpern, das gebannt versucht, sich in einem Spiegel zu betrachten. Tiere sehen sich an und erkennen, dass sie sich anpassen müssen, solange sie dem Menschenzoo ausgeliefert sind.
Die Moderne im Zoo. Franz-Marc-Museum, Kochel am See; bis zum 9. November. Der Katalog (Hirmer Verlag) kostet 29,90 Euro.

 vor 8 Stunden
1
vor 8 Stunden
1



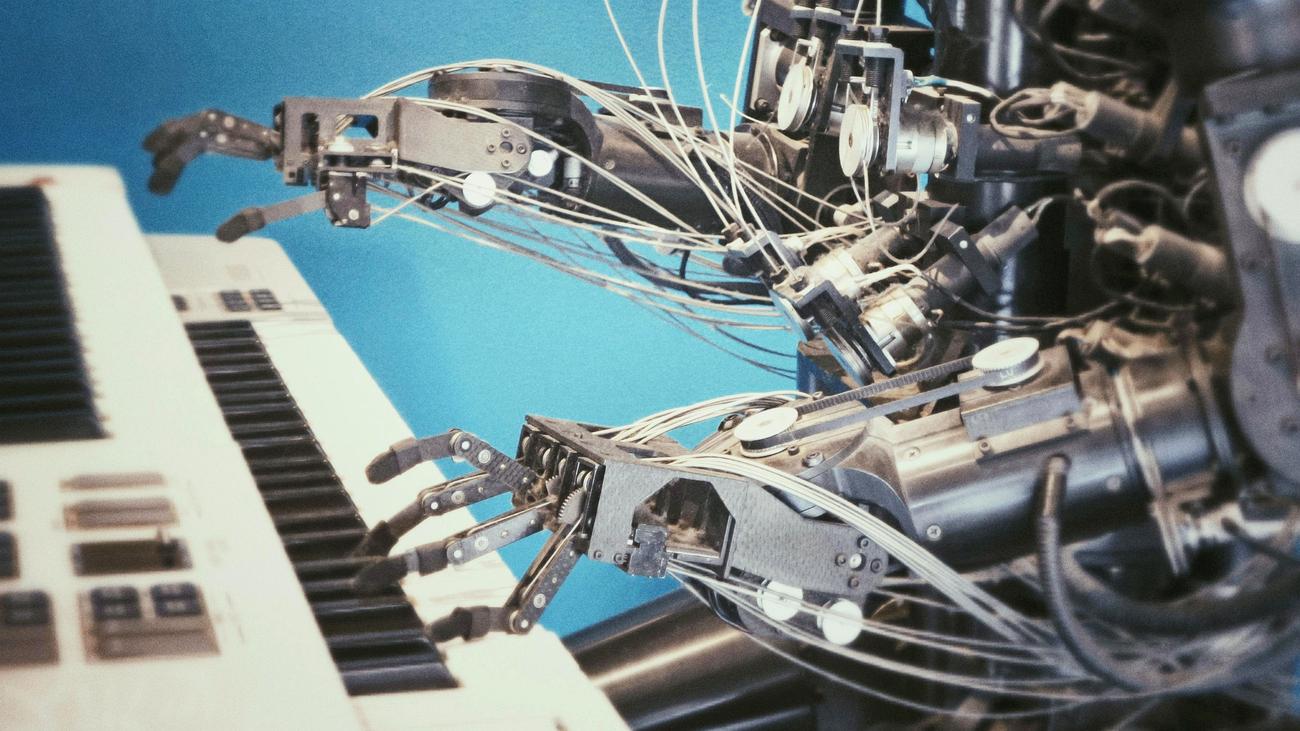







 English (US) ·
English (US) ·