Polit-Talkshows über globale Krisen beginnen häufig mit dem Geräuschpegel der Weltlage und enden im Grundrauschen der politischen Unversöhnlichkeit. „Caren Miosga“ wählte an diesem Abend einen anderen Zugang und traf damit eine Form, die dem Thema angemessen war: denn es sollte um die Lage in Iran gehen und die Frage, ob ein US-Militärschlag kurz bevorsteht.
Den Unterschied machte die Besetzung: drei Fachleute, kein Politiker. Am Tisch saßen Natalie Amiri, langjährige Iran-Kennerin, die bis 2020 aus Teheran berichtet hat, Peter Neumann, Sicherheitsexperte vom King’s College London, und Daniel Gerlach, Nahost-Analyst. Das ist in den Talkformaten des ÖRR selten genug, dass man kurz stutzt. Der Effekt war unmittelbar spürbar: weniger rituell-empörte Schnappatmung, mehr lange, argumentierende Passagen, die nicht an der nächsten Pointe, sondern an dem klügsten Argument interessiert waren.
„Trump geht es sicher nicht um Menschenrechte“
Miosgas Dramaturgie setzte auf ein Spannungsdreieck: Trump als Eskalationsmotor, Iran als Repressionsapparat, Europa als Akteur mit begrenzter Reichweite. Die Sendung montierte Trumps Drohgebärden und seinen „Deal“-Sprech in genau jener Widersprüchlichkeit, die sie politisch so wirksam macht: das Versprechen der Rettung, die Drohung der Vernichtung, dazwischen die Behauptung, man wolle nur verhandeln. Sicherheitsexperte Peter Neumann entzauberte das trumpsche Theater kühl als Methode: Maximalforderungen und das Einfordern totaler Unterwerfung als Verhandlungstaktik.
Die Runde blieb an der Frage hängen, was „Deal“ in Trumps Welt heißt – und was er dafür auf den Tisch legt: Drohkulisse, schnelle Eskalation, dann ein Gesprächsangebot, das eher nach Kapitulationsprotokoll als nach Diplomatie klingt. Dass zugleich ein Treffen von Trumps Gesandtem Witkoff im Raum stand, machte die Spannung greifbar: Verhandeln als Möglichkeit – und als Druckmittel. Und die Sendung tat gut daran, dieses „Eingreifen“ nicht automatisch mit Regimewechsel zu verwechseln: Wenn Trump militärisch handelt, dann eher als Strafaktion und als Demonstration von Handlungsfähigkeit, nicht als Beginn einer langen Ordnungspolitik. „Trump geht es sicher nicht um Menschenrechte“, resümiert Amiri treffsicher.
Das Trump-Porträt bekam in der Schalte in die USA einen sehr konkreten innenpolitischen Schatten: Eine ARD-Korrespondentin berichtete aus Minneapolis von den Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE – während auch die neu veröffentlichten Epstein-Akten für Unmut sorgen. Daraus ergab sich die naheliegende Frage: Dient die außenpolitische Iran-Drohkulisse nicht auch als Mittel, innenpolitische Unruhe zu übertönen?
Irans Kampf gegen die Bilder
Die stärksten Minuten der Sendung gehörten Natalie Amiri, weil sie dem geopolitischen Schachbrett, das die Expertenrunde zum Iran kartographierte, die unerträgliche Körperlichkeit der Gewalt entgegensetzte: Sie berichtete von Telefonaten mit Freunden und Bekannten in Iran, von gezielten Schüssen auf Demonstranten, von überfüllten Krankenhäusern und der bürokratischen Perversion eines Regimes, das Todesursachen als „Herzinfarkt“ deklariert.
Hier wurde Talkshow zu dem, was sie fast nie ist: ein Ort, an dem Sprache nicht nur Haltung simuliert, sondern Zeugenschaft ablegt. Der eingespielte Hilferuf einer jungen Frau aus Teheran gab dem Wahnsinn eine Stimme: die paradoxe Verzweiflung eines Volkes, das antiamerikanisch erzogen wurde und sich nun ausgerechnet an Amerika klammert, in der Hoffnung, das Donald Trump eingreift und das Regime stoppt.
Auch die Chronologie der Proteste und die Informationslage im Iran war Thema: Die Sendung erinnerte daran, dass die aktuelle Protestwelle nicht als abstrakter Freiheitsbegriff begann, sondern als wirtschaftlicher Protest im Basar-Milieu, bevor sie sich politisch radikalisierte – und dass der Staat mit Blackouts und Abschottung nicht nur Proteste, sondern vor allem Bilder, die gen Westen gelangen, bekämpft. Genau hier lag eine journalistische Stärke: Man ließ die Unsicherheit stehen, statt sie zu überspielen. Wenn über Tote, Dunkelziffern und Verifizierbarkeit gesprochen wurde, klang das nicht nach Gewissheit, sondern nach dem, was es ist: einer Lage, in der Information selbst zur entscheidenden Ressource wird.
Ein typisches Talkshow-Problem
Daniel Gerlach steuerte die nötige Regional-Perspektive bei und warnte vor der „trügerischen Ruhe“ am Golf; ein „Business as usual“, während im Hintergrund militärisch aufgerüstet wird. Besonders präzise war seine Einordnung der Zielkonflikte: Wer das Regime einhegen will, will nicht zwingend seinen Sturz – und wer seinen Sturz will, kann schlecht gleichzeitig seriös „Frameworks“ verhandeln.
Die Sendung hatte allerdings auch das typische Talkshow-Problem: Sie lief Gefahr, Trumps Frame zu übernehmen, indem sie die Frage „Greift er ein?“ zur zentralen Achse machte, obwohl Iran selbst nicht nur Objekt amerikanischer Launen ist. Die Runde korrigierte das oft, aber nicht immer. Wenn über „Venezuela“ als Blaupause gesprochen wurde, schwang die Hoffnung auf den „kurzen, sauberen“ Eingriff mit und man muss der Sendung zugutehalten, dass sie diese Hoffnung dann selbst wieder zerlegte: mit dem Hinweis auf Irans Größe, fehlende Alternativen und die Logik ideologischer Regime, die sich seit Jahrzehnten auf den Ernstfall vorbereiten.
Unterm Strich war das eine der seltenen Ausgaben, in denen die Talkshow nicht so tat, als ließe sich Weltpolitik in drei moralische Imperative pressen. Sie zeigte stattdessen etwas Unbequemeres: innenpolitischer Aufstand, außenpolitische Erpressungsfähigkeit und ein Regime, das sich ideologisch und institutionell seit Jahrzehnten auf genau diesen Tag vorbereitet hat. Wenn man dem deutschen Fernsehen etwas wünschen dürfte, dann nicht mehr „große Runden“, sondern öfter solche Abende: weniger Politikertheater, mehr Erklärung – und die Bereitschaft, dass eine Antwort auch einmal nur lautet: Es ist kompliziert, und wir haben keine Patentlösung.

 vor 2 Tage
1
vor 2 Tage
1



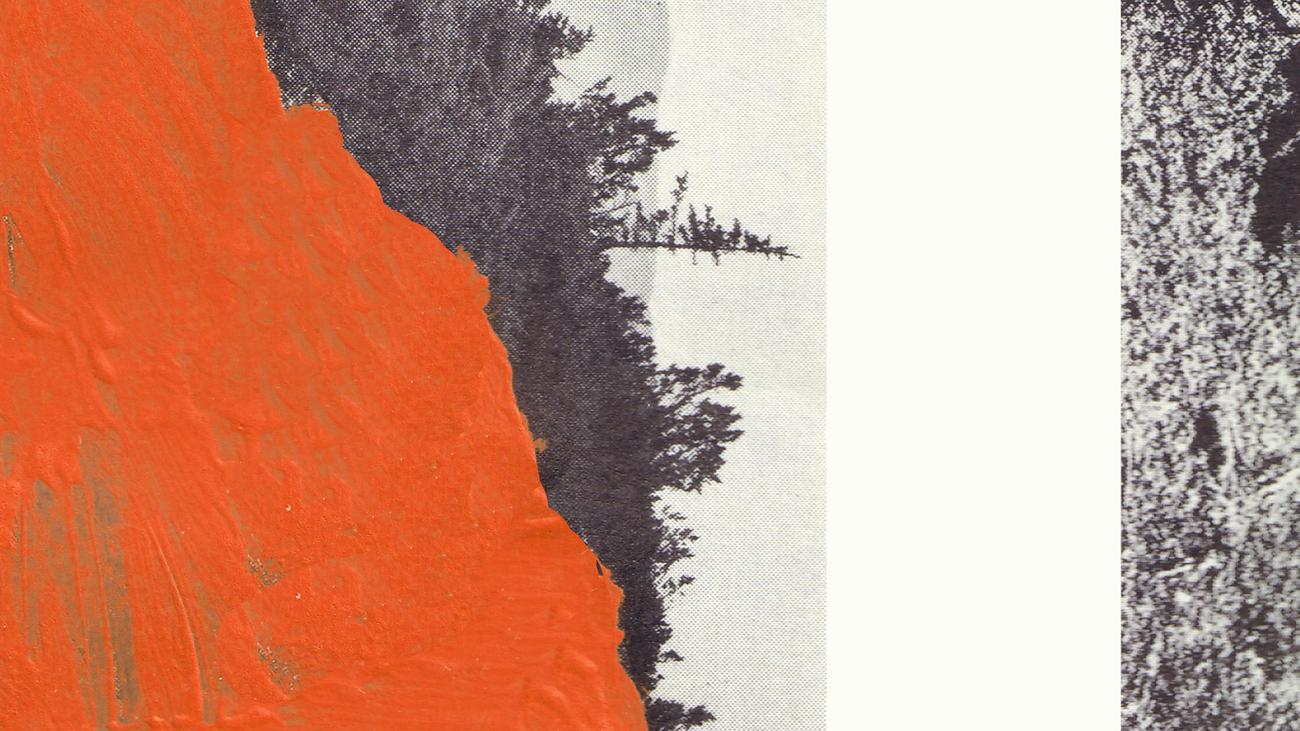







 English (US) ·
English (US) ·