Vor dreißig Jahren war sie das Monster schlechthin, und das sich seiner Todesverliebtheit stets bewusste Wien war außer sich vor Erregung. Monatelang befeuerte der Fall der „Schwarze Witwe“ titulierten Elfriede Blauensteiner den heimischen Boulevard, aber auch internationale Medien – zu verlockend ist und bleibt die serienweise männermordende Frau als eine Ausnahmeerscheinung der Kriminalgeschichte.
Verurteilt wurde Blauensteiner am Ende in zwei Prozessen für drei Morde, mehr konnten ihr nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, begangen hat sie sehr wahrscheinlich einige mehr. Im Gefängnis hat sie dann ihr Geständnis ohnehin widerrufen. Ihre Methode: Giftmord mit Medikamenten, ganz klassisch, die sie ihren überwiegend männlichen Opfern als Pulver in Speisen und Getränke rührte.
Elfriede Blauensteiner vergiftete reihenweise ihre Männer
Bevorzugt verwendete sie Euglucon, ein Antidiabetikum für Zuckerkranke, „um das Ende vorzubereiten“. Die Opfer werden immer schwächer, brechen irgendwann zusammen und sterben nach Fehldiagnosen im Krankenhaus – wohin sie Blauensteiner noch rechtzeitig hatte einliefern lassen. Immer ist sie als professionelle Erbschleicherin auf deren Erspartes aus, weil sie spielsüchtig ist. Roulette ist ihre große Leidenschaft.
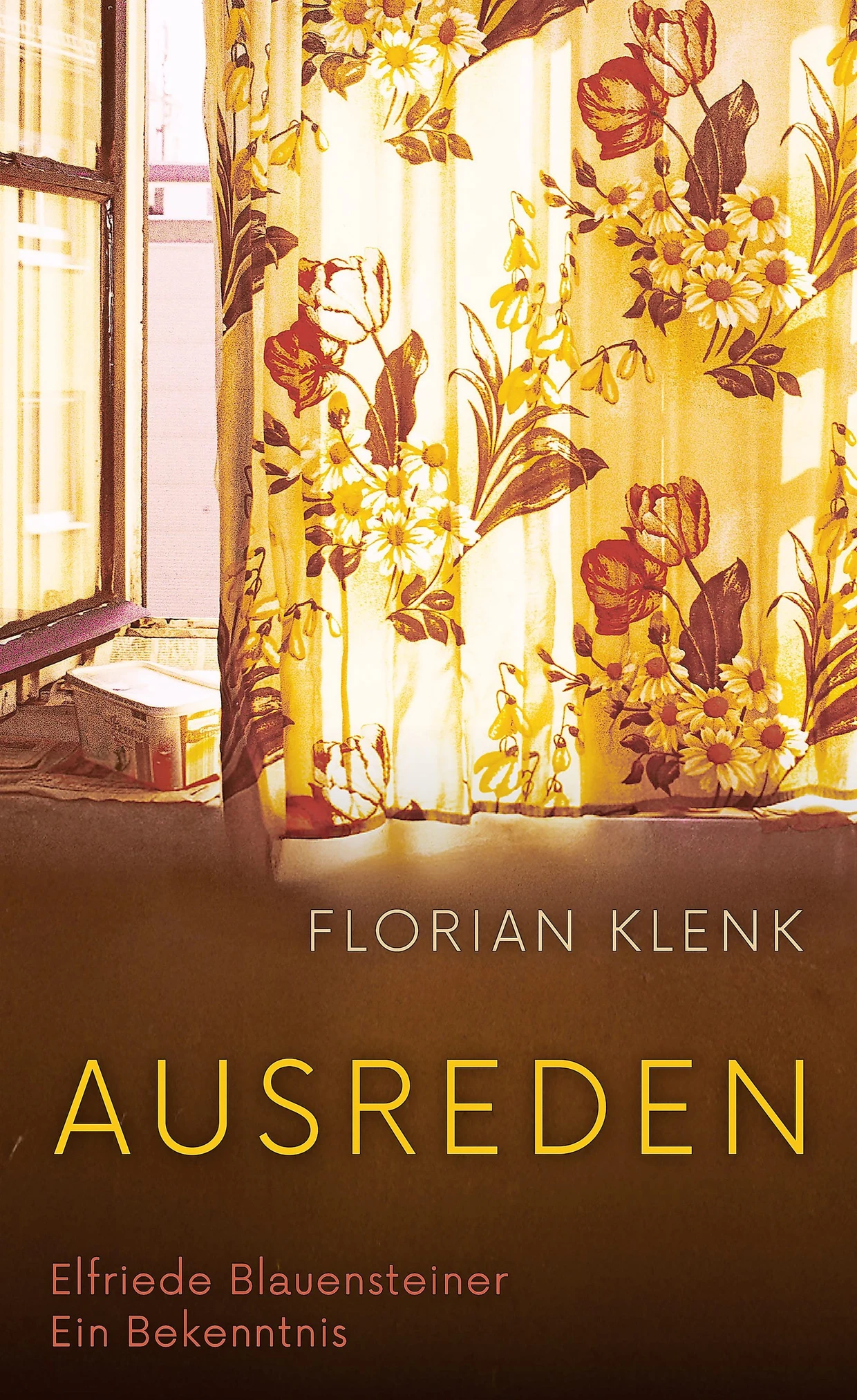 Florian Klenk: „Ausreden“. Elfriede Blauensteiner. Ein Bekenntnis.Zsolnay
Florian Klenk: „Ausreden“. Elfriede Blauensteiner. Ein Bekenntnis.ZsolnayGeboren 1931 als Elfriede Martha Zelenka in Wien, wächst sie mit einer völlig überforderten, brutalen Mutter und mehreren Geschwistern in großer Armut auf. Der Vater stirbt, als sie zwei Jahre ist, die Mutter legt sich den nächsten gewalttätigen Habenichts zu, der dann als NSDAP-Mitglied eine Wohnung in der Nazi-Siedlung am Wienerfeld ergattert. Die Mutter kassiert Waisenrente, nur deshalb hat sie Interesse, dass ihre Kinder überleben. Für Elfriede und ihre Geschwister bedeutet das eine Kindheit unter dem emotionalen Gefrierpunkt: Prügel, Hunger, Demütigungen. Elfriede sieht, wie die Nationalsozialisten die Juden schänden, sie muss miterleben, wie die Eltern ihre einjährige Schwester an einer Mandelentzündung sterben lassen – und danach ins Kino gehen.
Nach dem Krieg arbeitet sie als Haushaltshilfe, dann in einer Konditorei. Ihr erster Mann Fredi Franze ist ein Polygamist, der auch ihre Schwester schwängert, ein „fescher Mann“, der alle möglichen Frauen beglückt. 1954 kommt ihre Tochter Monika zur Welt. Nach drei Fehlgeburten schlägt Fredi der Schwangeren mit einem Topfdeckel auf den Bauch, sie verliert das Kind. So wie sie es selbst erlebt hat, so behandelt Blauensteiner auch ihre Tochter, mit einer Mischung aus Fürsorge und sadistischer Gewalt.
Akten der Gerichtspsychiaterin geben neue Einblicke
Monika ist Anfang vierzig, als sie aus der Zeitung erfährt, dass ihre Mutter eine Mörderin ist, Zielgruppe Alte, Kranke, Pflegebedürftige. Schuldbewusstsein zeigt Elfriede Blauensteiner nicht, nutzt stattdessen den Gerichtssaal 1997 und 2000 für Auftritte, einmal schwenkt sie ein Kruzifix und ruft „Ich wasche meine Hände in Unschuld“. Ihre lebenslange Haftstrafe währt nur drei Jahre, 2003 erliegt sie einem Gehirntumor.
Florian Klenk, Jurist und Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung „Falter“, fügt dem Bild des Monsters mehr als drei Jahrzehnte später eine neue Facette hinzu. Bei dem Gerichtsmediziner Christian Reiter, der seinerzeit die Opfer untersuchte, stößt Klenk auf die Akte der Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith, welche die Gespräche, die sie mit Blauensteiner 2001 in der Justizanstalt Wien-Josefstadt geführt hat, im Wortlaut verschriftlichte. Ungewöhnlich für die Zeit: Roßmanith hört zu, lässt die Verurteilte reden.
Die Protokolle bilden den hundertseitigen Kern des Buches, dann folgt eine „Nachrede“ Klenks. Der Autor hat dazu auch mit Roßmanith gesprochen, die sich an Blauensteiners sachliche Bilanz über ihre Kindheit in Armut und Gewalt erinnert. Diese sei ohne Selbstmitleid und Pose gewesen. Immerzu habe sie jemanden zum Bemuttern gesucht, die Psychiaterin nennt das „die Verschränkung von Nähren, Füttern, Pflegen – und Töten.“
Sie wollte „Sorgenmutterl“ genannt werden
Klenk hat auch mit der Tochter Blauensteiners gesprochen, die als Psychotherapeutin in Wien arbeitet. Diese berichtet auch, Blauensteiner habe darauf bestanden, von ihren Enkelinnen „Großmutter“ genannt zu werden. Von ihren Opfern ließ sie sich „Muttili“ oder „Sorgenmutterl“ nennen – das Konzept „Mutter“ in seiner pervertierten Form.
Ihr Monolog ist nach sechs namentlich genannten Opferfällen gegliedert, beginnend mit Rudolf: „Ich habe ihn im Spital / mitpflegen müssen. / Zu wenig Personal. // Nach drei Tagen / wollten sie ihn sterben lassen. / Ich sag: / ‚Sie sind Arzt, / aber nicht Gott!‘“ Die Entscheidung, das Protokoll wie ein Langgedicht zu setzen, generiert künstliche Authentizität, auch weil Blauensteiner wörtliche Rede der Opfer verwendet, zugleich schielt das Verfahren auf den Effekt. Man folgt der simplen Parataxe, neigt dazu, der Version der Täterin zu glauben.
So wird die Mörderin im Rückblick auch zu dem Opfer, das sie tatsächlich war: eine Frau, die sich aus sadistischer Gier schwache Zeitgenossen untertan machte. Florian Klenk glaubt Blauensteiners Bekenntnis ausdrücklich nicht, wertet ihre Geschichten in seinem um Aufklärung ringenden, nachdenklich stimmenden Buch als „Ausreden“. Der Titel insinuiert das bereits, aber dazu gehört eben auch die Facette, die „Schwarze Witwe“ lange nach ihrem Tod noch einmal „ausreden“ zu lassen. Elfriede Blauensteiner ist für den Autor ausdrücklich keine „Bestie“, sondern „das Produkt eines kalten Jahrhunderts“.
Florian Klenk: „Ausreden“. Elfriede Blauensteiner. Ein Bekenntnis. Zsolnay Verlag, Wien 2026. 140 S., geb., 23. – €.

 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1



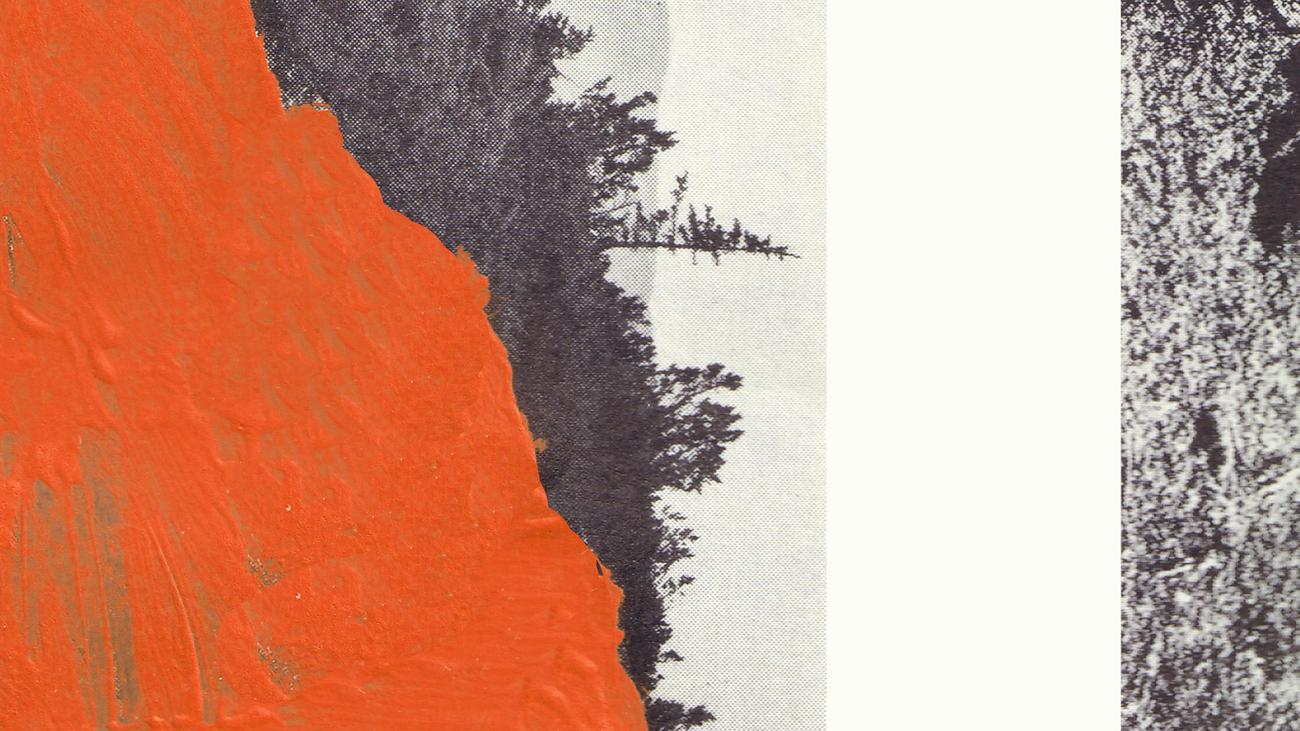







 English (US) ·
English (US) ·