In Köln sind es 798 Millionen, in Augsburg 417, in Berlin 448, in Karlsruhe 542. Aber in Stuttgart, da sind es schon zwei Milliarden. Zwei Milliarden! Die Kämmerer von Städten, in denen ein sanierungsbedürftiges Opernhaus steht, könnten alle das gleiche Klagelied von den Mehrkosten anstimmen. Die Kollegen der „Süddeutschen Zeitung“ haben unlängst verwundert festgestellt, niemand in diesem sonst so nörgeligen Land erhebe ernsthaft Einwände gegen die Projekte. Und daran die These geknüpft, dass das womöglich mit der ungebrochenen deutschen Kunstreligiosität zusammenhänge.
Die „Stuttgarter Zeitung“ ist weniger optimistisch. Angesichts der Haushaltslage hält sie es vielmehr für ausgeschlossen, dass ihre einst so reiche Stadt die kommunale Hälfte an der Milliardensumme für die Sanierung des geliebten Staatsopernhauses aufbringen kann. Die Redaktion ging daher vor zwei Wochen der Frage nach, ob der Oberbürgermeister nicht bei den zahlreichen Superreichen der Stadt vorstellig werden könnte, damit diese der öffentlichen Hand aus der Patsche helfen. Die Suche nach dem Schatz des Nibelungen dürfte aussichtsreicher sein.
Derweil muss die Show im maroden Littmann-Bau von 1912 – zentimeterdicke Risse in den Wänden, undichte Dachluken, Haustechnik aus Kaisers Zeiten – weitergehen, und zwar mindestens bis zum Jahr 2033, wenn nach den aktuellen Planungen, an die allerdings niemand mehr glaubt, die Ausweichbühne fertiggestellt sein soll. So auch am Samstag, als die achtundfünfzigste Aufführung des „Don Giovanni“ in der Inszenierung von Andrea Moses über die Bühne ging, deren Versenkung gelegentlich streikt.
Wer Repertoireaufführungsroutine erwartet hatte, sah sich aufs Angenehmste von einem Sänger- und Darstellerfest überrascht. Man weiß gar nicht, wen man mehr preisen soll: Natasha Te Rupe-Wilsons kokette Zerlina vielleicht oder doch Michael Nagl als Leporello, dessen gewaltiger, warm timbrierter Bassbariton noch im Schlossgarten zu hören gewesen sein muss? Jede und jeder hätte hier eine Lobpreisung verdient. Und mit Ausnahme der Donna Anna waren alle Rollen mit Ensemblemitgliedern besetzt, Voraussetzung für die ungemein präzise Umsetzung der anspruchsvollen Personenführung in der bald 14 Jahre alten Inszenierung von Moses, die den Stoff entschieden und sehr überzeugend ins Komödiantische wendet.
Von diesem vom Publikum gefeierten Abend, der aus einem Opernmuffel einen Melomanen hätte machen können, ging eine ambivalente Botschaft aus: Einerseits war er Werbung für das Musiktheater und die Notwendigkeit, diese Kunstgattung großzügig zu fördern. Andererseits drängte sich die Frage auf, ob ein Haus, in dem eine solche Fabelleistung möglich ist, tatsächlich für 2000 Millionen Euro saniert werden muss.
Man wüsste gern, was sich der Ministerpräsident dachte, als er dem Geschehen an diesem Abend folgte. Vermutlich ist Winfried Kretschmann ganz froh, diese Entscheidung seinem Nachfolger überlassen zu können.

 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1



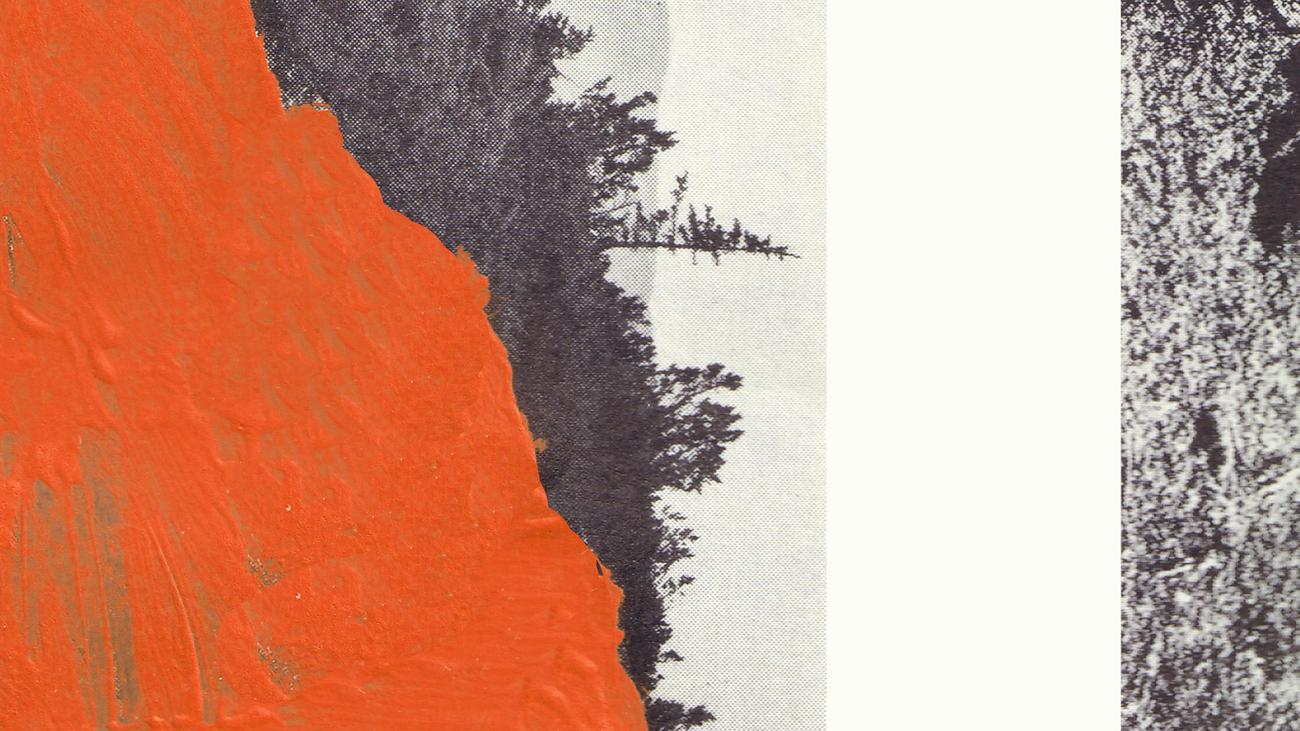







 English (US) ·
English (US) ·