Als Untertitel hätte „meine“ musikalische Geschichte des Habsburgerreichs auch gut gepasst: Philipp Thers neues Buch ist wohl sein persönlichstes, nicht nur, weil er immer wieder Schicksale seiner Vorfahren und eigene Erlebnisse einwebt. Offenherzig verrät er am Schluss, dass er angesichts der aktuellen Bedrohungen durch Rechtspopulismus und Nationalismus Zuflucht bei der Musik gesucht habe.
Vor allem aber präsentiert Ther in seinem Buch einen Kanon „habsburgischer Musik“, der überwiegend seinen eigenen Vorlieben entspricht, von Haydn bis Hába und von Beethoven bis Bartók. Darüber thront nur noch Leoš Janáček, dessen Musik sogar Thers Schreibstil beeinflusst haben soll; wie dem auch sei, gut zu lesen ist das Buch allemal.
Die Quellengrundlage ist mit etwa dreihundert herangezogenen Kompositionen deutlich breiter. Ther möchte die Geschichte des Habsburgerreiches erstmals über musikalische Werke schildern. Im Einklang mit der jüngeren Habsburg-Forschung fragt er, was das Reich so lange zusammenhalten konnte. Der ausgewiesene Osteuropahistoriker fügt den gängigen Antworten – die Monarchie, das Militär, die Macht der Tradition – mit der Musik eine weitere hinzu, die freilich aufs engste mit den anderen drei verbunden bleibt.
Die Standhaftigkeit des Reiches in den napoleonischen Kriegen
Die Umsetzung dieses originellen Forschungsdesigns bleibt allerdings recht konventionell. Ein biographischer Ansatz dominiert, der Leben und Werk von bekannten und weniger bekannten Komponisten und Komponistinnen im historischen Kontext verortet, Haydn, Mozart und Beethoven sogar je in einem eigenen Kapitel. Die zahlreichen QR-Codes zu besprochenen Werken, so interessant diese sind, schaffen nur wenig Abhilfe; auch ein „vertontes Buch“, wie Ther es nennt, bleibt zunächst einmal Lektüre.
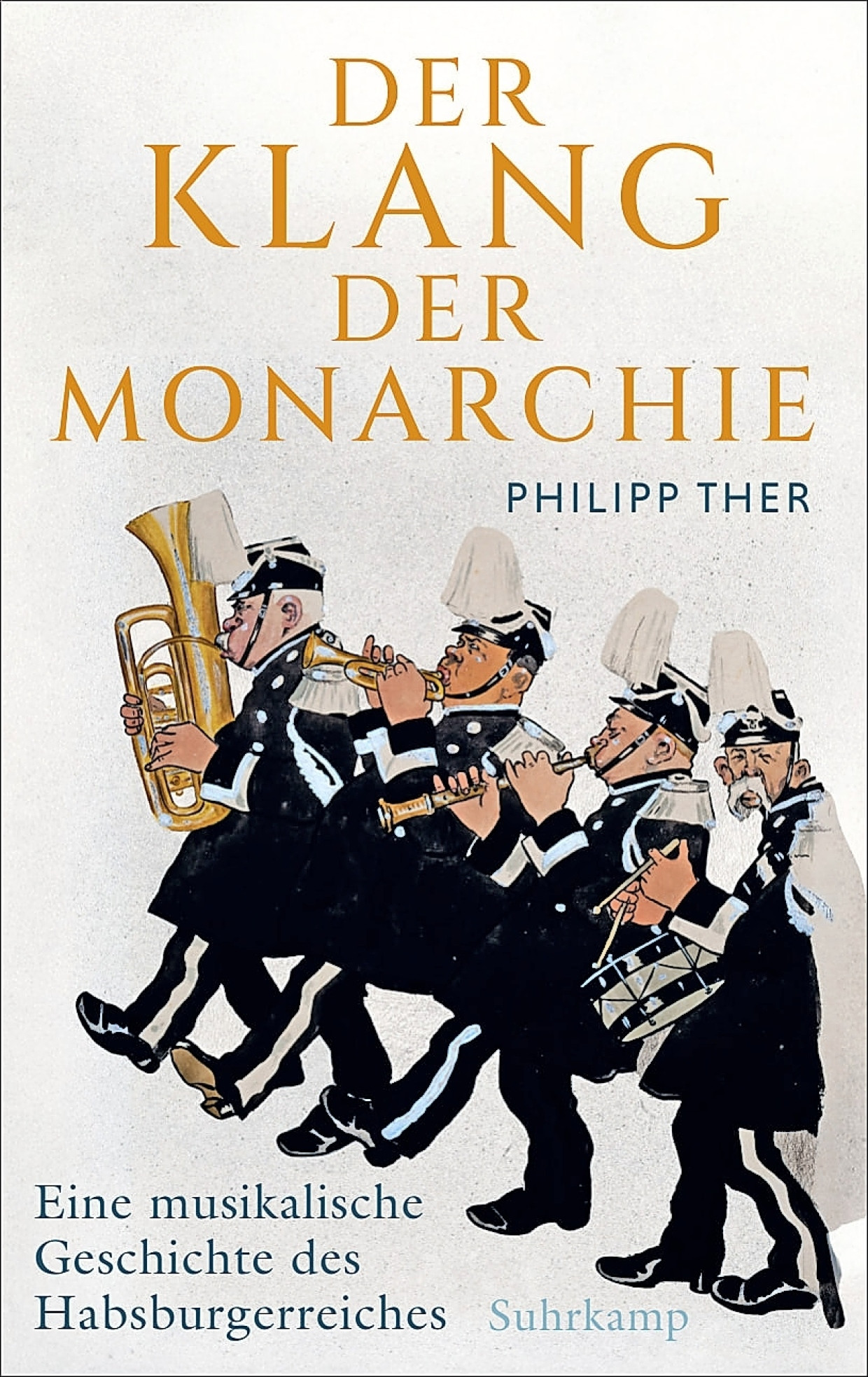 Philipp Ther: „Der Klang der Monarchie“. Eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs.Suhrkamp
Philipp Ther: „Der Klang der Monarchie“. Eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs.SuhrkampDas Gliederungsprinzip nach Musikrichtungen – Wiener Klassik, Habsburg-Pop, Operette usw. – verstärkt den Eindruck einer relativ traditionellen Musikgeschichte noch, obwohl sich Ther zu Beginn völlig zurecht gegen ahistorische musikalische Grenzziehungen und Genreklassifizierungen wendet. Kapitel zur Rolle der Militärmusik und zu den Geschlechterverhältnissen im Musikleben machen allerdings deutlich, dass es dem Autor um weit mehr als eine rein musikalische Geschichte geht.
Seine besonderen Stärken entfaltet das Buch immer dann, wenn es die Modi musikalisch bedingter gesellschaftlicher Integration aufzeigt. Beethoven mutiert so vor allem zu einem patriotischen Staats- und Kriegskomponisten. Zwischen 1813 und 1815 schrieb er mit „König Stephan“, „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“ sowie der Siegeskantate „Der Glorreiche Augenblick“ erfolgreiche Auftragswerke, die den inneren Zusammenhalt und die Standhaftigkeit des Reiches in den napoleonischen Kriegen untermauerten.
„Nach einem Ball ist noch keine Revolution ausgebrochen“
Im tristen Vormärz hingegen – Ther spricht auch von der Diktatur des Biedermeier – diente seine äußerst populäre Musik der binnengesellschaftlichen Befriedung und als Surrogat politischen Engagements.
Regression und Eskapismus bilden von da an wiederkehrende Modi gesellschaftlicher Integration: in Schuberts „Winterreise“ etwa, in der die Flucht in die Kunst besungen wird, ebenso wie im Habsburg-Pop. Lieber noch einmal walzen, bevor man im Krieg sein Leben lässt, war 1809 wie 1915 eine weit verbreitete Haltung, während in Friedenszeiten die liberale Steuerung der Tanzwut einem klaren politischen Kalkül folgte: „Nach einem Ball ist noch keine Revolution ausgebrochen“, bringt es Ther auf den Punkt. Und wenn doch einmal eine ausbrach, wie 1848, gab es immer noch die Militärmusik, die wie Strauss Senior mit seinem Radetzky-Marsch für die Mobilisierung der kaisertreuen Massen sorgte.
Nach der brutalen Niederschlagung der Revolution half die Omnipräsenz der Militärkapellen mit ihren vielen Stardirigenten, das gewalttätige Gesicht der Monarchie zu verdrängen, während Strauss Junior mit Tschechen-Polka, Slaven-Potpourri und Pesther Csárdás im Gepäck durch die Kronländer tourte. Dass er damit vormachte, was in der neuen Verfassung von 1867 als Gleichberechtigung aller Völker dekretiert wurde, scheint aber etwas weit hergeholt zu sein – ähnlich wie die Verbindung von Erzherzog Rudolfs Faible für die Schrammelmusik mit der Einführung des Wahlrechts zwanzig Jahre nach dessen Selbstmord 1889.
Vorn mit dabei im europäischen Mächtekonzert
Allgemein überzeugen die behaupteten emanzipativen Wirkungen der Habsburger Musik wie etwa ihr Beitrag zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts 1918 weniger als die strukturkonservativen oder gar destruktiven Effekte wie im Falle der Militärmusik, der Ther einen wesentlichen Beitrag zur Militarisierung der Habsburger Gesellschaft und damit zum Fiasko des Ersten Weltkriegs attestiert.
Und wie klang sie nun, die Monarchie? Sehr unterschiedlich, aber jedenfalls immer wieder recht volksnah und so, dass die habsburgische Musik in Abgrenzung zu der deutschen oder italienischen Musik auch heute noch klar zu erkennen sei, meint Ther. Zweifellos geht es dem Habsburgfreund hier um die Herstellung musikgeschichtlicher Augenhöhe, was jedoch die große musikalische Vielfalt im Reich unnötig essenzialisiert.
Ther weiß es eigentlich besser, etwa wenn er den preußisch-böhmischen Migrationshintergrund des Wiener Walzers freilegt oder die europäischen Verflechtungen der Programmmusik herausarbeitet, die auch im Habsburgerreich auf fruchtbaren Boden fiel. Solche Transfergeschichten gibt es zuhauf, sodass es sich, zumal für das Habsburgerreich, eher angeboten hätte, das Konzept nationaler Musiktraditionen weiter aufzubrechen, statt eine neue nachzuweisen.
Gleichwohl ist beeindruckend, wie sich der Autor durch 150 Jahre Musik gehört hat und wie viele Trouvaillen er aufbieten kann. Eine echte Entdeckung ist die kroatische Komponistin Dora Pejačević (1885 – 1923), die einen Großteil ihrer Karriere in München und Dresden verbrachte und mit ihren Orchesterliedern und der Sinfonie in fis-Moll genauer gewürdigt wird. Mit mehr als sechzig Werken war sie neben Marianna Martines die produktivste Komponistin im Reich. Erhellend sind darüber hinaus die wiederkehrende Diskussion verschiedener Nationalhymnen vom „Kaiserlied“ bis zu „Hey Slované“ und die eingehende Darstellung der Prager Moderne einschließlich der mikrotonalen Musik Alois Hábas.
Der schillernde Begriff des Habsburg-Pop wird schließlich vielen im Gedächtnis bleiben (im Gegensatz zum Neologismus der „atonikalen Musik“). Und Gustav Mahlers Verdikt, wonach in Wien alles fünfzig Jahre später passiert, gilt nach der Lektüre auch nicht mehr: Musikalisch war das Habsburgerreich ganz vorn mit dabei im europäischen Mächtekonzert.
Philipp Ther: „Der Klang der Monarchie“. Eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 564 S., Abb., geb., 32,– €.

 vor 2 Stunden
1
vor 2 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·