Es ist die erste gute Nachricht aus der deutschen Wirtschaft seit vielen Monaten. Um 0,4 Prozent sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Und doch bleiben die Aussichten für die deutsche Konjunktur schlecht.
Die Wirtschaftsweisen rechnen etwa in ihrem Frühjahrsgutachten, das sie am Mittwoch vorgestellt haben, mit einem Nullwachstum. Stagnation. Dabei hat Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zuletzt deutlich gemacht, dass Wachstum die oberste Priorität in ihrer Amtszeit habe. Nur mit Wachstum könne der Sozialstaat, höhere Verteidigungsausgaben und die Modernisierung der Infrastruktur finanziert werden.
Es gebe Möglichkeiten, zu einem schnellen Wachstum zu kommen, sagen Expertinnen und Experten. Fünf Vorschläge, die die Politik schon bis zum Herbst umsetzen könnte.
1. Ein Zukunftsfinanzierungsgesetz
Hanna Hottenrott, Forschungsbereichsleiterin beim Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), fordert, die Bundesregierung müsse zeitnahe das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz umsetzen. „Dabei geht es in erster Linie darum, die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Finanzstandorts Deutschland zu stärken und insbesondere die Finanzierungsoptionen für junge, innovative Unternehmen zu verbessern“, sagt Hottenrott dem Tagesspiegel.
Das erste Zukunftsfinanzierungsgesetz war Ende 2023 von der Ampel verabschiedet worden – damals auch mit Unterstützung der Unions-Fraktion. Der Entwurf eines zweiten Gesetzes liegt laut Finanzministerium bereits vor, Hottenrott drängt nun auf eine Verabschiedung: „Dies ist entscheidend dafür, dass innovative Unternehmen nicht nur in Deutschland gegründet werden, sondern auch hier bleiben.“
2. Attraktive Abschreibungsregeln
„Ein Hebel für mehr wirtschaftliches Wachstum sind private Investitionen. Erfahrungsgemäß sind attraktive Abschreibungsregeln ein wirksamer Anreiz“, sagt Tobias Hentze, der beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) den Bereich Staat, Steuern und Soziale Sicherung leitet.
Tatsächlich hat sich Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag auf eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge verständigt und will als „Investitions-Booster“ degressive Abschreibungen auf Ausrüstungsinvestitionen von 30 Prozent in den Jahren 2025, 2026 und 2027 einführen. Hentze hält solche Abschreibungen für sinnvoll. „Sie motivieren Unternehmen dazu, geplante Investitionen vorzuziehen und zu verstärken.“
3. Vergabeverfahren vereinfachen
Alexander Kriwoluzky, Abteilungsleiter Makroökonomie beim Deutschen Insitut für Wirtschaftsforschung (DIW), drängt vor allem darauf, dass die Milliarden aus dem beschlossenen Sondervermögen schnell abfließen. Dafür müsste die Politik Gesetze zum Vergabeverfahren auf den Weg bringen. „Diese müssen entschlackt werden, wenn die zusätzlichen Mittel des Sondervermögens schnell und zielgerichtet eingesetzt werden sollen. Das betrifft vor allem die kommunale Ebene“, sagt Kriwoluzky.
Er ist sich sicher, dass die staatlichen Investitionen das Wachstum ankurbeln können. „Zusätzlich könnte eine Verringerung der Auflagen in den Vergabeverfahren das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erhöhen, dass sie es mit der Verringerung der Bürokratie ernst meint“, sagt Kriwoluzky.
4. Unternehmenssteuer senken
Es war ein Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, am Ende stand ein Minimalkompromiss. Unternehmen sollen entlastet werden – allerdings erst zum Ende der Legislaturperiode ab Januar 2028. IW-Experte Hentze hält das für viel zu spät. „Es wäre sinnvoll, die Unternehmenssteuer früher als geplant zu senken, um Unternehmen zu entlasten und die Standortattraktivität Deutschlands nachhaltig zu stärken.“
Schwarz-Rot will in fünf Schritten die Körperschaftssteuer um jeweils einen Prozentpunkt pro Jahr absenken. Das setzt aber auch voraus, dass die nächste Regierung diesen Kurs ab voraussichtlich 2029 fortsetzen würde. Hentze wirbt dafür, dass diese Steuersenkung bereits bis zum Ende der Legislatur abgeschlossen ist: „Ein Unternehmenssteuersatz von 25 Prozent bis zum Ende der Legislaturperiode wäre ein ambitioniertes, aber lohnendes Ziel für die neue Bundesregierung. Denn: Mit aktuell 30 Prozent ist Deutschland im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig.“
5. Eine grundlegende Rentenreform
Neben Sofortmaßnahmen hält Hanna Hottenrott vom ZEW auch Strukturreformen für notwendig und hat dabei vor allem eine Rentenreform im Blick. „Das aktuelle Modell ist nicht zukunftsfähig und verschlingt einen zu großen Teil der jährlichen Steuereinnahmen“, argumentiert sie. Geld, das für Bildung, Forschung und damit auch Innovationsfähigkeit fehle.
Dass Union und SPD sich hier bewegen, scheint zwar eher unwahrscheinlich – im Koalitionsvertrag hat man ein stabiles Rentenniveau, keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und lediglich eine Rentenkommission beschlossen – doch Hottenrott drängt zur Eile: „Kleinere Änderungen sind keine Lösung und eine Erhöhung der Beitragssätze wäre sogar fatal, da sie die arbeitende Generation zusätzlich belasten würde.“

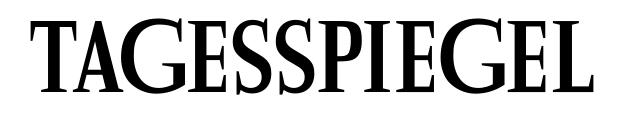 vor 7 Stunden
1
vor 7 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·