Politisch mag sich Donald Trump aus den Ukrainehilfen zurückziehen. Doch die US-Waffenlieferungen haben ihren Zenit mutmaßlich noch nicht erreicht. Der Wochenrückblick
23. Mai 2025, 18:13 Uhr

Donald Trump zieht sich aus den Gesprächen über ein Ende des Ukrainekriegs schleichend zurück. Vom Ukrainekurs des US-Präsidenten profitierte bislang vor allem Wladimir Putin. Der russische Staatschef hat allen Grund, mit den ersten Monaten der neuen Trump-Regierung zufrieden zu sein. Schließlich zeigte sich die deutlich offener gegenüber einer "Normalisierung der Beziehungen" zu Russland und sorgte für große Unruhe innerhalb der Nato.
Die Ukraine hingegen bekam von Trump bislang nicht viel mehr als ein vor allem symbolisches Ressourcenabkommen, eine öffentliche Demütigung ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und immer wieder Signale, dass ihre Zukunft die USA nicht besonders interessiere. Angesichts dessen könnte ein Rückzug Trumps aus den Gesprächen fast schon für Erleichterung in Kyjiw sorgen.
Könnte. Denn es gibt eine Frage, die noch wichtiger ist, als auf welche Seite sich die USA künftig politisch stellen. Sie lautet: Was ist mit den Waffen?
Als die US-Regierung Anfang März zuerst die Waffenlieferungen und kurz darauf auch die geheimdienstliche Unterstützung der ukrainischen Armee aussetzte, sorgte das für einen Schock. Die Aussetzung hielt zwar nur wenige Tage an. Dennoch führte sie der Ukraine vor, wie schnell ihre Planungen durchkreuzt werden können. Die Lieferpause war eine Art Kurzversion des mehr als ein halbes Jahr andauernden Stopps neuer Hilfspakete im Winter 2023/24. Damals hatten die Republikaner im Kongress – nicht zuletzt auf Betreiben Trumps – das milliardenschwere US-Hilfsprogramm blockiert. Das verschärfte den Munitionsmangel der Ukraine an der Front und half Russland bei der strategisch wichtigen Eroberung von Awdijiwka und dem Einmarsch im Norden Charkiws.
Doch die Front steht und fällt nicht mit den Launen des US-Präsidenten – zumindest nicht ausschließlich. Denn die Nachhaltigkeit der von seinem Vorgänger Joe Biden in die Wege geleiteten Waffenlieferungen wird in der öffentlichen Diskussion bislang unterschätzt. So argumentiert zumindest der Thinktank Center for Strategic & International Studies (CSIS). Wie er in zwei Berichten, erschienen im März und Mai, vorrechnete, kann die Ukraine mit einiger Zuversicht Waffenlieferungen erwarten, die mindestens bis ins Jahr 2027 und wahrscheinlich sogar darüber hinaus anhalten. Mehr als die Hälfte der zugesicherten US-Waffen ist demnach noch nicht mal auf dem Weg an die Front.
Der Grund dafür ist die administrative Struktur der militärischen Ukrainehilfen der USA. Zum Großteil laufen sie über zwei Programme (PDF): die sogenannte Presidential Drawdown Authority (PDA) und die Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Hinter den Begriffen verbergen sich zwei unterschiedliche "Lieferlinien". Vereinfacht dargestellt, handelt es sich bei der PDA um kurzfristige Waffenlieferungen aus Beständen des US-Militärs, die der Präsident nach eigenem Ermessen anordnen kann. Die USAI hingegen meint langfristige Bestellungen bei der US-Rüstungsindustrie. Hier geht es um Waffen, die zunächst produziert werden müssen. Der Gesamtwert aller bewilligten US-Lieferungen von etwa 70 Milliarden Dollar teilt sich grob zu gleichen Teilen auf die beiden Programme auf.
Dem CSIS-Bericht zufolge beträgt die Dauer zwischen Ankündigung und kompletter Auslieferung aller zugesagten Waffen beim PDA-Programm etwa acht Monate. Im Fall von USAI seien es hingegen bis zu vier Jahre. Während die meisten PDA-Lieferungen in diesem Sommer auslaufen dürften – und der US-Kongress unter Trump keine Anstalten macht, die Finanzierung für neue Programme zu beschließen –, treffen die ersten größeren USAI-Lieferungen dem CSIS zufolge erst jetzt ein. Allein in diesem Jahr kann die Ukraine dem Bericht nach mit mehr als doppelt so vielen Waffen aus den USA rechnen wie 2024 – Trump hin oder her.
Zwar könne der Präsident das PDA-Programm stoppen. Doch ein Stopp der USAI-Bestellungen wäre, argumentiert das CSIS, nicht so einfach umzusetzen. Zwar bezahlt die US-Regierung auch diese Lieferungen (und 90 Prozent dieser Ukrainehilfen bleiben somit in den USA, da das Geld an die US-Rüstungsindustrie geht). Doch aus juristischer Sicht gehören die so finanzierten Waffen ab Zeitpunkt der Bestellung der Ukraine. Um die Lieferungen zu stoppen, müsste die US-Regierung nachweisen, dass die Waffen dringend in den USA benötigt würden. Einen plötzlichen Stopp macht das weniger wahrscheinlich – doch, wie das CSIS warnt, nicht unmöglich: "Die Trump-Regierung hat (bislang) nicht gezögert, Notfallgesetze zu nutzen, um ihre politischen Ziele zu erreichen."
Angenommen, Trump täte dies: Von der Versorgung ganz abgeschnitten wären die ukrainischen Streitkräfte dadurch noch nicht. Etwa ein Drittel ihres Bedarfs produziert die Ukraine inzwischen selbst. Die verbliebenen zwei Drittel sind in etwa gleich zwischen den USA und Europa aufgeteilt. Insgesamt liefern die USA sogar weniger als die Hälfte an Waffen und Munition, die in der Ukraine eintreffen: Das Land führt die Liste der zehn größten Lieferanten zwar mit großem Vorsprung an. Es liefert aber etwas weniger als die neun nachfolgenden Staaten zusammengenommen.
Doch ausgleichen kann Europa die US-Hilfen nicht. So weist das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das die internationalen Ukrainehilfen seit Kriegsbeginn dokumentiert, darauf hin, dass die USA bei einigen Waffensystemen klar dominieren. Bei Raketenartillerie sowie den dafür bestimmten Raketen, der Munition für schwere Haubitzen und der reichweitenstarken Luftverteidigung gegen russische ballistische Raketen gibt es in Europa demnach kaum Alternativen. Lediglich bei Kampfpanzern und Artilleriesystemen stellt Europa mehr als die Hälfte der nach Stückzahl gerechneten Systeme.
Was die Situation noch komplizierter macht: Auch europäische Länder können keine von US-Firmen hergestellten Waffen an die Ukraine liefern, wenn die US-Regierung dafür nicht die Erlaubnis erteilt. So erforderte eine kürzlich erfolgte deutsche Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen sowie Raketen für Himars-Werfer eine explizite Zustimmung der USA. Projekte wie ein Einstieg des deutschen Rheinmetall-Konzerns in die Produktion von Raketenwerfern trügen also nicht zwangsläufig zu einer europäischen Autarkie bei, wenn es sich, wie in diesem Fall, um eine Zusammenarbeit mit US-Unternehmen handle.
Zwar dominiere Europa immerhin bei Lieferungen von Gefechtsfahrzeugen. Doch dabei handle es sich zu großen Teilen um veraltete Systeme, die nicht mehr produziert würden. Zumal es nicht nur um die Waffenplattformen geht, sondern auch um Munition für diese. Erwartet wird etwa, dass Russland in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Artilleriegranaten produzieren wird als die EU und die USA zusammengenommen. Die immensen Lieferungen Nordkoreas sind dabei nicht mal einkalkuliert.
Die Militärhilfen der USA beschränken sich zudem nicht auf die bloßen Panzer und Raketen. Das US-Militär verantwortet auch die Logistik der Lieferungen (wobei diese Rolle künftig der Nato zufallen könnte). Es stellt für viele der gelieferten Waffen Ersatzteile bereit und bildet ukrainische Soldaten an den Systemen aus. All das könnte Trump nach Gutdünken stoppen.
Vor allem aber bei der geheimdienstlichen Hilfe wäre eine Abkehr der USA ein schwerer Schlag. Die Ukraine würde den Zugriff auf frühe Warnungen vor russischen Raketenstarts verlieren, ihre Kommunikationssysteme würden geschwächt, die Zielaufklärung wäre deutlich verlangsamt. Angriffe auf zahlreiche russische Ziele auf der besetzten Krim-Halbinsel sowie auf russischem Gebiet sollen zu großen Teilen durch den Zugang zu US-Geheimdienstdaten gelungen sein. "Trotz dem Einfallsreichtum und Geschick der ukrainischen Soldaten können sie nicht zerstören, was sie nicht lokalisieren können", bringt das CSIS das Problem auf den Punkt.
Womöglich kann die Ukraine dieses Szenario aber abwenden. Womöglich stoppt Trump die Weitergabe von Geheimdienstdaten nicht. Oder lässt sich von der US-Rüstungsindustrie, die von den Bestellungen für die Ukraine profitiert, zu weiteren Hilfen überzeugen. Womöglich nimmt er das ukrainische Angebot an, neue Waffenpakete an das Land zu verkaufen (mit europäischer Finanzierung). Doch das ist eben ziemlich viel "womöglich".
Ein Lieferstopp hätte nicht nur militärische Effekte. Sondern hätte auch Folgen auf politischer Ebene, warnt das CSIS. Zwar geht das Institut nicht davon aus, dass die ukrainische Truppenmoral dadurch komplett gebrochen wäre oder dass Europa dem US-Beispiel folgen und seine Hilfen reduzieren würde. Doch die Partner Russlands – allen voran der Iran und Nordkorea – könnten dadurch zum Schluss gelangen, sich der Siegerseite angeschlossen zu haben und ihre Lieferungen an das russische Militär weiter erhöhen.
Und Putin selbst? Der russische Präsident verweigert sich nicht umsonst einem Waffenstillstand. Der Abnutzungskrieg, den er spätestens seit Ende 2022 in der Ukraine führt, ist weniger auf die Eroberung von Gebiet ausgerichtet als darauf, das Land materiell und personell auszubluten. Das funktioniert nur, solange die Kämpfe weiterlaufen und Putin davon ausgeht, dass die Ukraine ihre Verluste schlechter verkraftet als er die russischen. Ein Lieferstopp der USA würde diese Kalkulation wohl kaum zugunsten einer Waffenruhe verändern.
Falls es zu diesem Lieferstopp komme, schreibt das CSIS, würden die europäischen Lieferungen und die Waffenproduktion in der Ukraine wohl ausreichen, um die Armee des Landes "auf dem Schlachtfeld zu halten" – jedoch mit "schwindenden Fähigkeiten" und graduell schlechteren Aussichten. Auf Dauer würden die Folgen schwerwiegend sein: "Russland wird immer mehr und mehr Gebiet erobern; ab einem gewissen Punkt werden die ukrainischen Verteidigungslinien durchbrochen." Kurz: Eine Niederlage der Ukraine ist noch abwendbar. Ein noch sehr lange anhaltender Krieg aber vermutlich nicht.
 © Andre Alves/Anadolu/Getty Images
© Andre Alves/Anadolu/Getty Images
1.185 Tage seit Beginn der russischen Invasion
Die wichtigsten Meldungen: Ein Mord, viele Drohnen, Gefangenenaustausch
- Andrij Portnow, ein Ex-Berater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, wurde in Madrid von Unbekannten erschossen. Portnow galt als russlandtreu und soll für die Verfolgung von Maidan-Aktivisten mitverantwortlich gewesen sein. Die spanische Polizei schließt ein politisches Motiv beim Mord an Portnow nicht aus, hält aber Verbindungen zum organisierten Verbrechen für wahrscheinlicher.
- Am Sonntag ist Kyjiw zum Hauptziel der größten russischen Drohnenattacke seit Kriegsbeginn geworden. Von 273 Drohnen hat die Ukraine nach eigenen Angaben 216 abwehren können. Am Mittwoch und Donnerstag richteten sich ihrerseits ukrainische Drohnenangriffe gegen Moskau. Russland meldete an den beiden Tagen den angeblichen Abschuss von mehr als 600 Drohnen über mehreren Regionen, davon 105 über der Region Moskau. Die Angriffe unterbrachen mehrfach den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt.
- Die Ukraine und Russland haben jeweils 390 Kriegsgefangene ausgetauscht. Es ist nach Angaben beider Seiten der erste Teil des vergangene Woche in Istanbul vereinbarten Austauschs von jeweils 1.000 Personen. Dem ukrainischen Präsidentenbüro zufolge befinden sich unter den freigelassenen Ukrainern auch Menschen, die seit 2022 in Gefangenschaft waren. Demnach sind weitere Austausche am Samstag und Sonntag geplant.
Die Zitate: Eine europäische Situation, eine Sache der Sowjetunion
Nach seinem Telefonat mit Wladimir Putin hat sich Trump noch mehr als zuvor von der US-Beteiligung an einem Gesprächsprozess zwischen den Kriegsparteien abgesetzt. "Große Egos" seien involviert in dem Krieg, der "nicht meiner" sei, sagte Trump am Montag vor Reportern im Weißen Haus – und machte deutlich, dass die USA seiner Meinung nach zu tief in dem Krieg verstrickt seien:
Während die Regierung von Joe Biden die USA weiter in der Verantwortung für die Sicherheit in Europa sah, muss Trump nun von den europäischen Ländern – und der Ukraine – mühsam davon überzeugt werden. Für die Ukraine ist das eine besonders drängende Frage, für die europäischen Nato-Länder im Hinblick auf die Bündnistreue der USA aber ebenso wichtig. Doch Trump nähert sich einer Haltung an, von der ausgerechnet Russland am stärksten profitiert: Die Wahrnehmung des Kriegs als Problem allein zwischen den beiden Kriegsparteien.
Noch radikaler – und auf gewisse Weise irritierender – ist das Framing, das Anton Kobjakow, ein Berater Putins, zuletzt ins Spiel brachte. Er bezeichnete den Krieg nicht nur als Angelegenheit Russlands, sondern als innere Angelegenheit der Sowjetunion. Diese, sagte er am Mittwoch auf einer Juristenkonferenz in St. Petersburg, sei auf rechtlich unzulässige Weise aufgelöst worden, da die Auflösung der UdSSR nicht von einer Versammlung von Volksdeputierten beschlossen worden sei:
Kobjakow selbst ist weder Völkerrechtler noch Jurist. Eine von der russischen Exilzeitung Nowaja Gaseta Europe befragte Rechtsexpertin wies seine Argumentation als staatsrechtlich falsch zurück. Doch den Anspruch eines echten Arguments dürften seine Behauptungen ohnehin nicht haben. Eher entsprechen sie dem Narrativ einer angeblich illegitimen Unabhängigkeit der Ukraine.
Der Ausblick: Schafft der US-Senat Fakten?
Die EU hat ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, das 18. ist nach EU-Angaben unterwegs – doch die US-Regierung machte ihre Drohung, ihrerseits Sanktionen zu verschärfen, bislang nicht wahr. Somit blieb bislang weitgehend folgenlos, dass Putin die Forderung Trumps nach einer sofortigen 30-tägigen Waffenruhe ablehnte.
Dabei steht im US-Senat ein Gesetzesentwurf für zumindest theoretisch deutlich verschärfte Sanktionen längst bereit. Der republikanische Senator Lindsey Graham und der Demokrat Richard Blumenthal schlagen darin unter anderem harte Sekundärsanktionen vor: Ein Zollaufschlag von bis zu 500 Prozent für Staaten, die russisches Öl und Gas kaufen und dadurch zur Finanzierung des Kriegs beitragen. Ob die Umsetzung der Maßnahme überhaupt realistisch ist, erscheint fragwürdig: Die Maßnahme würde vor allem auf China und Indien zielen, also wichtige Handelspartner der USA, die wohl kaum dauerhaft mit derartigen Zöllen belegt werden könnten.
Die Autoren des Entwurfs, die nach eigenen Angaben die Unterstützung von 79 weiteren Senatoren haben, teilten am Mittwoch dennoch mit, im Zweifelsfall auch ohne Anweisung aus dem Weißen Haus aktiv zu werden. Falls Russland "binnen Tagen" weiterhin keine realistischen Friedensvorschläge machen werde, würden sie den Entwurf vorlegen, drohten sie.
Was das Statement der beiden Senatoren unterschlägt: Es ist fraglich, ob John Thune, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, die Sanktionen ohne Zustimmung Trumps zur Abstimmung stellen wird. Thune gewähren zu lassen, wäre aber theoretisch eine Möglichkeit für den US-Präsidenten, auf Putins Hinhaltetaktik zu reagieren, ohne selbst den Ton ihm gegenüber verschärfen zu müssen.
Den Rückblick auf die vergangene Woche finden Sie hier.
Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im russischen Krieg gegen die Ukraine in unserem Liveblog.

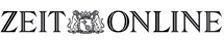 vor 8 Stunden
1
vor 8 Stunden
1


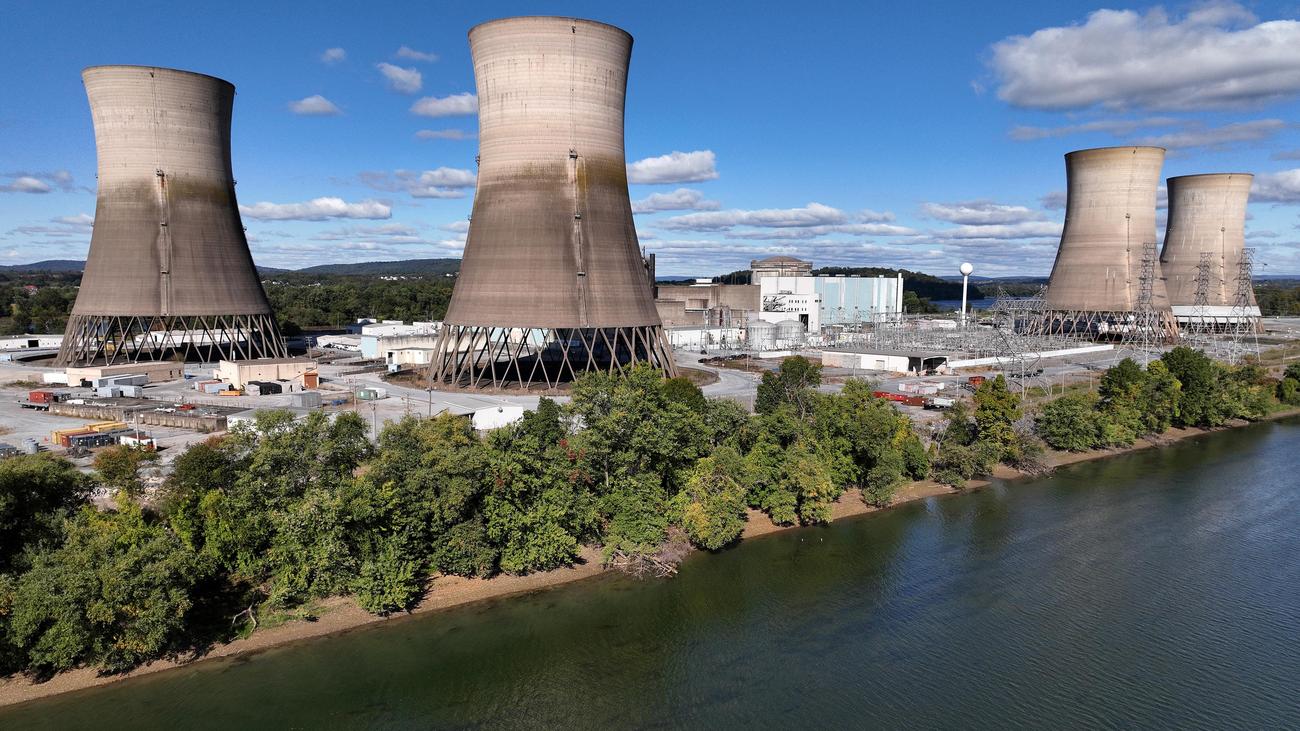








 English (US) ·
English (US) ·