Am Erinnern zum Kriegsende vor 80 Jahren wird gleich aus zwei Richtungen politisch gezerrt. Eine adressiert der Bundespräsident im Bundestag klar. Die andere nur vage.
8. Mai 2025, 17:28 Uhr

Schon eine Stunde bevor es losgeht, als die Sitzreihen der übrigen Fraktionen noch ganz leer sind, sitzen schon zwei Handvoll AfD-Abgeordnete auf ihren Plätzen. Und das, obwohl ihrer Partei der Name dieses Tages, Tag der Befreiung, in Berlin heute sogar ein Feiertag, so gar nicht passt. Diese Gedenkstunde im Bundestag zum 8. Mai ist die erste, an der Vertreter der AfD teilnehmen. Sie findet nur zu runden Jahrestagen statt. Die letzte, 2020, verlief unter strengen Hygienevorgaben mit gerade einmal fünf Teilnehmenden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht. Kranzniederlegung, Innehalten und zwei Meter Abstand.
"Vielleicht versetzt uns dieses Alleinsein für einen kurzen Moment noch einmal zurück an jenen 8. Mai 1945", sagte Steinmeier an diesem Tag. "Damals waren die Deutschen tatsächlich allein. Wir hatten uns die ganze Welt zum Feind gemacht."
In diesem Jahr ist die Gedenkstunde wieder im Parlament möglich, mit zahlreichen Gästen, auch aus dem Ausland, die die Besucherränge füllen. Dafür ist das Erinnern gleich mit mehreren politischen Herausforderungen konfrontiert.
Da ist die AfD, die größte Oppositionspartei, die der Bundesverfassungsschutz erst kürzlich als gesichert rechtsextrem einstufte, und die diesen Tag nicht als Befreiung verstanden wissen will, es sogar als Geschichtsklitterung bezeichnet, nicht auch an das Leid der deutschen Bevölkerung zu erinnern.
Und da ist der Krieg in der Ukraine, mit einem Aggressor, dessen Soldaten einst die Naziherrschaft mit beendeten.
Steinmeier spricht von "Geschichtslügen des Kreml"
Während Wladimir Putin und Donald Trump noch uneins darüber sind, wessen Land den bedeutenderen Beitrag zum Ende des Zweiten Weltkriegs geleistet hat, war eine Entscheidung des Bundestags schnell klar: Russische und belarussische Diplomaten sind von der Gedenkstunde im Parlament ausgeschlossen. Damit folgte man einer Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Die Befürchtung: Russland könnte diese Veranstaltungen "instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen".
Putin und andere Vertreter Russlands warfen Deutschland vor, wer Russland vom Gedenken ausschließe, rede den Anteil der Roten Armee am Sieg über Nazideutschland klein. Dem widersprachen die beiden Redner zum Gedenken im Bundestag, Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Sie hoben dabei auch hervor, was in Putins Version oft untergeht: In Deutschland hätten viele Soldaten der Roten Armee vor 80 Jahren die Namen ihrer Heimatorte an Wände geschrieben. In kyrillischen Buchstaben hätte dort zwar auch Leningrad oder Kursk gestanden. Aber eben auch Jerewan, Baku, Kyjiw und Donbass. Die Rotarmisten kamen aus vielen verschiedenen Republiken der Sowjetunion. Auch aus der Ukraine, die sich Russland heute wieder einverleiben will.
"Die Rote Armee hat Auschwitz befreit", sagte Steinmeier. All das vergesse Deutschland nicht. "Aber gerade deshalb treten wir den heutigen Geschichtslügen des Kremls entschieden entgegen."
Auch wenn dies bei den morgigen Gedenkveranstaltungen in Russland zum Kriegsende wieder behauptet werden sollte: "Putins Angriffskrieg, sein Feldzug gegen ein freies, demokratisches Land, hat nichts gemein mit dem Kampf gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft im Zweiten Weltkrieg", sagte Steinmeier. Nur vereinzelt und kurz klatschen hier Abgeordnete der AfD, die beiden Parteivorsitzenden gar nicht, während der Rest des Hauses ausgiebig applaudierte.
Steinmeier nutzte damit seine Rede auch für ein klares Bekenntnis, dass Deutschland die Ukraine weiterhin unterstützen müsse. "Ließen wir die Ukraine schutz- und wehrlos zurück, hieße das, die Lehren des 8. Mai preiszugeben."
An einer Stelle empören sich Teile der AfD-Fraktion
Während Steinmeier Putins Umdeutung der Geschichte klar benannte, blieb er vergleichsweise vage, als er von "extremistischen Kräften" sprach, die in Deutschland erstarken würden. Den Namen der AfD nannte er dabei nicht, nur einmal gelang es Steinmeier überhaupt, eine Reaktion der größtenteils eher teilnahmslos wirkenden Abgeordneten hervorzurufen. Empörtes Gemurmel war zu vernehmen, als er von einem "doppelten Epochenbruch" in Bezug auf den russischen Angriffskrieg und den "Wertebruch Amerikas" unter Trump sprach.
Über die Frage, ob nun der 8. Mai ein Tag der Befreiung war, wie es die AfD infrage stellt, wollte Steinmeier nicht diskutieren. Die Antwort sei längst gegeben und sie bleibe gültig: Ja. Stattdessen müsse man sich fragen: "Wie können wir frei bleiben?"
Es ist die wohl deutlichste indirekte Ansprache der AfD von Steinmeier in seiner Rede, als er sich über die Hartnäckigkeit wundert, mit der manche in diesem Haus, dem Bundestag, einen Schlussstrich unter die Geschichte und die deutsche Verantwortung forderten. Gerade diese Erfahrungen rüsteten die Deutschen doch für die Herausforderungen dieser Zeit. Sie wüssten schließlich, wohin Abschottung, Nationalismus und die Verachtung demokratischer Institutionen führen.
Und doch trifft Steinmeiers Beobachtung nicht nur auf manchen Abgeordneten des Bundestags zu, sondern auf viele Menschen in Deutschland. Das zeigten kürzlich die Ergebnisse einer Studie zur deutschen Erinnerungskultur. Demnach wünscht sich erstmals eine relative Mehrheit der Bevölkerung einen erinnerungskulturellen "Schlussstrich" unter die deutsche NS-Vergangenheit.

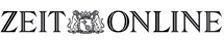 vor 6 Stunden
1
vor 6 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·