Dieser Artikel gehört zum Angebot von SPIEGEL+. Sie können ihn auch ohne Abonnement lesen, weil er Ihnen geschenkt wurde.
Wenn Leandra Flury zum Training fährt, stinkt es in ihrem Auto. Sie lagert dort ihre Fußballschuhe.
Die 26-Jährige ist Profifußballerin in der Schweizer Super League (AWSL). In erster Linie arbeitet Flury jedoch in einem 80-Prozent-Job. Danach ist sie Vollprofi.
Und zu diesem Dasein gehört es eben, dass sie immer ihre Fußballschuhe im Auto hat, nur so schafft sie es von der Arbeit direkt zum Training. »Wenn dann die Trainingszeiten noch so gesetzt werden, dass wir arbeitstätigen Spielerinnen gar nicht mehr zu den Trainings gehen können, dann glaube ich, versagt das System«, sagt Flury.
So wie Flury geht es der Mehrheit der Spielerinnen in der Schweiz.
Am Abend startet dort die Europameisterschaft. Die Schweizer Nationalmannschaft hat mit dem Heimvorteil Chancen auf ein Weiterkommen. Im ersten Spiel (21 Uhr, TV: ARD) trifft das Team direkt auf Gruppenfavorit Norwegen, gegen Finnland und Island im späteren Verlauf sind Erfolge denkbar. Trainerin ist die erfahrene Pia Sundhage.
Unabhängig von der sportlichen Entwicklung ist das Großereignis geprägt von vielen guten Nachrichten: Die Preisgelder sind so hoch wie noch nie, fast alle Spiele sind ausverkauft – der Hype, der bei der letzten EM 2022 in England entstanden ist, hat einiges im Sport und für die Profispielerinnen verändert.

Grasshopper-Spielerin Flury: »Dann versagt das System«
Foto:Daniela Porcelli / Just Pictures / IMAGO
In der Schweiz lässt die komplette Professionalisierung des Fußballs jedoch weiterhin auf sich warten.
Wer sich vor Ort in der Schweiz umhört, bekommt immer wieder als Antwort, es handele sich um ein Strukturproblem. Öffentlich äußern möchten sich die Wenigsten.
Der SPIEGEL hat deshalb den zehn Erstligavereinen einen Fragebogen zur aktuellen Situation geschickt. Fünf Vereine haben geantwortet. Die Medienabteilung des FC Basel hat Anfragen mit der Begründung, »keine Kapazitäten für so einen ausführlichen Fragebogen zu haben« abgelehnt. Die restlichen Vereine haben sich nicht zurückgemeldet.
105 Spielerinnen haben einen Nicht-Amateurinnen-Vertrag
Als professionell gilt es schon, wenn Spielerinnen nach den Spielen eine Mahlzeit bereitgestellt bekommen, die Trainingswäsche gewaschen wird oder sie Zugriff auf qualifiziertes Personal haben. Danach hören die Vorteile aber schon auf.
Von 225 Spielerinnen haben derzeit 105 einen Profivertrag. »Viel zu wenig«, sagt Marion Daube, Leiterin der Abteilung Frauenfußball beim Schweizer Fußballverband. »Es laufen noch einige unter dem Radar, aber es entwickelt sich.« Vor zwei Jahren habe die Zahl der Verträge noch bei zehn gelegen.

Luzern gegen St. Gallen in der Women's Super League
Foto:Daniela Porcelli / Just Pictures / IMAGO
In der Schweiz heißt der Profivertrag wortwörtlich »Nicht-Amateurinnen-Vertrag«. Die Verträge garantieren den Spielerinnen ein Mindestgehalt von 500 Franken. Zum Vergleich: Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz liegen für einen Single-Haushalt derzeit bei 5344 Franken.
In Deutschland ist die Anzahl der Spielerinnen mit Profivertrag offiziell nicht bekannt, aber die Bundesliga gilt als Profifußball. Allgemein gibt es wenig zuverlässige Zahlen. Laut Sportschau verdienen immerhin 27 Prozent der Spielerinnen ein Monatsgehalt zwischen 2000 und 3000 Euro, allerdings verdienen 35 Prozent der Spielerinnen auch unter 2000 Euro.
Ungleiche Verteilung in der Liga
Die genauen Gehälter der einzelnen Spielerinnen sind wie in Deutschland auch in der Schweiz nicht bekannt, aber Daube sagt: »Es können noch lange nicht alle davon leben – oder nur wenige.«
Für die 120 Liga-Spielerinnen, die als Amateurinnen gelten, gibt es in der Regel Vereinbarungen mit den Vereinen, dass immerhin Spesen oder zum Teil Spesen übernommen werden.
Klar ersichtlich ist aus der Umfrage auch: Wer weiter oben in der Tabelle mitspielt, hat mehr »Nicht-Amateurinnen« angestellt und kann seinem Team auch Morgentrainings anbieten.
Dementsprechend befinden sich die Vereine mit weniger monetären Mitteln, weniger Verträgen, weniger Trainingsmöglichkeiten weiter unten in der Tabelle.

Erstligaspiel zwischen Zürich und Basel im Februar: Aurelie Csillag auf der Sportanlage Heerenschürli
Maximilian Gärtner / SPP / Sports Press Photo / IMAGO
Der Schweizer Fußballverband sieht die Klubs in der Verantwortung, etwas an der Bezahlung und der mangelnden Infrastruktur zu tun und damit zum Wandel beizutragen. Schließlich bestimmen die Vereine, wie viel sie zahlen: »Das heißt, eine gewisse Art von Professionalisierung muss natürlich dort stattfinden. Wir können unterstützen, aber auch nur im gewissen Rahmen«, sagt Daube.
Die Klubs hingegen behaupten, derzeit würden die finanziellen Mittel noch fehlen. Sie wünschen sich mehr Unterstützung vom Verband: sowohl finanziell, aber auch durch Investitionen in die Ausbildung von Funktionärinnen und Trainerinnen.
Turnierbotschafterin fordert Änderung der Strukturen
Die Schweizer Ex-Nationalspielerin Lara Dickenmann ist Turnierbotschafterin der EM und hofft, dass das Turnier etwas verändern kann. »Ich war jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren wieder zurück in der Schweiz, und die haben mich schon ein bisschen frustriert. Muss ich ehrlich sagen«, sagt sie.
Dickenmann hat selbst als Profispielerin 18 Jahre im Ausland gespielt. Sechs Jahre davon beim VfL Wolfsburg, zu dem sie zur kommenden Saison als Nachwuchschefin zurückkehren wird. Sie sagt, in der Schweiz müssten sich die Strukturen des Schweizer Fußballverbands ändern. »Die sind so ausgelegt, dass viele Entscheidungen sehr lange dauern. Also man kann nicht so schnell neue Wege gehen.«

Turnierbotschafterin Dickenmann: Unterrepräsentierter Fußball
Foto: Vedran Galijas / Just Pictures / IMAGOZudem sei die Schweizer Verbandsstruktur in drei unterschiedliche Kammern aufgeteilt. Eine davon ist die Amateurliga-Kammer, in der der gesamte Frauenfußballbereich angegliedert ist. »Das ist natürlich sehr hinderlich für eine Professionalisierung«, sagt Dickenmann.
Eine weitere Baustelle ist laut der 39-Jährigen, dass kein Entscheidungsträger oder keine Entscheidungsträgerin aus dem Fußball der Frauen auf der höchsten Verbandsebene vertreten sind. Laut Marion Daube müssen diese Debatten erst noch im Verband geführt werden.
Dickenmann hat gemeinsam mit den ehemaligen Fußballerinnen Sarah Akanji und Sandra Betschart, der Journalistin Corine Turrini Flury und der Unternehmerin Patricia Widmer die neue Organisation »Fußball kann mehr Schweiz« gegründet. Sie wollen für die Schweiz ermöglichen, was im Ausland möglich ist.
Ähnlich wie die 2021 gegründete deutsche Schwesterversion stellt die Organisation Forderungen für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Fußball. Darunter unter anderem die Forderung einer Frauenquote von 30 Prozent in den Entscheidungsgremien. »Dort ist der Frauenfußball einfach nicht adäquat repräsentiert, und es ist niemand da, der sich dann auch für unsere Anliegen einsetzt«, sagt Dickenmann. »Und ich glaube, das ist ein zentraler Hebel, wo wir im Vergleich zu anderen Ländern auch noch hinterherhinken.«
Aus der Sicht der Vereine ist das dringlichste Problem eindeutig: Alle berichten von Platzmangel und wie dieser eine professionelle Weiterentwicklung verhindert.
Oftmals sind die Rasenplätze im jeweiligen Stadtgebiet begrenzt. Zudem müssen wegen der Arbeitszeiten der Spielerinnen die Plätze mit dem Breitensport geteilt werden. Es bleibt dann nur die Hälfte oder ein Viertel des Platzes.
Ein komplexes Problem, weil eine Verhandlung mit der zuständigen Stadt nötig ist und auch der Verband wenig tun kann. Wer Zugriff auf einen Kunstrasenplatz hat, spricht von besseren Bedingungen, aber auch dort seien Verbesserungen noch möglich.
Für alle Beteiligten, egal ob Verband, Verein oder Ex-Profi ist jedenfalls klar: Die EM kann und soll, unabhängig vom Abschneiden der Schweizer Nati, einen Aufschwung bringen. Das Potenzial ist da.

 vor 2 Tage
3
vor 2 Tage
3





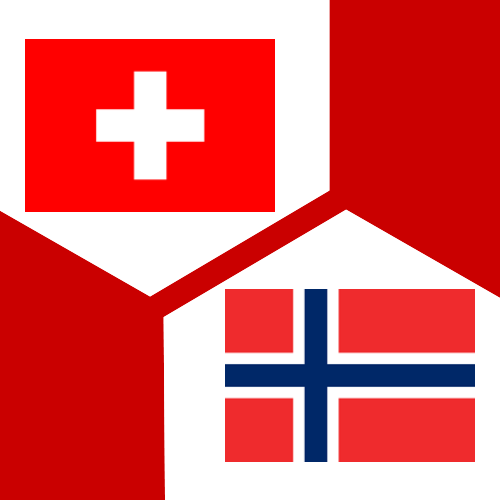





 English (US) ·
English (US) ·