„I’ve dropped my brain“: Vier Einsilber – die Übersetzung braucht noch eine Silbe mehr – im Ton banaler Alltäglichkeit, so als sei eben zufällig ein Stift oder ein Fingerhut zu Boden gefallen. Es ist eine monströse Lakonik, die uns hier ohne Vorwarnung in einen lyrischen Albtraum versetzt, in eine seelische Katastrophe ohne jeden benennbaren Anlass, und dadurch nur umso unheimlicher. Die Vergangenheitsform des Verbums stiftet eine abrupte Gegenwart, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint.
Das Gedicht entstand um 1860, während einer tiefen Lebenskrise der Autorin, über deren Ursache es viele Spekulationen, aber wenig Gewissheiten gibt, außer dass sie eine unvergleichliche poetische Produktion auslöste. In diesen Jahren, die mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs zusammenfallen, entstanden Texte von expressiver Gewalt, die im Zustand einer Death-in-life-Erfahrung gipfeln.
Ihr inneres Geschehen lässt sich am ehesten als Überwältigung des Ich durch eine fremde, letztlich horrende Macht verstehen. Es ist eine Kraft, die von der Natur ebenso ausgehen kann wie vom Menschen und die ein plötzliches Fremdwerden der vertrauten Welt bewirkt, jenes „galvanische Erschauern“, das Baudelaire Emily Dickinsons Landsmann Edgar Allan Poe nachrühmt; eine Offenbarung des Ungeahnten, bei der Schönheit und Schrecken, Leben und Tod, Unschuld und Verworfenheit den Platz tauschen.
Mitten im Sein versteint
Mitten im vermeintlich normalen Gang der Dinge, in den alltäglichen Äußerungen der Natur sieht die Dichterin Katastrophen von apokalyptischem Ausmaß hervorbrechen, die dem ausgesetzten Ich, dem Subjekt als Objekt, grausam zu Leibe rücken. Die Bildersprache ist, gerade in ihrer Versinnlichung von Wunder und Terror, immer wieder von krasser Gewaltsamkeit: Die Schönheit der Natur hat granitene Schenkel, einen Eisespanzer und Muskeln von Stahl, Vogelstimmen zerfleischen die Ohren, die Himmel schließen sich zu einem unendlichen Kerker, in dessen schwindelnde Leere sich das verzwergte Ich hinausgestoßen fühlt, und der ganze Weltraum gellt als Totenglocke.
Diese in ihrer Zeit beispiellosen Gedichte wurden in einsamer Selbstaussprache, ohne Hoffnung auf Publikation und ohne jede Rücksicht auf den herrschenden spätromantischen Geschmack zu Papier gebracht. Ihre Halbreime sind eine Absage an das lyrische Klischee. Seit ihrer Wiederentdeckung (durch die kritische Ausgabe von Thomas H. Johnson im Jahr 1951) hat der vollmundige Walt Whitman als alleiniger Torhüter der amerikanischen Moderne einige Anhänger verloren.
Die Metaphorik des Seelensturzes ist auch im vorliegenden Fall von unüberbietbarer Krassheit. Sie führt – in einer ironisch als Perfektion ausgegebenen Steigerung – von der Lähmung zur Steinwerdung des Organismus, macht in der Marmorader das eben noch aktive Nervengeflecht sichtbar und verpflanzt den berühmten toskanischen Steinbruch in die Brust der Sprecherin aus dem neuenglischen Amherst. Dass er nicht mehr atmen darf, muss der Stein fühlen.
Mythologische Bezüge, etwa zu Niobe, die den Göttern die Stirn bot und darüber zu Stein wurde, sind ausgeblendet. Weder ist hier von Schuld die Rede noch von Schönheit. Die Bildsprache der Skulptur, die auch in dem exotischen „Carrara“ und in der Rätselzeile vom „gemeißelten Ton“ anklingt, bezieht sich allein auf die Starre und Last des Statuarischen. Die Last dieses unendlich erstarrten ,Jetzt‘ wird durch den Rückblick auf das von Leben sprühende ‚Gestern‘ nicht erleichtert, im Gegenteil. Humor blitzt auf in der Kontrastierung eines vielsilbigen Latinismus mit dem heimischen Einsilber: „an aptitude for bird“ – wer außer dieser Dichterin könnte geflügelten Gesang so suggestiv ausdrücken? Die muntere Gangart der dritten Strophe beschwört gerade in ihrem Tanz der Gedankenstriche einen bodenlosen Verlust. Die Frage nach dem Verursacher bleibt in diesem strikt unmetaphysischen Text ohne Antwort.
Und doch gibt es so etwas wie Zukunft für das jäh aus dem Leben gefallene weibliche Ich. Der Stein ersehnt Auferstehung vom seelischen Tod, und sei es in unvorstellbarer zeitlicher Ferne. Er will dieses Aufzucken eines neuen sinnlichen Lebens aus eigener Kraft herbeiführen, was nicht zuletzt der Zeilensprung hinein in die fast euphorische letzte Strophe verspricht. Wie üblich bei dieser Dichterin nötigt uns eine exzentrische Zeichensetzung, genau hinzusehen und die syntaktischen Bezüge zu hinterfragen. Das Schlusswort jedenfalls, wie hypothetisch auch immer, will hoffen.
Emily Dickinson: „Gedichte“. Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Amerikanischen von Gunhild Kübler. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 2011. 560 S., br., 16,– €.
Von Werner von Koppenfels herausgegeben und übersetzt ist zuletzt erschienen: „‚Dem Shakespeare fehlts an Kunst!’ Ben Jonson über sich und die Literatur seiner Zeit“. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, Mainz 2020. 112 S., br. ,15,– €.
Redaktion Hubert Spiegel
Gedichtlesung Thomas Huber
Emily Dickinson
I’ve dropped my Brain – My Soul is numb –
The Veins that used to run
Stop palsied – ’tis Paralysis
Done perfecter on Stone
Vitality is Carved and cool.
My nerve in Marble lies –
A Breathing Woman
Yesterday – Endowed with Paradise.
Not dumb – I had a sort that moved –
A Sense that smote and stirred –
Instincts for Dance – a caper part –
An Aptitude for Bird –
Who wrought Carrara in me
And chiselled all my tune
Were it a Witchcraft – were it Death –
I’ve still a chance to strain
To Being, somewhere – Motion – Breath –
Though Centuries beyond,
And every limit a Decade –
I’ll shiver, satisfied.

 vor 13 Stunden
1
vor 13 Stunden
1







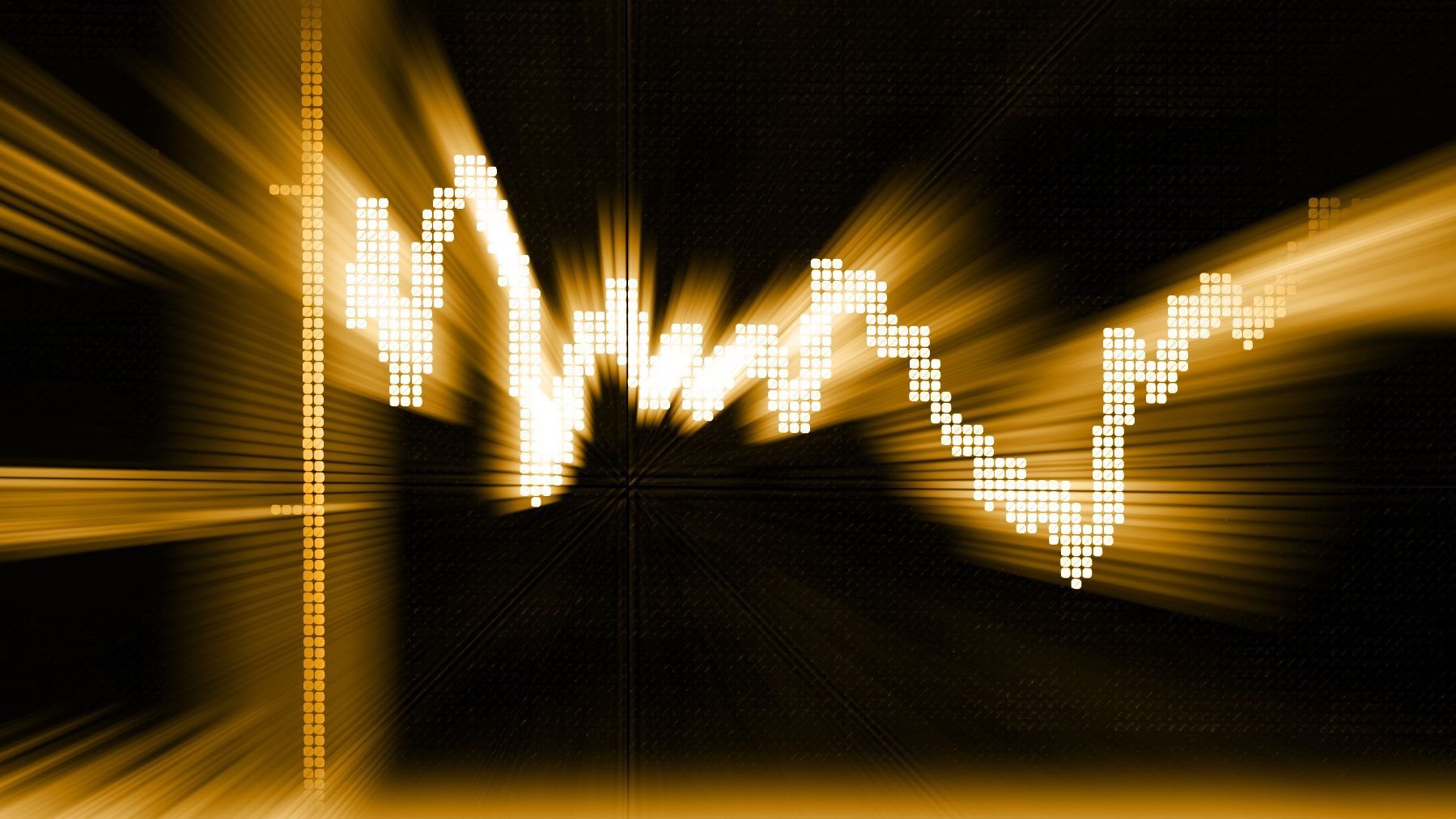



 English (US) ·
English (US) ·