Russland setzt in den besetzten Gebieten der Ukraine Tausende KI-gesteuerte Telegram-Bots ein, um gezielt prorussische Narrative zu verbreiten. Die Kommentare sind auf die lokale Bevölkerung zugeschnitten, suggerieren Stabilität und Ordnung unter russischer Kontrolle – und sollen Loyalität und Dankbarkeit gegenüber der Besatzungsmacht erzeugen. Das geht aus einer Untersuchung des Analyseunternehmens Open Minds und des Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council hervor. Zwischen Januar 2024 und April 2025 identifizierten die Forscher 3648 gefälschte Telegram-Konten, die über 316.000 Kommentare in mehr als hundert ukrainischen Kanälen veröffentlichten.
Dass Russland Trollfabriken und Botnetzwerke betreibt, ist nicht neu. Neu ist laut Studie die Qualität der Inhalte. Rund jeder dritte Kommentar war sprachlich einzigartig (unique) – erzeugt mithilfe generativer KI. Die Bots klinken sich dynamisch in Gespräche ein, reagieren auf Schlüsselwörter und passen Ton und Themensetzung an das Umfeld an. Dadurch wirken Beiträge glaubwürdiger als frühere, leicht erkennbare Propaganda-Bots.
45.000 Kommentare zielten direkt auf Selenskyj
Inhaltlich folgen die Kommentare bekannten Mustern: Russland bringe Stabilität, die Ukraine sei ein gescheiterter Staat, Präsident Selenskyj sei unfähig oder korrupt. Knapp 45.000 Kommentare zielten direkt auf Selenskyj – häufig in Form persönlicher Angriffe. Putin hingegen wurde nur rund 5500 Mal erwähnt, meist positiv.
Zugleich greifen viele Bots reale Probleme im Alltag der illegal besetzten Gebiete auf, wie Stromausfälle, Wasserknappheit oder medizinische Engpässe. Rund 10.000 Kommentare thematisierten die Wasserversorgung, über 5000 bezogen sich auf Gesundheitsthemen. Ziel sei es, die russische Verwaltung als ordnende Kraft zu inszenieren. Auffällig ist zudem, dass dieselben Accounts nicht nur politische Botschaften verbreiten, sondern auch scheinbar neutrale oder gefühlsbetonte Beiträge posten – etwa Emojis, persönliche Anekdoten oder Appelle an „Frieden und Menschlichkeit“. So soll emotionale Nähe erzeugt und der Eindruck erweckt werden, es handele sich um reale Nutzer mit komplexerer Persönlichkeit.
Auch die Quellenwahl folgt einem kalkulierten Muster. Neben russischer Staatspropaganda von RIA Nowosti oder Iswestija verlinken die Bots auch auf westliche Medien – vor allem die „New York Times“. Damit soll eine vermeintliche Ausgewogenheit simuliert werden. Deutsche oder andere europäische Medien wurden bislang nicht identifiziert, teilte Open Minds auf Anfrage der F.A.Z. mit. Telegram spielt in der Kampagne nicht zufällig eine Schlüsselrolle. In den besetzten Gebieten gehört die Plattform zu den letzten verbleibenden digitalen Informationskanälen. Die Bots agieren nicht in eigenen Kanälen, sie platzieren sich in bestehenden Communitys und Kommentarspalten.
In besetzten Gebieten bleibt Telegram ein entscheidender Kanal
„Die eigentliche Gefahr liegt nicht allein im Inhalt, sondern in der Wirkung dieser künstlich erzeugten Massenmeinung“, sagt Sviatoslav Hnizdovskyi, Gründer von Open Minds. Statt allein auf Löschung zu setzen, müsse das Informationsumfeld selbst verändert werden. „Wenn Menschen erkennen, dass ein Account 1200 Mal am Tag postet, verliert er an Glaubwürdigkeit.“ Ein wirksamer Gegenansatz bestehe darin, in denselben digitalen Räumen präsent zu sein – „mit echten Stimmen, überprüfbaren Informationen und lokalen Berichten“, so Hnizdovskyi. „Gerade in den besetzten Gebieten bleibt Telegram ein entscheidender Kanal für unabhängige Information.“
Der Zugang zu solchen Informationen ist jedoch massiv eingeschränkt. VPN-Dienste sind blockiert, Youtube steht auf der Abschussliste. Die russischen Besatzer arbeiten am Aufbau eines abgeschotteten Netzes nach dem Vorbild des „souveränen Internets“ (Runet) in Russland.
Ukrainische und internationale Akteure bemühen sich derweil um Gegenangebote. So ist das öffentliche Radio Suspilne über den Ceno-Browser in den besetzten Gebieten verfügbar. Damit werden zensierte Websites dezentral gespeichert und über alternative Kanäle verbreitet. Auch Radio Free Europe/Radio Liberty bietet mit den Formaten „Krim Realitäten“ und „Donbas Realitäten“ Inhalte für die betroffenen Regionen – auf Ukrainisch und Russisch.
Hnizdovskyi sieht im Aufbau eines vertrauenswürdigen Ökosystems innerhalb solcher Plattformen einen entscheidenden Hebel. Der Wandel könne erst einsetzen, „wenn man erkennt, dass Desinformation nicht nur eine Informationskrise ist, sondern ein tieferer Kampf um Bedeutung – in dem Narrative als Therapie dienen und Menschen nach einem Kompass suchen, um sich in der Realität zurechtzufinden“.

 vor 21 Stunden
1
vor 21 Stunden
1







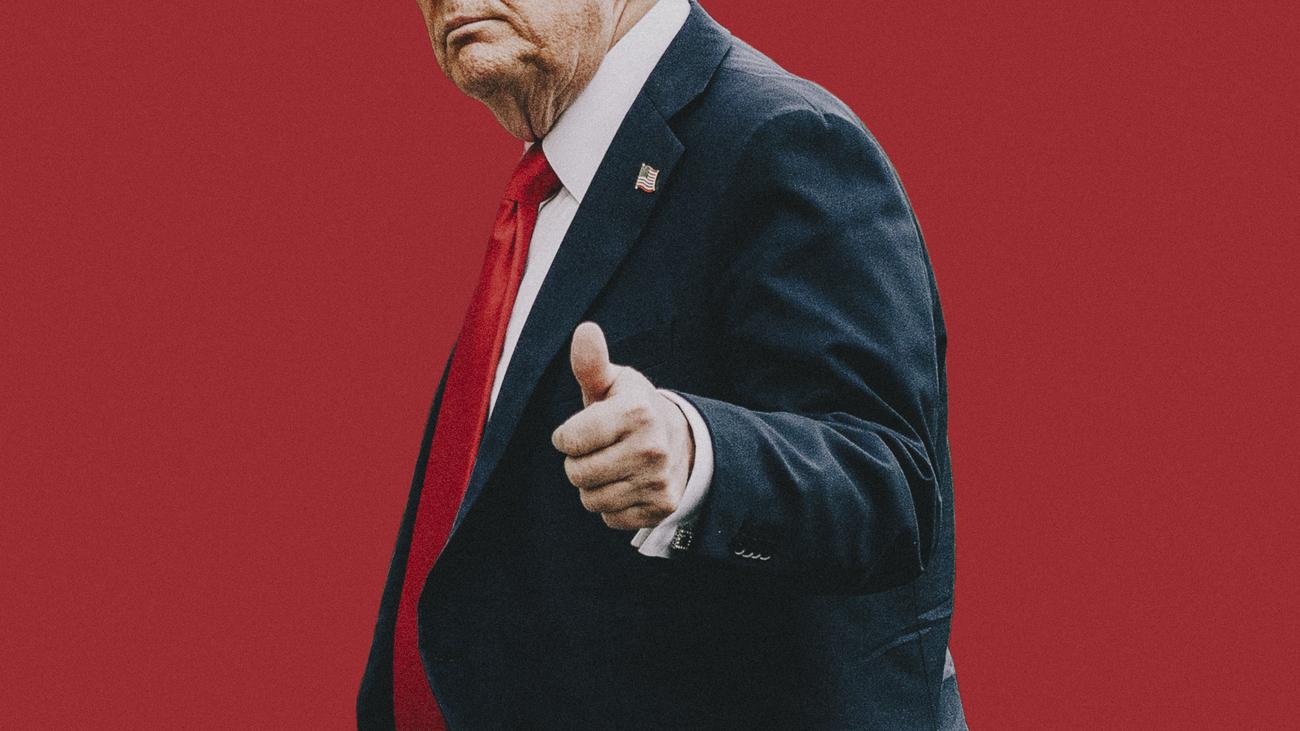


 English (US) ·
English (US) ·