Vier Warnhinweise für die intellektuelle Diskussion über Gaza und Israel

Intellektuelle haben in der Regel kein schwieriges Leben. Ihre Aufgabe besteht darin, das normale Chaos menschlicher Angelegenheiten zu beobachten und ein Urteil abzugeben, in dem sie das gesellschaftliche Kollektiv an die zentralen Werte erinnern, an die es glaubt. Die Lage einer heutigen jüdischen Intellektuellen ist jedoch weitaus schwieriger: Sie sieht sich nicht nur mit radikal widersprüchlichen Ausprägungen menschlicher Torheiten konfrontiert, sondern auch mit einander widerstreitenden Loyalitäten.
Wendet sie sich nach links, entgeht ihr nicht die spektakuläre Rückkehr des Antisemitismus aus dem Inneren des liberalen Bauchs westlicher Demokratien. Spürbar ist dies in vielen offensichtlichen und weniger offensichtlichen Formen: im erschreckenden Anstieg antisemitischer Gewalt in Westeuropa und den USA; in der weitverbreiteten öffentlichen Fixierung auf Israel und seine Handlungen; in der Dämonisierung des Zionismus als einzigartig kriminelle Ideologie; in Boykottaufrufen gegen Israelis, die an die Stigmatisierung und Ghettoisierung früherer Zeiten erinnern – alles eingehüllt in die Behauptung, Antisemitismus existiere gar nicht, sei ein manipulativer Vorwurf der Juden oder, noch besser, eine nachvollziehbare Reaktion auf Israels Taten. Nach dem 7. Oktober musste die jüdische Intellektuelle ernüchtert erkennen: Der Antisemitismus als irrationale Triebkraft des menschlichen Handelns ist keineswegs verschwunden, sondern hat sich in den demokratischen Gesellschaften verstärkt – er kommt aus den Reihen der vermeintlich demokratischsten Kräfte selbst. Er ist globaler und tiefer in die Sprache politischer Eliten eingeschrieben als je zuvor.

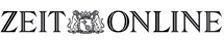 vor 21 Stunden
1
vor 21 Stunden
1










 English (US) ·
English (US) ·