Was ist eine Staatsmaschine? Da stellen wir uns einmal ganz dumm, wenn wir die Kölner Dissertation von Barbara Stollberg-Rilinger mit dem Titel „Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats“ aufschlagen, die 1986 im Verlag Duncker und Humblot erschienen ist. Und zwar absichtlich dumm, methodisch unwissend, indem wir von dem absehen, was wir über den Gegenstand schon zu wissen meinen. Wie Notker Hammerstein in seiner Rezension in der „Historischen Zeitschrift“ feststellte, hatte die Schülerin von Johannes Kunisch die „geläufige aufgeklärt-absolutistische Staatsauffassung“ als Thema gewählt. Erstaunlich nannte er es, dass es bisher keine Monographie „zu dieser in der Tat wichtigen, typischen und so bezeichnenden Staatsvorstellung“ gegeben hatte.
Die Auffassung war offenbar zu geläufig: Der Topos wanderte aus der Theorie in die Forschung, das Lieblingsbild der Staatsphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts wurde zum Gemeinplatz der späteren Geschichtsschreibung. Die nachträgliche Polemik der Romantiker gegen den Maschinenstaat Friedrichs des Großen verband sich mit der Begründung der zünftigen Geschichtswissenschaft, die sich für das Besondere oder Individuelle interessierte, also das Ungeplante und nicht Schematische; jedenfalls wurde dieser Nexus in der fachgeschichtlichen Erinnerung hergestellt.
Pionierleistung der Verwissenschaftlichung
Ideengeschichte in dieser deutschen Tradition nahm sich eine Lizenz zur Ungenauigkeit heraus, als müsste sie der Mechanisierung der eigenen Verfahren vorbeugen. Vor diesem Hintergrund stellt Barbara Stollberg-Rilingers erstes Buch eine Pionierleistung der Verwissenschaftlichung dar – und das am Gegenstand einer wissenschaftlichen Denkfigur, die illustriert, wie sich wissenschaftliches Denken zur Weltanschauung verfestigen kann. Die Autorin zeigte, wie man methodisch kontrolliert eine Geschichte von Konzepten schreiben kann, die sich nicht auf die gedankliche Innenseite des Sortierens von Lehrmeinungen beschränkt, sondern Sprachbilder und Lehrbuchdefinitionen als Denkwerkzeuge behandelt, die auch in den Dienst von Standes- oder Berufsinteressen gestellt werden.
Michael Stolleis erkannte den Rang des Buches und rühmte in seiner Besprechung in der „Politischen Vierteljahrsschrift“ den didaktischen Ertrag „einer darstellerischen Sicherheit, wie man sie bei einem Erstlingswerk nicht ohne weiteres erwartet“. Mit der achtsamen Ironie kollegialen Respekts gestattete sich der Rezensent die Andeutung, dass sich die junge Forscherin durch ihre Beherrschung des Gegenstands der Denkungsart der von ihr untersuchten Autoren in gewissem Sinne anverwandelt hatte. „Es gelingt ihr, den Variantenreichtum im Staatsdenken des 18. Jahrhunderts aus einem einzigen Punkt zu entfalten, freilich vor allem seine spezifisch rationalistische Seite.“ Dass alles auf einen Punkt ausgerichtet sein müsse, die Glückseligkeit, war der Gedanke, der die Schule des Philosophen Christian Wolff dazu bewog, die Organisation des Staates mit der Konstruktion eines Uhrwerks zu vergleichen.
Was ist eine Staatsmaschine? Das Buch enthält eine Art Gebrauchsanweisung, in unüberbietbarer Bündigkeit: „Im Bild der Staatsmaschine wird Herrschaft so gedacht, dass sie einerseits absolute Herrschaft des Herstellers über ein Material ist, dass sie sich aber andererseits durch den Selbstlauf des hergestellten Werks tendenziell erübrigt.“ Effizienz und Ökonomie als Eigenschaften einer so bestimmten Maschine stellen sich dann als eingebautes Programm der Selbstkritik des Staatsapparats dar, als das Aufgeklärte am Absolutismus. Diese an der Finanzpolitik ausgerichteten Ideale zogen der Kritik allerdings auch Grenzen, wie Stollberg-Rilinger zeigte, indem sie ein klassisches Thema der sogenannten historistischen deutschen Geschichte des politischen Denkens aufnahm, den Vergleich Deutschlands mit Westeuropa.
 Die deutsche Verfassungsgeschichte nahm einen anderen Weg: Rue Montesquieu in Nantes.Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Die deutsche Verfassungsgeschichte nahm einen anderen Weg: Rue Montesquieu in Nantes.Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0Gegen Montesquieu wandten deutsche Denker ein, dass die Gewaltenteilung die Maschine zu kompliziert mache. Für Montesquieu, wie Stollberg-Rilinger ihn liest, war das gerade der Witz seiner Lehre: Montesquieus Modell sollte politische Freiheit erhalten, eingeschlossen die Freiheit adeliger Akteure, das deutsche Gegenmodell dagegen politisches Handeln erübrigen. Hinter dem „Geist der Gesetze“ machte die Historikerin eine klassische Vorstellung von Politik aus, die von Hannah Arendt auf den Punkt gebrachte Unterscheidung zwischen dem technischen Herstellen und dem politischen Handeln.
Stolleis entdeckte im deutschen Staatsleben nach dem von Stollberg-Rilinger rekonstruierten Plan „Charakterzüge, die sich durchaus nicht verloren“ hätten: „Funktionsfähigkeit, Ordnung und Rechtlichkeit rangierten vor politischer Teilhabe.“ Die Bürger waren nicht zur Mitwirkung aufgefordert, sondern hatten sich bis auf Weiteres dumm zu stellen. In ihrer Habilitationsschrift zur ständischen Repräsentation untersuchte Stollberg-Rilinger Konzepte der Gegensteuerung bei den deutschen Standesgenossen Montesquieus.
Spezialistin für Organisation
Als Professorin in Münster erarbeitete sie in der stimulierenden Atmosphäre des Sonderforschungsbereichs „Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution“ eine Verfassungsgeschichte der durchdachten Praktiken und lebenden Bilder, die ihr viele Auszeichnungen und 2018 die Berufung zur Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin eintrug. Mit Recht sah man in ihr eine Spezialistin für Organisation im anspruchsvollsten Sinne. Wissenschafts- und Kulturbeamte dürfen sich nicht auf Automatismen rechtlicher Selbstkorrektur verlassen, wenn die politische Programmierung des Staatsapparats die Freiheit von Institutionen bedroht: Das war der Gedanke der von ihr als Rektorin maßgeblich betriebenen „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“.
 Nach ihrer preisgekrönten Biographie Maria Theresias nahm Barbara Stollberg-Rilinger das Leben Friedrich Wilhelms I., des Soldatenkönigs, in Angriff. Dessen Tabakskollegium nimmt sich wie ein Gegenmodell zum Zeremonialwesen aus, von dem aus die Historikerin das Verfassungsleben der frühneuzeitlichen Staaten erschließt.Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
Nach ihrer preisgekrönten Biographie Maria Theresias nahm Barbara Stollberg-Rilinger das Leben Friedrich Wilhelms I., des Soldatenkönigs, in Angriff. Dessen Tabakskollegium nimmt sich wie ein Gegenmodell zum Zeremonialwesen aus, von dem aus die Historikerin das Verfassungsleben der frühneuzeitlichen Staaten erschließt.Stiftung Preußische Schlösser und GärtenAuf den Seiten Geisteswissenschaften der F.A.Z. stellte Miloš Vec unlängst einen Beitrag Stollberg-Rilingers zu einem Sammelband vor, in dem sie mit ihren kühlen Sinn für begriffliche Schärfe das Konzept des Bandes kurzerhand in Zweifel zog, die Anwendung des Gegensatzes von „öffentlich“ und „privat“ auf die Fürstenhöfe der Frühen Neuzeit. Denselben Gedanken hatte sie schon 1982 in ihrer allerersten Rezension in der „Zeitschrift für Historische Forschung“ geltend gemacht, in deren Herausgeberschaft sie 2003 ihrem Lehrer Kunisch nachfolgen sollte.
Gegen eine unter Aufsicht von Reinhart Koselleck angefertigte Doktorarbeit über „Öffentlichkeit und Geheimnis“ wandte sie ein: „Im klassischen Sinne ist Verborgenheit seit jeher Merkmal des Privat-Häuslichen, und es erscheint selbstverständlich, dass ein hausväterlich wirtschaftender Fürst des 17. Jahrhunderts, der seinen Herrschaftsbereich nach Analogie der Familie versteht, auch im Innern dieses Bereiches über das Mittel des Geheimnisses verfügt, das damit noch nicht zum Mittel politischen Zusammen-Handelns wird.“
Auch hier berief sie sich für die klassische Vorstellung von Politik auf Hannah Arendt. Barbara Stollberg-Rilinger stellte wird heute siebzig Jahre alt.

 vor 13 Stunden
2
vor 13 Stunden
2







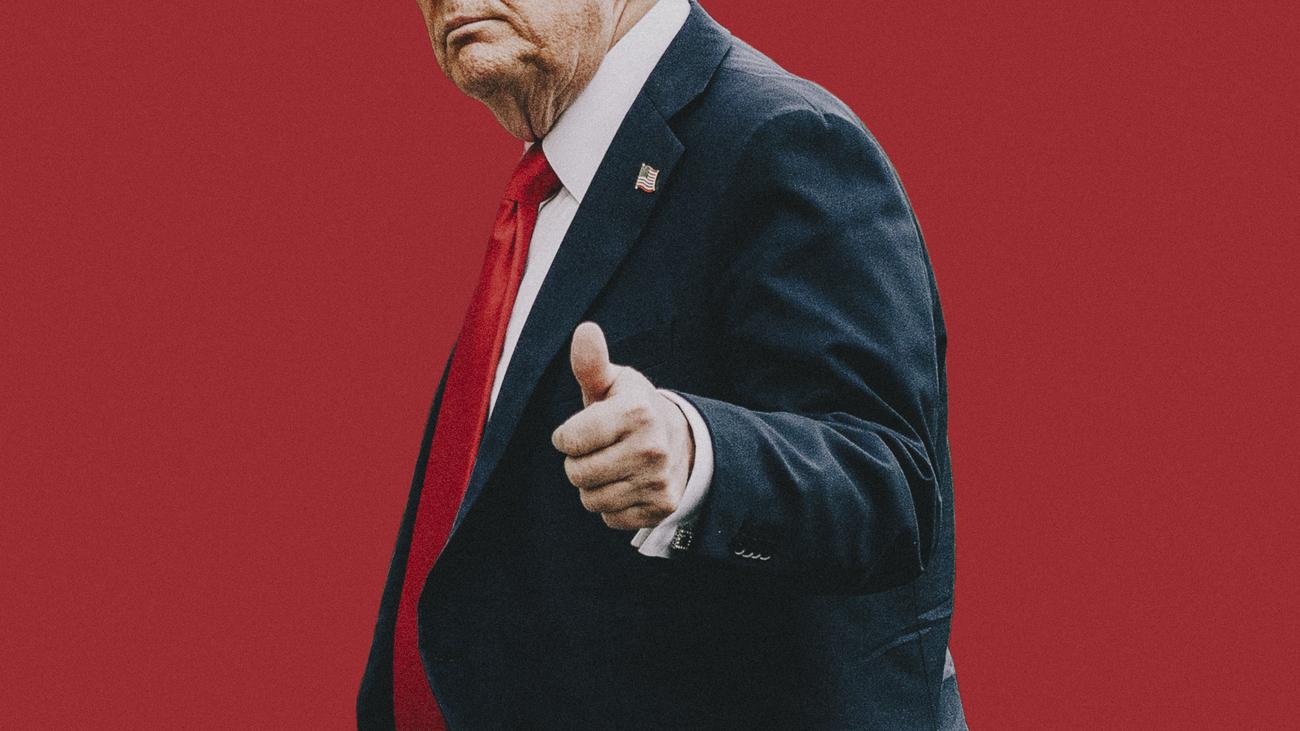


 English (US) ·
English (US) ·