Nein, das ist kein Heiligtum. Eher eine Klinik. Ein Seziersaal der Bilder. Weiße Stellwände stehen zwischen weißen Wänden, weißes Licht fällt auf schwarz-weiße und farbige Fotografien und Filmausschnitte. Ein Tempel des Kinos müsste ganz anders aussehen, mit viel mehr Schattenzonen, Dunkelheiten, geheimen Kammern, verborgenen Orten. Aber hier, in der Bundeskunsthalle, geht es ja auch nicht um das Kino, sondern um sein Kino: das Lebenswerk des Wim Wenders, der in zehn Tagen achtzig wird. Das Bonner Museum grüßt ihn mit einer Ausstellung. Und Wenders grüßt herzlich zurück.
Aber hätte man ihm, dem größten lebenden deutschen Filmregisseur, nicht doch eine Art Tempel bauen müssen? Schließlich hat Wenders in den knapp sechzig Jahren seit seinen ersten Gehversuchen mit der Kamera nicht einfach nur Filme gedreht, sondern Kultfilme. Objekte der Verehrung. Sequenzen und Filmstills, mit denen sich die Museen der Welt schmücken. So wie das Grand Palais in Paris, das Wenders vor sechs Jahren seine große Kuppelhalle für eine gewaltige Installation zur Verfügung stellte: Szenen aus „Pina“, „Der Himmel über Berlin“, „Paris, Texas“, „Der amerikanische Freund“ und zwölf weiteren Filmen, die in dem Riesensaal zusammenflossen zu einem einzigen visuellen Rausch. Das war der Altar, den man sich für sein Kino gewünscht hatte. Aber die Messe, die hier zelebriert wurde, feierte er für sich selbst. Machtvoller kann man den eigenen Kult nicht inszenieren. Es war, als hätte Wenders seine eigene Geburtstagsfeier vorweggenommen.
 Sein Engel über der Stadt: Szene aus „Der Himmel über Berlin“, 1989Wim Wenders Stiftung
Sein Engel über der Stadt: Szene aus „Der Himmel über Berlin“, 1989Wim Wenders StiftungDeshalb ist es womöglich ganz passend, dass die Bundeskunsthalle, die ihre Schau gemeinsam mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt erarbeitet hat, das Pathos der Präsentation auf Museumstemperatur herunterkühlt. Vor weißem Hintergrund sieht man die Dinge klarer. Das harte Licht ätzt die Unschärfen weg, die oberflächlichen Effekte. Was dann noch übrig bleibt, hat wirklich Bestand.
Da ist, ganz am Anfang, die Kunst. Dass Wenders Maler werden wollte, bevor er Filmemacher wurde, wusste man lang, aber die wenigsten haben seine frühen Bilder gesehen. Hier hängen sie jetzt: Zeichnungen, Aquarelle, Mischformen. Industrielandschaften, Türme und Schote, ein Blick ins Grüne, eine Kirche. Eine Ahnung von Cézanne, ein bisschen Beckmann. Und ganz viel Paul Klee. Klees Talent, das Symbolische konkret, das Konkrete symbolisch zu machen, hat Wenders immer fasziniert, nicht nur im „Angelus Novus“, den er zum Leitbild seines berühmtesten Films erkoren hat. Der „Angelus“ aber wurde sein Glücksbringer.
Und so springt die Schau aus der Kindheit direkt in den „Himmel über Berlin“. Von hier, von diesem Hauptwerk aus, ließen sich die Etappen einer beispiellosen Regisseurskarriere wie eine Landschaft überblicken: die Lehrjahre an der Münchner Filmhochschule, die Reifezeit im Neuen Deutschen Film, das Trauma von „Hammett“ und die Selbstbefreiung mit „Paris, Texas“, die Rückkehr nach Berlin und der Aufbruch nach Australien, die zweite amerikanische Phase, die abermalige Rückkehr und die Entdeckung von 3D, schließlich die parallele Arbeit an erfolglosen Spiel- und erfolgreichen Dokumentarfilmen. Und zuletzt, wie ein Sonnenuntergang, das Wunder von „Perfect Days“.
 Der Regisseur als Fotograf: „Entire Family, Las Vegas, USA“, 1983Wenders Images
Der Regisseur als Fotograf: „Entire Family, Las Vegas, USA“, 1983Wenders ImagesAber die Ausstellung sucht nicht nach chronologischen Mustern in diesem Filmemacherleben. Sie will das Phänomen Wenders aus einzelnen Facetten zusammensetzen: dem Fotografen, dem Cineasten, dem Reisenden, dem Freund von Peter Handke und Sam Shepard, dem Leser von Rilke, Paul Auster, dem Verehrer von Lou Reed, Anselm Kiefer, Sebastião Salgado und Yoji Yamamoto, dem Kunstkenner, dem Technikfreak und so fort. Sie hätte auch noch den Filmprofessor, Opernregisseur und Präsidenten der Europäischen Filmakademie erwähnen können, ohne die Menge der möglichen Mosaiksteinchen damit auch nur annähernd zu erschöpfen.
Denn Wenders ist nicht nur ein Kino-, sondern auch ein Arbeitstier. Wo andere ein Privatleben haben, hat er Projekte. Die administrative Struktur, die er 1977 mit seiner Produktionsfirma Road Movies begründete, ist längst ein Konglomerat aus Filmproduktion, Fotostudio (das er mit seiner Frau, der Fotografin Donata Wenders, betreibt) und Wim-Wenders-Stiftung. Als einziger deutscher Regisseur besitzt er die Rechte an sämtlichen Filmen, die er je gedreht hat.
Wenders kontrolliert auch die Deutung seines künstlerischen Werks
Auf diese Weise kontrolliert er nicht nur die Verwertung, sondern auch die Deutung seines Werks. Es ist kein Zufall, dass einer seiner ersten und zwei seiner letzten Filme in der Schau praktisch nicht auftauchen. Dass er die 1973 entstandene Adaption von Nathaniel Hawthornes Roman „Der Scharlachrote Buchstabe“ mit Senta Berger und Lou Castel für keinen echten Wenders-Film hält, hat ihr Schöpfer viele Male erklärt, aber auch „Every Thing Will Be Fine“ und „Grenzenlos“ werden in Bonn ausgeblendet – zwei Spielfilme von 2015 und 2017, die künstlerisch wie kommerziell gescheitert sind, aber eben dadurch das Bild eines Regisseurs vervollständigen, der sich gelegentlich in Ideen verrennt, die nicht zu ihm passen. Wenders hat sie aus seiner Bilanz gestrichen.
Die positive Seite dieser Allianz von Ausstellungsmachern und Ausstellungsgegenstand ist das Klima des Vertrauens, in das man unweigerlich hineingezogen wird. Wim Wenders selbst hat die Texte des Audioguides geschrieben und eingesprochen, und so ist der Guide zum wichtigsten Exponat in der Bundeskunsthalle geworden, schon deshalb, weil er einen ganzen Katalog jener goldenen Wenders-Sätze enthält, die sein Werk immer schon begleitet haben. „Der Blick aus den Fenstern der Kindheitstage ist das erste Kino in unserem Leben.“ – „Die Kamera ist ein Auge, das gleichzeitig nach vorne und nach hinten schauen kann.“ – „Ich mag keine Filme, die nur so tun, als ob sie irgendwo spielten.“ – „Eigentlich ist das das einzig mögliche Erzählen: der Reihe nach.“
 Allein bis ans Ende der Welt: „Paris, Texas“, 1984Wim Wenders Stiftung
Allein bis ans Ende der Welt: „Paris, Texas“, 1984Wim Wenders StiftungDas ist nicht nur gut gesagt. Es ist, wenn man es als Text zu den Fotos liest, die Wenders von Autofriedhöfen in Australien, Parkhäusern in Houston,Texas, Straßenecken in Butte, Montana und dem Niemandsland an der Berliner Mauer gemacht hat, auch gut gesehen, gut gedacht. Ein Reiz der Beschäftigung mit Wenders liegt darin, dass man beim Anschauen seiner Filme sofort merkt, dass da einer nicht einfach nur Kino machen will. Sondern dass er aus dem Kino alles herausholen möchte, was darin überhaupt möglich ist: Selbsterkenntnis, Welterkenntnis, Gefühle, Gedanken, Wesen und Schein. Und darum ist die klinische Präsentation der Fotos, Filmstills, Poster und Projektionen an den weißen Wänden vielleicht doch nicht der perfekte Schlüssel zur Welt des Wim Wenders. Denn bei ihm geht es in jedem Augenblick um viel mehr als Film. Nämlich auch um Literatur, Popmusik, Malerei, Fotografie, Moral und Metaphysik und vieles andere. Um Kunst und Leben. Und um ihn selbst.
Deshalb müsste eine Ausstellung, die den ganzen Wenders zeigen wollte, auch von dem reden, womit er sich ergänzt: der Kunst der anderen. Von Anfang an waren seine Bilder von Vorbildern geprägt – erst vom amerikanischen Western, dann von Truffaut und der Nouvelle Vague, danach wieder von den Amerikanern, Scorsese und Cassavetes, und schließlich immer stärker von Yasujirō Ozu, dem unerreichbaren Vorbild, dem er sich mit „Perfect Days“, der Geschichte eines Toilettenreinigers in Tokio und seines einsamen, bescheidenen Glücks, immerhin auf Sichtweite genähert hat. Dazu kommen die Dichter und Schriftsteller, die er gelesen und verehrt und oft auch in seinen Filmen untergebracht hat: Goethe, Rilke, Hammett, Shepard, Paul Auster und immer wieder Peter Handke, der älteste Freund.
 Straßentanz in 3D: „Pina“ (2011), Wenders’ Hommage an Pina Bauschpa/obs/ARTE / Donata Wenders
Straßentanz in 3D: „Pina“ (2011), Wenders’ Hommage an Pina Bauschpa/obs/ARTE / Donata WendersEin paar von ihnen hängen als Foto in der Bundeskunsthalle, andere stehen mit ihren Büchern in einer Handbibliothek, die in Absprache mit Wenders zusammengestellt wurde. Aber eigentlich müsste der „Wilhelm Meister“ neben den Szenenbildern aus „Falsche Bewegung“ hängen und die „Duineser Elegien“ neben dem „Himmel über Berlin“, den sie beflügelt haben.
Und dann ist da noch die Einsamkeit. „Beim Fotografieren muss ich grundsätzlich allein sein.“ Die Orte der Welt, erklärt Wenders im Audioguide, öffneten sich „nur für solche, die ihnen allein gegenüberstehen“. Aber Kino ist Teamarbeit. In jedem Wenders-Werk spürt man die Spannung zwischen der Gemeinschaft und dem Egomanen, die die Filme zerreißen müsste, wenn der Regisseur nicht Helfer gehabt hätte, die ihm ermöglichten, sich gleichzeitig von allem abzuschotten und mit allen zu verbinden. Zu ihnen gehören die Kameramänner Robby Müller und Franz Lustig, der Cutter Peter Przygodda, die Assistentin Dagmar Forelle und einige mehr.
Manche von ihnen sind schon gestorben. In Bonn wäre man ihnen gern wiederbegegnet, im Gegenschuss zu den Filmbildern. Denn das Kino der Einsamkeit ist keine einsame Angelegenheit, es braucht Komplizen. In der Bundeskunsthalle regiert der Schein der Filme: Es wirkt, als wäre Wenders mit seinen Schauspielern allein gewesen am Set. Aber selbst der Engel auf der Siegessäule war in Gesellschaft. Er saß auf einem Studiorequisit, fern vom vergoldeten Original.
Ein Brief an Willy Brandt vom Februar 1992
Im letzten Saal sitzt das Gehirn der Ausstellung: ihr Archiv. Hier kommt man dem Betriebsgeheimnis des Wenders-Universums endlich ganz nah. Es ist eine Mischung aus Gründlichkeit und Improvisation. Da sind die Kassenzettel eines Bierlokals, auf denen Wenders mit Kugelschreiber zwei Dutzend alternative Filmtitel für den „Himmel über Berlin“ notiert hat, darunter „Himmel und Erde“, „Das Himmelszelt“ und „Berlin und das Ende der Ewigkeit“. Und da ist das fehlerfrei getippte, mit Bleistift nachbearbeitete Typoskript seiner vernichtenden Rezension zu Joachim Fests Dokumentarfilm „Hitler – Eine Karriere“, nach wie vor eine der besten Filmkritiken, die je in Deutschland verfasst wurden.
Schließlich ein Brief, der den schwer kranken Altkanzler Willy Brandt im Februar 1992 erreichte: „Ich möchte in diesem Frühjahr wieder einen Film in Berlin drehen, diesmal einen weniger poetischen, dafür mehr realitätsbezogenen . . . und da denke ich nun vor allem an Sie.“ Brandt sollte in „In weiter Ferne, so nah“ einen der Prominenten spielen, denen Otto Sander als Engel Cassiel über die Schulter schaut, aber er war bereits zu hinfällig. An seine Stelle trat Michail Gorbatschow, der letzte Regent des sterbenden Sowjetreichs.
Der Legendenerzähler ist immer in Gefahr, sich selbst zur Legende zu werden. Aus Wim Wenders wird Wim le Grand oder, wie in der Bonner Ausstellung, „W.I.M.“ Folgerichtig übergeht die Bundeskunsthalle die zahlreichen Brüche in seiner Karriere mit Schweigen. Dabei waren es gerade die negativen Impulse, die sein Kino immer wieder vorangebracht haben. Die traumatischen Erfahrungen der „Hammett“-Produktion gaben ihm die Energie, den „Stand der Dinge“ und „Paris, Texas“ zu drehen. Die Enttäuschung über den Misserfolg des Großprojekts „Bis ans Ende der Welt“ und, mehr noch, die kalte Aufnahme seines zweiten Engelfilms in Deutschland trieben Wenders abermals nach Amerika, wo er mit Andie MacDowell („Am Ende der Gewalt“) und Milla Jovovich („The Million Dollar Hotel“) drehte.
Als die USA nach dem 11. September in patriotische Paranoia verfielen, kehrte er nach Europa zurück, um mit „Palermo Shooting“ seine Sammlung einsamer Männer in Lebenskrisen zu vervollständigen und in „Pina“ endlich Ernst mit der 3D-Technik zu machen. Und als die 3D-Spielfilme „Every Thing Will Be Fine“ und „Die schönen Tage von Aranjuez“ nicht funktionierten, setzte er die dokumentarische Arbeit mit seinem Papstporträt und seiner Huldigung an Anselm Kiefer fort.
Ein Leben im Zickzack, im Hin und Her. In der Bundeskunsthalle erscheint es als fertiges Puzzle, in dem ein Steinchen ins andere passt. Kann sein, dass Wim Wenders sich so sehen will, aber für seine Filme wäre es besser, wenn er weiter unfertig bliebe, neugierig, on the road. „Eigentlich denke ich, dass das mein eigentlicher Beruf ist: Reisender.“ Wie wahr. Ein wahres Bild übrigens hat die Schau dann doch gefunden: Durch ein Fenster blickt man in den Innenhof, in dem ein Engelsflügelpaar auf dem Kies liegt. Bei Wenders ist der Himmelssturz kein Ende, sondern ein Anfang. Die Welt wird neu entdeckt. Seine und unsere.

 vor 2 Tage
3
vor 2 Tage
3








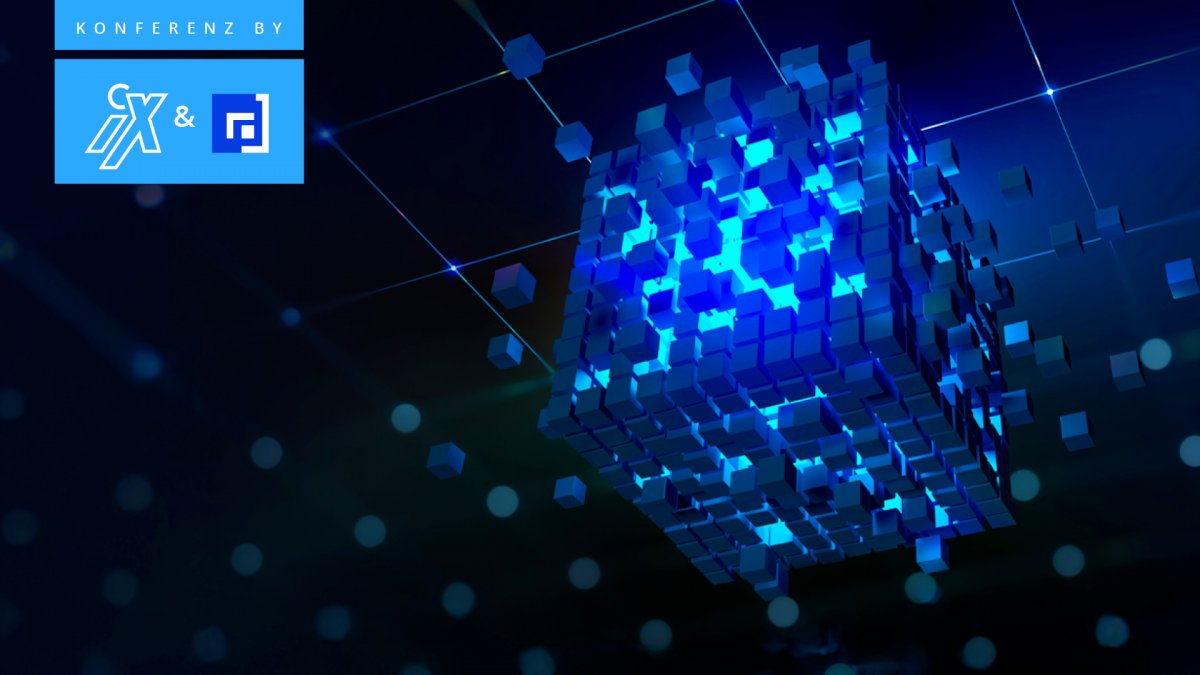


 English (US) ·
English (US) ·