In Südeuropa wehren sich die Menschen gegen ihre zunehmend autoritären Regierungen. Und was machen die Amerikaner? Sie kritisieren lieber Europas intakte Demokratien.
4. Juli 2025, 8:05 Uhr

In diesen Tagen stehen in den Metropolen Mittel- und Südosteuropas Hunderttausende Menschen auf den Straßen. In Budapest demonstrieren sie für die Rechte der LGBTQ-Bewegung, in Belgrad protestieren meist junge Menschen gegen Festnahmen und das zunehmend autoritäre Regime von Präsident Aleksandar Vučić. In Istanbul und in Izmir stehen die Leute auf gegen die epidemischen Verhaftungen von Politikern der Opposition. Alle diese Proteste haben eines gemeinsam: Die Menschen begehren auf gegen Regierungen, die sie entmündigen und im Zweifel wegsperren wollen. Wer hilft Ihnen?
Vor Kurzem erklärte
das US-Außenministerium in einem Strategiepapier, dass die USA
"zivilisatorische Bündnispartner in Europa brauchen" würden. Man hätte meinen könnten, darin würde sich das US-Außenministerium
mit den Menschen auf den Straßen in Belgrad oder Budapest solidarisieren. Leider
weit gefehlt! Stattdessen kritisierten die US-Diplomaten, die Europäer würden
Meinungsfreiheit und alternative Politikentwürfe unterdrücken. Genau das hatten
zuvor auch schon Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance moniert.
Nur leider hatten sie dabei nicht Serbien in den Senkel gestellt, nicht Ungarn,
nicht die Türkei, geschweige denn Russland oder Belarus. Die Amerikaner kritisieren
die intakten Demokratien Europas.
Ins Visier nehmen sie vor allem deutsche Behörden, wenn diese rechte oder linke Hetze, Antisemitismus und russische Propaganda im Netz versuchen einzuschränken. Oder die rumänischen Gerichte, wenn sie von russischen Bots und hybriden Kämpfern manipulierte Wahlgänge für ungültig erklären. Oder französische Gerichte, wenn sie die Rechtsnationalistin Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geld zu Fußfesseln und vorläufigem Politikverbot verurteilen. Über Gefängnisstrafen für Politiker in Istanbul, über Lagerhaft in Russland, über Repression in Budapest und Belgrad verlor das United States Department of State kein Wort.
Politische Gegner werden eingeknastet
Diese neue Konfliktlinie gefällt natürlich solchen autokratischen Herrschern, die Wegsperren als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln begreifen. Beispiel Türkei: Dort sitzt seit über 100 Tagen Ekrem İmamoğlu in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe sind lachhaft, das Motiv dahinter sehr ernst. İmamoğlu ist der überaus beliebte Bürgermeister von Istanbul und zugleich der populäre Politstar der stärksten Oppositionspartei CHP. Der alternde Herrscher Tayyip Erdoğan weiß, dass er in einer fairen, freien Wahl gegen İmamoğlu wahrscheinlich verlieren würde. Also hat er sich aufs Einknasten verlegt.
Dieselbe Methode hat er bereits 2016 gegen den ebenfalls populären prokurdischen Politiker Selahattin Demirtaş angewandt. Demirtaş sitzt seit neun Jahren in Haft. In den letzten Tagen ließ Erdoğan ganze Teile der CHP-geführten Stadtverwaltung von Izmir verhaften. Davor passierte dasselbe in Istanbul. Alles mit fadenscheinigen Begründungen und ohne Aussicht auf einen fairen Prozess.
In Russland ist das Wegsperren schon länger die routinierte Reaktion auf jeden Politiker, der nicht permanent Putin lobt und die Regierungslinie nibelungentreu vertritt. Der prominenteste politische Gefangene war Alexej Nawalny, der vor anderthalb Jahren in einem Straflager am Polarkreis vermutlich ermordet wurde. Putin entledigte sich seines populärsten, charismatischsten und klügsten Opponenten. Von jetzt an weiß jeder, was ihm blüht, wenn er Nawalny nacheifern wollte.
Natürlich herrschen in Ungarn, in Serbien, selbst in der autoritär regierten Türkei keine russischen Verhältnisse. Aber die Grundidee, politische Gegner mit juristischen Mitteln aus dem Feld zu räumen, verbreitet sich in zunehmend mehr Ländern. Und diese Tendenz darf auf keinen Fall mit einem juristisch gut begründeten Urteil gegen Marine Le Pen wegen der klar nachgewiesenen Veruntreuung von Steuergeldern vermischt werden.
Die Tatsache, dass die US-Regierung Frankreich und Deutschland laufend kritisiert, aber nicht Russland, Ungarn und die Türkei, zeigt, wo in Europa sie ihre "zivilisatorischen Verbündeten" sucht. Was für das freie Europa und die EU-Kommission im Umkehrschluss bedeutet, dass sie gegenüber den USA genauso wie gegenüber Ungarn, Serbien und der Türkei eine klare Sprache pflegt. Und die Linie zwischen Rechtsstaat und Unrechtsstaat scharf und deutlich markiert.

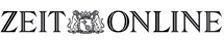 vor 4 Stunden
1
vor 4 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·