Vor fast dreißig Jahren, aus Anlass des zwanzigsten Todestags von Max Ernst, schrieb Werner Spies in dieser Zeitung über die Gemeinsamkeiten im Werk von Ernst und Franz Kafka. Das Objekt, in dem die innere Nähe beider Künstler konkret wurde, war für Spies der Odradek aus Kafkas Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“. Der Odradek ist eine sternförmige Zwirnspule, die auf einem ihrer Zacken und einem Holzstäbchen balanciert. Über das Ding, das sprechen und lachen kann, heißt es bei Kafka, es erscheine „zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen“.
In der Ausstellung „Fotogaga“, mit der das Berliner Museum für Fotografie an das hundertste Jubiläum des surrealistischen Manifests erinnert, sind mehrere von Max Ernst erfundene Verwandte des Odradek zu sehen. Eine davon ist die „Chinesische Nachtigall“ von 1920, die Ernst aus dem Foto einer englischen Fliegerbombe, einem Fächer, zwei Armen, einem Auge und einer Metallöse collagiert hat. Für eine andere Collage, „die anatomie“, montierte er einen Frauenkopf mit Schultern und Teile eines Unterleibs in die Abbildung eines zweisitzigen Jagdflugzeugs. Das Maschinengewehr des Bordschützen wird zur Luftröhre der weiblichen Figur.
Eine der größten Max-Ernst-Sammlungen weltweit
1996 war auch das Jahr, in dem die Lufthansa ihre über Jahrzehnte gewachsene, von Werner Spies kuratierte Max-Ernst-Sammlung verkaufte. Die Sammlung ging an den württembergischen Schraubenunternehmer Reinhold Würth, der sie in den folgenden Jahren systematisch ausbaute. Heute besitzt Würth einen der größten Bestände an Max-Ernst-Originalen weltweit. Wie groß, das kann man jetzt im Fotografiemuseum erkennen.
 Das fossilierte Auge des Surrealismus: Max Ernsts Lichtdruck „Das Lichtrad“ von 1926VG Bild-Kunst, Bonn 2025
Das fossilierte Auge des Surrealismus: Max Ernsts Lichtdruck „Das Lichtrad“ von 1926VG Bild-Kunst, Bonn 2025Die Berliner Ausstellung stellt eine der vielen Möglichkeiten dar, Max Ernsts kaleidoskopische Kunst neu zu entdecken. Sie legt, ihrem Ort entsprechend, den Akzent auf die Fotografie, aber man könnte ebenso gut mit der Malerei beginnen, der Grafik oder der Skulptur. Dennoch trifft die „Fotogaga“-Schau einen besonderen Punkt, denn Ernst, der selbst nie auf den Auslöser eines Fotoapparats gedrückt hat, ließ sich dafür umso öfter fotografieren, am liebsten von den Berühmtheiten der Profession.
Man Ray, Lee Miller, Denise Colomb, Josef Breitenbach, Lord Snowdon und Irving Penn haben sich ein Bild von ihm gemacht; und als Ernst 1965 mit seiner Ehefrau Dorothea Tanning den damaligen UN-Flüchtlingshochkommissar Sadruddin Aga Khan in seinem Schweizer Domizil Schloss Bellerive besuchte, ließen sich die beiden von ihm vor Ernsts Bronzeplastik „Capricorn“ in derselben Pose verewigen, in der sie John Kasnetzis siebzehn Jahre zuvor in Arizona vor der Zementversion der Skulptur porträtiert hatte.
 Eine Fliegerbome mit Armen: Max Ernsts „Chinesische Nachtigall“ von 1920VG Bild-Kunst, Bonn 2025
Eine Fliegerbome mit Armen: Max Ernsts „Chinesische Nachtigall“ von 1920VG Bild-Kunst, Bonn 2025Die Entscheidung der Kuratoren, Ernsts Selbstinszenierungen vor der Kamera erst im Schlusskapitel zu zeigen, gibt der Ausstellung deshalb einen seltsamen Spin – denn unter all den Collagen, Frottagen, Grattagen, Fotogrammen, Naturselbstdrucken und Ölbildern aus dem zwanzigsten Jahrhundert wirken die Fotos, gerade weil sie historische Zeugnisse sind, am wenigsten museal. Der Surrealismus ist nicht tot, er lebt weiter in den Bildern von Julie Curtiss und Jeff Soto, der Prosa von Botho Strauß und Haruki Murakami, den Filmen von David Lynch und Tim Burton, aber die Bildwelten, die in Berlin ausgebreitet werden, haben erkennbar Patina angesetzt.
Das gilt nicht nur für die Kunst von Max Ernst, deren handgearbeitete Metamorphosen heute mühelos im Computer bewerkstelligt würden, sondern mehr noch für die seiner Freunde und Nachahmer, mit deren Arbeiten das Fotografiemuseum die Leihgaben der Würth-Sammlung ergänzt hat. Die Fotomontagen der tschechischen Avantgardisten Jindřich Heisler und Karel Teige oder des Franzosen Georges Hugnet betrachtet man mit demselben Interesse wie ein zeitgenössisches Oldtimer-Auto, und die Puppenbilder Hans Bellmers wirken schon wegen ihrer sadistischen und misogynen Obertöne antiquiert.
 Der Vielgesichtige: Max Ernst, fotografiert von Josef Breitenbach, Paris 1936The Josef and Yaye Breitenbach Charitable Foundation
Der Vielgesichtige: Max Ernst, fotografiert von Josef Breitenbach, Paris 1936The Josef and Yaye Breitenbach Charitable FoundationDass auch Picasso für ein Porträt Dora Maars mit der Fotogrammtechnik experimentiert hat, ist immerhin eine interessante Fußnote: Es zeigt, wie sehr die Dunkelkammer auch die Künstler jenseits des Surrealismus faszinierte, ehe ihre Lichtalchemie durch die flache Pixelwelt der Digitalfotografie ersetzt wurde.
Der Surrealismus, wie Dada eine Frucht des Ersten Weltkriegs, war auch eine Flucht aus der Geschichte. Keins der größtenteils aus den Zwanziger- bis Vierzigerjahren stammenden Exponate im Fotografiemuseum spielt auf die Weltwirtschaftskrise, die Parteienkämpfe in Europa, den Spanischen Bürgerkrieg – Ernsts „Hausengel“ ist in München geblieben – oder den Zweiten Weltkrieg an, auf keinem ist ein Hakenkreuz oder ein Mussolinikopf zu sehen.
 Ein Antlitz im Asphalt: Emila Medková, „Schwarz/Černoch“, 1949Christian Schmieder
Ein Antlitz im Asphalt: Emila Medková, „Schwarz/Černoch“, 1949Christian SchmiederDer Loplop, der menschenähnliche Vogel, in dessen Maske Max Ernst in seinen Bildern auftritt, blickt auf eine Welt herab, die sich aus den Vorstellungen des neunzehnten Jahrhunderts speist; dessen Mythen, ob als Illustration aus Zeitschriften und Lexika oder als abgelebtes Kunstideal, sind der Stoff seiner Phantasien. Der „Sog der Probabilität des Unheimlichen und Unerklärlichen“, den Werner Spies bei Ernst wie bei Kafka ausmachte, ist deshalb nur noch bei dem Dichter aus Prag spürbar, bei dem Alleskönner aus Brühl hat er sich in Wohlgefallen aufgelöst.
Nur sein Auge blickt uns immer noch an. In „Das Lichtrad“ wächst es aus einer Scherbe, in einer Collage aus Ernsts Roman „La femme 100 têtes“ aus dem Bauch einer Frauenstatue, in „Troisième poème visible“ bildet es, vervielfacht, eine Art Säulenallee. 1965 hat Bill Brandt das linke Auge des Künstlers in Großaufnahme fotografiert. Es wirkt unter den Stirnfalten wie ein Stück Natur. Aber der Widerschein des Lichts auf der Pupille zeigt an, dass es ein Durchgang zwischen innen und außen ist. Eine Welt spiegelt sich darin. Seine Welt. Auch unsere.
Fotogaga. Max Ernst und die Fotografie. Museum für Fotografie Berlin, bis zum 25. April. Der Katalog kostet 35 Euro.

 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1


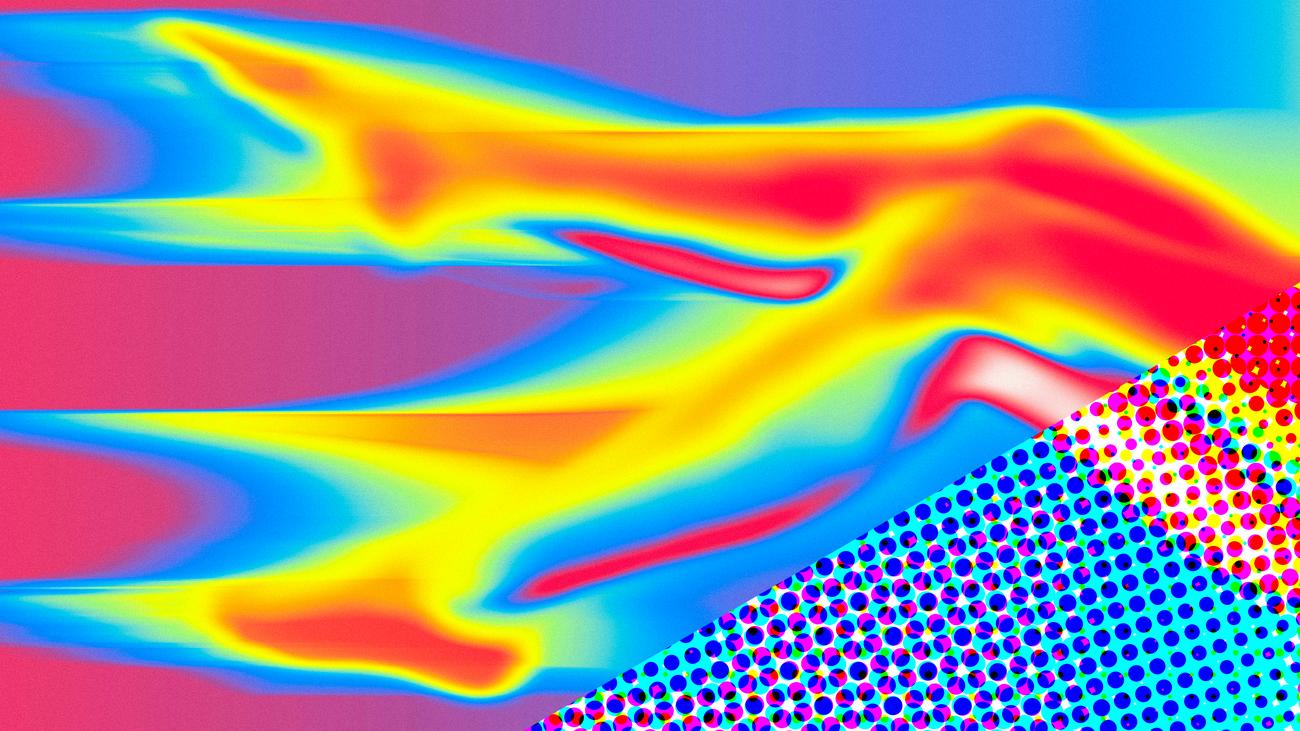








 English (US) ·
English (US) ·