Erst jetzt, da der dritte und letzte Band von Julia Schochs „Biographie einer Frau“ vorliegt, zeigt sich die innere Mechanik dieser Trilogie. Darauf verweist in „Wild nach einem wilden Traum“ schon der erste Satz, der bei dieser Autorin ja immer einen kurzen Stromschlag auslöst: „Ich setze noch einmal an, an einem andern Punkt.“
Das Triptychon besteht also nicht aus Erzählungen, die aufeinander aufbauen, sondern aus drei verschiedenen Zugängen zu einem Leben, die nicht chronologisch erzählt werden, sondern stofflich und motivisch inspiriert sind und immer autofiktional. Die Schlüsselfrage lautet dabei nicht, wie so oft in diesem Genre: Wer bin ich? Sie lautet vielmehr: Wer bin ich im Verhältnis zu anderen? Auch deshalb erleben wir die namenlose Ich-Erzählerin mal als Mutter, Tochter oder Schwester (Teil 1), mal als Mutter, Freundin oder Ehefrau (Teil 2) und nun im dritten Teil mal als Schülerin, Geliebte oder Mutter erwachsener Kinder, um nur einige ihrer Rollen zu nennen.
In den Wäldern der Appalachen
„Wild nach einem wilden Traum“ bewegt sich zwischen der Berliner Gegenwart, aus der sich die Ich-Erzählerin erinnert, und dem Jahr 2002, als sie, damals noch angehende Literaturwissenschaftlerin an der Universität, einen Sommer in einer amerikanischen Künstlerkolonie in den Catskill Mountains nördlich von New York verbringt. Und ausgerechnet hier, in den Wäldern der Appalachen, erinnert sie sich an eine längst vergangene Episode, als sie zu DDR-Zeiten als Offizierstochter in der Garnisonsstadt E. im Wald auf einen Soldaten traf, der eigentlich Gärtner war und die Literatur liebte und nicht so recht in die Kasernenwelt zu passen schien.
Auf knapp 180 Seiten entfaltet Julia Schoch ein Panorama von vierzig Jahren. Ohnehin schreibt die 1974 in Potsdam geborene Autorin ja nur vordergründig von sich, um in Wahrheit Material zu bergen, das den Blick auf eine ganze Epoche öffnet. Ihre zwischenmenschlichen Geschichten fügen sich zu gesellschaftlichen Panoramen, die uns alle zu Protagonisten einer kollektiven Geschichte machen. In unfreiwilliger Komik brachte dies Elke Heidenreich auf den Punkt, als sie in einer Rezension des zweiten Teils der Trilogie schrieb: „Ich kenne das alles. Ich lese dieses Buch, als hätte ich es selbst geschrieben.“
 Mainzer Stadtschreiberin 2024: Julia SchochZDF/Ulrich Burkhardt
Mainzer Stadtschreiberin 2024: Julia SchochZDF/Ulrich BurkhardtWas sie meinte, ist offensichtlich, aber indem sich die Kritikerin in den Entstehungsprozess einschrieb, machte sie sich zur Hauptperson einer kollektiven Erfahrung und sagte damit dann doch etwas sehr Wahres über die Literatur von Julia Schoch: nicht weil sie den Roman hätte schreiben können, sondern weil sie sich darin so sehr erkannt fühlte, dass sie dies meinte.
So schlicht mitunter Schochs Prosa anmutet, ist sie doch alles andere als einfach. Denn Julia Schoch als Beobachterin des eigenen Lebens ist das Ich ihrer Geschichten und ist es zugleich auch nicht. Im ersten Teil der Trilogie, „Das Vorkommnis“, fällt nicht zufällig der Satz „Das hier ist nicht die Geschichte meiner Familie“. Und natürlich kennt sie das berühmte Zitat von Jonathan Franzen: „Je größer der autobiographische Gehalt im Werk eines Schriftstellers, desto geringer die oberflächliche Ähnlichkeit mit seinem eigentlichen Leben.“
Spannung zwischen innen und außen
Die große Geschichte, das Weltgeschehen, wird bei ihr nicht zum dekorativen Hintergrund einer intimen Selbsterkundung, sondern lauert immer und überall. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Innen und Außen, Gesellschaft und Einzelnem wird in vielen Details deutlich. Im aktuellen Band vor allem in den Szenen in der Garnisonsstadt E., die von der Militär- und Gewaltgeschichte der DDR bis in die Gegenwart reichen, als die Ich-Erzählerin befürchtet, dass ihr siebzehnjähriger Sohn der neuen Wehrpflicht unterliegen wird. Hier wird das pessimistische Geschichtsbild der Autorin greifbar. Sosehr wir auch glauben und hoffen, den Fortschritt zu erleben, am Ende erweist sich alles als Zirkelschluss, und wir sind wieder da, wo wir schon einmal waren.
So steckt bei Schoch auch im neuen Band, bei dem sich die Erzählerin im Sommer 2002 auf eine Affäre mit einem katalanischen Schriftsteller einlässt, stets die große Geschichte in der kleinen und umgekehrt. Privates und Politisches bilden ein unentwirrbares Knäuel, der Schreibtisch wird zum Schauplatz deutsch-deutscher Geschichte. Die Gegensätze von Innen und Außen sind dabei aufs Äußerste gespannt. Und ums Gedenken, ums Erinnern geht es in dieser Trilogie natürlich immerzu.
 Die Wälder der Catskill Mountains bei New YorkLaif
Die Wälder der Catskill Mountains bei New YorkLaifErstaunlich ist, dass diese Erinnerungsprosa das Ungeheuerliche meist in aller Kürze entwirft. Im ersten Teil der Trilogie, „Das Vorkommnis“, genügen fünf Worte, um der Ich-Erzählerin den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Es ist der Satz einer Fremden: „Wir haben übrigens denselben Vater.“ Das bringt die Herkunftsfamilie aus dem Gleichgewicht und wirft die Frage auf: War sie je im Gleichgewicht?
Auch im zweiten Teil, „Das Liebespaar des Jahrhunderts“, geht Schoch dem Verlorenen nach, wendet es hin und her, schaut es an, um Klarheit in das Unbegreifliche zu bringen: das Ende einer Beziehung nach 31 Jahren, von der ersten Begegnung in der Plattenbauwohnung, als es noch Telefone mit Kabel gab und man auf dem Boden saß. Selbst da gab es schon Erinnerung, wenn das junge Paar nach Bukarest fuhr, um dort das verlorene Land seiner Kindheit wiederzufinden.
Triebfeder für Enttäuschung
Die Zeit und wie sie vergeht, ist wohl einer der größten Unsicherheitsfaktoren bei Julia Schoch, die verheerendste Triebfeder für Enttäuschung und Erschöpfung. Davon und ob man sich dagegen wappnen kann, handelt nun „Wild nach einem wilden Traum“. So kann man diesen Abschlussband auch isoliert lesen, aber das Vergnügen steigt, wenn man die beiden vorangegangenen Titel kennt. Zumal der Zugriff aufs „Ich“ bei Julia Schoch noch einmal eine andere Dimension erfährt.
Das Schoch’sche „Ich“ hat nämlich etwas mit Freiheit zu tun, mit der Befreiung aus einer DDR-Vergangenheit, in der das Wort „Individuum“ ein Schimpfwort für Menschen war, die sich nicht einfügen wollten, wie die Autorin dies einmal beschrieb. Nach 1989 war für sie daher auch deshalb plötzlich alles anders, weil sie auf sich allein gestellt war und „nicht mehr Bestandteil einer großen ideologischen Erzählung“.
Und so, befreit von allen ideologischen Mustern und Anforderungen, sagte sie: Ich. Und dieses Ich misstraut bis heute sämtlichen Gewissheiten, selbst der, dass der Mauerfall für alle Ostdeutschen prägend sei und alles von diesem Datum her gedeutet werden müsse. Und dieses Ich erkundet weibliche Erfahrungsräume und legt frei, was dort geschieht, wo sich alles entscheidet, im verschütteten Selbst.

 vor 7 Stunden
1
vor 7 Stunden
1

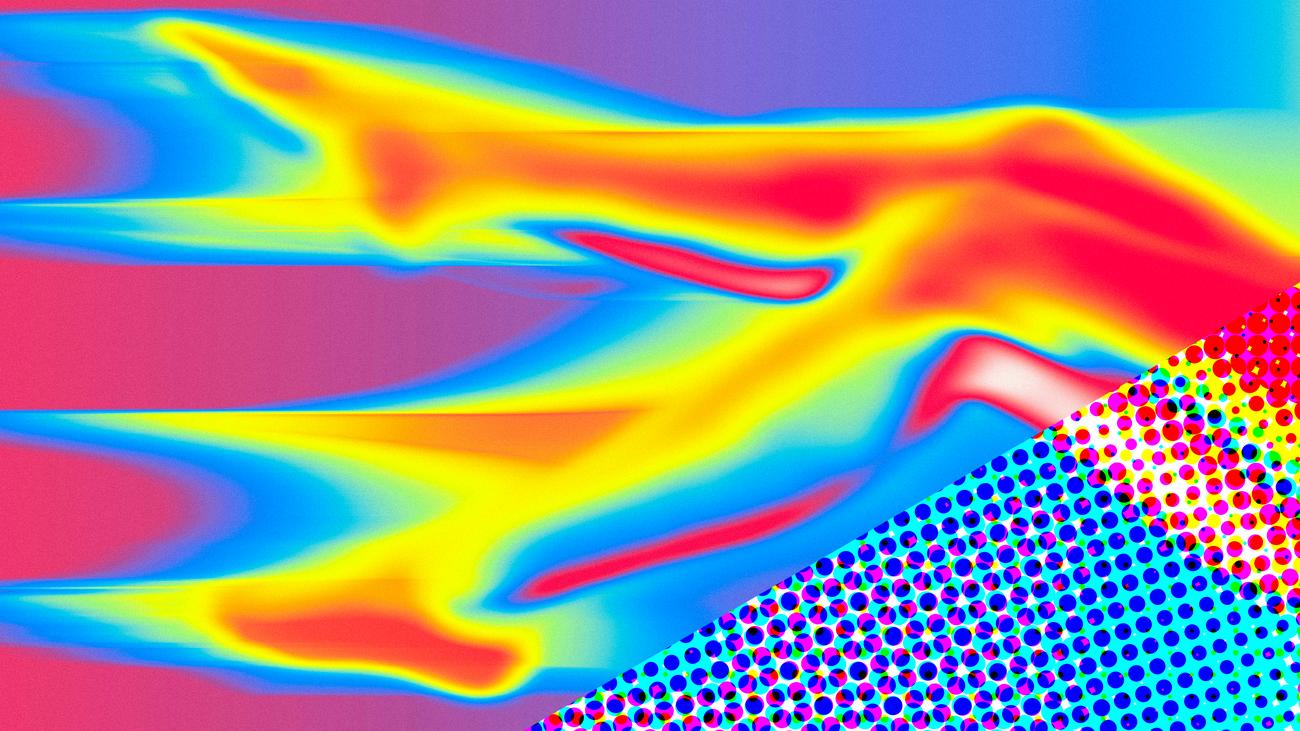









 English (US) ·
English (US) ·