Meteorologisch rückt der Herbst immer näher. Politisch haben ihn Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und andere aus seiner Partei schon seit Wochen beschworen. Im „Herbst der Reformen“ pocht die Union auf Veränderungen im Sozialstaat. Auch in der SPD sieht und spricht man mittlerweile von einem Reformbedarf.
Die Erarbeitung der Lösungskonzepte hatte Schwarz-Rot vorsorglich in Kommissionen ausgelagert (Stichwort „Herbst der Kommissionen“). Da man in den Koalitionsfraktionen, der Arbeit in diesen Kommissionen nicht vorgreifen will, ist es in Berlin recht still, wenn man nach konkreten Reformprojekten bei Bürgergeld, Rente, Gesundheit oder Pflege fragt. Dabei müsste Fachleuten zufolge angesichts der dramatischen Finanzierungslage in den Sozialversicherungen auch mit bisherigen Tabus gebrochen werden.
1. Bürgergeld
In der öffentlichen Meinung spielt das Bürgergeld seit Monaten eine prominente Rolle. Die Union hat Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zwar dazu gebracht, es durch eine „Neue Grundsicherung“ zu ersetzen. Doch CDU/CSU reicht das nicht.

© dpa/Michael Bihlmayer
Durch unter anderem schärfere Sanktionen bis zum vollständigen Leistungsentzug für „Totalverweigerer“, weniger Schonvermögen und Pauschalierung von Leistung stellte Bundeskanzler Merz in Aussicht, jährlich bis zu fünf Milliarden Euro zu sparen. Experten bezweifeln jedoch, dass durch Sanktionen gegen „Totalverweigerer“ nennenswerte Einsparungen möglich sind. Zudem muss qua Verfassungsrecht ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet bleiben.
„In großem Umfang sparen kann man nur, wenn man Menschen nachhaltig in Jobs bringt“, sagte der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) dem Tagesspiegel: „Dafür muss man bei den Maßnahmen alle Register ziehen.“ Dafür brauche es mehr Qualifizierung, individuelle Unterstützung und bessere Anreize. Um das umzusetzen, müsse man allerdings eher noch mehr Geld in die Hand nehmen.
In der Sozialstaatskommission soll zudem geprüft werden, ob man mehrere Leistungen, wie Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammenlegen kann. So sollen Verwaltungsausgaben gespart, aber auch die Zugänglichkeit für Bezieher vereinfacht und Stigmata abgebaut werden.
Die Sozialrechts-Professorin Andrea Lenze erwartet allerdings nicht, dass sich dieses Vorhaben in dieser Legislaturperiode reformieren lässt. „Die Zusammenlegung von Leistungen scheint ein hehres Ziel, ist aber in der Umsetzung sehr kompliziert“, sagte sie dem Tagesspiegel. Das habe auch das Scheitern der Kindergrundsicherung gezeigt. „Reformen in Hinblick auf Rentenversicherung und Krankenversicherung sind zudem viel dringlicher.“
2. Rente
Tatsächlich ist der Finanzierungsdruck bei der Rente weitaus größer. Durch Deutschlands Demografie muss der Bund schon heute über ein Viertel des Bundeshaushalts für Rentenzahlungen beisteuern – Tendenz steigend.
Die Koalition wird das Finanzierungsproblem wohl weiter verschärfen: Die vom Bundeskabinett bereits beschlossene Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent bis 2031 und die Vollendung der Mütterrente kosten bis 2040 noch einmal 200 Milliarden Euro mehr. Während Fachleute seit Jahren auf Reformen drängen, soll nun erneut eine Kommission Vorschläge für die künftige Finanzierung des Rentensystems machen.

© Getty Images/Johner RF/Johner Images
Mit der Aktiv-Rente setzt Schwarz-Rot bisher auf Freiwilligkeit. Der Wirtschaftsweise Martin Werding glaubt nicht, dass das reicht. „Moderate weitere Anhebungen der Regelaltersgrenze und ein zügiger Ausbau besserer Formen der ergänzenden, kapitalgedeckten Vorsorge sind angesichts der demografischen Alterung die beiden No-Brainer der Rentendebatte“, sagte er dem Tagesspiegel.
Allerdings reiche auch das nicht allein aus, um den jetzt einsetzenden Alterungsschub durch die Renteneintritte der Babyboomer zu bewältigen. „Hierfür braucht es schneller wirkende Maßnahmen, die den absehbaren Anstieg der Rentenausgaben dämpfen, ohne zu große soziale Härten zu erzeugen“, so Werding.
Neben einer Rücknahme der Mütterrente III (CSU-Projekt) könnte die Verkleinerung des Versichertenkreises bei der Rente mit 63 (SPD-Projekt) eine Option sein. Heute hat Anspruch darauf, wer 45 Beitragsjahre erworben hat. Dazu zählen allerdings auch Jahre, in denen man beispielsweise arbeitslos war. Fachleuten zufolge könnten Beitragsjahre also durch Arbeitsjahre ersetzt werden.
3. Gesundheit
Obwohl es in diesem Jahr Rekordanstiege bei den Beiträgen gibt, werden den Krankenkassen nach derzeitigem Stand 2026 erneut vier Milliarden Euro fehlen. Als zentrales Problem hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) die häufigen Arztbesuche der Deutschen ausgemacht. Mit im Schnitt zehn Arztbesuchen pro Kopf und Jahr erreiche das Land einen „einsamen europäischen Rekord“, sagte Merz bei einer Veranstaltung des Verbands der Maschinenbauer.
Ein Grund dafür ist das sogenannte Ärzte-Hopping. Die Deutschen gehen gerne direkt zum Facharzt – und dabei leider oft zunächst zum Falschen. Deshalb braucht es manchmal mehrere Konsultationen von Spezialisten, bis die passende Diagnose steht. Schwarz-Rot will deshalb das sogenannte Primärarztmodell einführen. Von einigen Ausnahmen abgesehen, sollen künftig alle Patienten zunächst zu ihrem Hausarzt gehen.

© dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Ob diese Reform wirklich Geld spart oder nur für eine dringend benötigte Entlastung bei den Fachärzten sorgt, bleibt allerdings abzuwarten. Vor allem aber wird sie nicht schnell wirken.
Um die Zahl der Arztbesuche einzudämmen, schlägt der CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck deshalb etwas anderes vor: „eine moderate, sozialverträgliche Selbstbeteiligung“, um „Bagatellbesuche zu reduzieren“. Ob die Sozialdemokraten da mitmachen, bleibt abzuwarten.
Fachleute machen für die stark steigenden Gesundheitskosten aber ohnehin eher den Kliniksektor verantwortlich. Mit der Krankenhausreform wollte der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Zahl der Häuser reduzieren. Diese Reform weicht seine Nachfolgerin Nina Warken (CDU) gerade auf Druck der Länder wieder auf. Mit einer Notfall-Reform will Schwarz-Rot zumindest erreichen, dass Patienten bei leichten Beschwerden weniger oft in der Notfallaufnahme landen.
4. Pflege
Auch in der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) droht 2026 ein Finanzloch von zwei Milliarden Euro. Ohne Reformen könnten die Beiträge dadurch um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte steigen. Die steigenden Kosten sind einerseits auf höhere Gehälter für Pflegekräfte und andererseits auf den demografischen Wandel zurückzuführen.
Aber auch die Pflegereform von Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat die Kosten in die Höhe getrieben. Mit den neuen Pflegegraden haben sehr viel mehr Menschen als früher Anspruch. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert nun, den sogenannten Entlastungsbetrag für Haushaltshilfen im Pflegegrad 1 abzuschaffen. Das halten auch viele Experten für sinnvoll.
Der BDA will darüber hinaus auch eine sogenannte Karenzzeit. Im ersten Jahr sollen Pflegebedürftige noch keine Leistungen von der Sozialen Pflegeversicherung erhalten. Dies würde allerdings den Wert der SPV für die Versicherten angreifen, da viele Betroffene ohnehin nur ein Jahr Geld für Pflegeleistungen erhalten.
Mit einer Abschaffung des Entlastungsbetrags im Pflegegrad 1 allein lässt sich die finanzielle Schieflage der sozialen Pflegeversicherung allerdings nicht beheben. Zudem wäre damit auch das Problem der hohen Eigenanteile für Pflegebedürftige in Heimen nicht gelöst.
Der Expertenrat der Privaten Krankenkassen schlägt eine verpflichtende Zusatzversicherung vor, um die finanziellen Engpässe der SPV wie der Pflegebedürftigen zu entschärfen. Dieses Modell hat auch in der Union viele Befürworter, die SPD hat sich noch nicht sortiert.

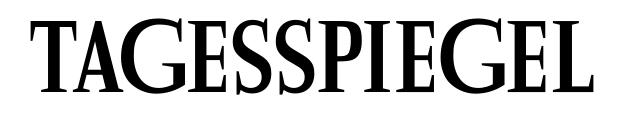 vor 2 Stunden
1
vor 2 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·