Die Szene erinnert an einen Kriegsfilm. In einem Bergwerksstollen, getaucht in bläuliches Licht, beugen sich der Vizepräsident der EU-Kommission und die schwedische Wirtschaftsministerin über eine Art überdimensionalen Kartentisch. Sie studieren ein virtuelles Relief des Geländes, das gut 500 Meter über ihnen liegt. Neben ihnen steht der Chef des Bergbauunternehmens und erklärt die Lage, präzise und knapp wie ein Militär.
Der Stollen ist Schauplatz in einem besonderen Konflikt. Seine Waffen sind nicht Kanonen, sondern Exportkontrollen, Zölle und seltene Erden – jene Rohstoffe, die als Treibstoff der Industrie der Zukunft gelten. Unter der Erde der nordschwedischen Stadt Kiruna liegen geschätzt rund zwei Millionen Tonnen davon. Es geht um das, worum es in jedem Krieg geht: um Reichtum, Macht, Vorherrschaft.
Stéphane Séjourné, als einer von sechs Vizechefs der EU-Kommission für Industriestrategie zuständig, ist mit Schwedens Wirtschafts- und Energieministerin Ebba Busch an diesem Tag Ende September in die größte unterirdische Eisenerzmine der Welt gereist. Sie wollen ein politisches Zeichen setzen: Die EU will sich aus der Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden befreien. Denn Peking nutzt seine Dominanz inzwischen als Machtinstrument. »Wir müssen radikal umschalten«, sagt Séjourné.
Seltene Erden – 17 Metalle, unentbehrlich für die Energiewende, für moderne Waffensysteme und zahllose Hightech-Produkte – sind, anders als ihr Name vermuten lässt, keineswegs selten. Doch ihre Gewinnung und Verarbeitung sind technisch anspruchsvoll, teuer und mit hohen Umweltkosten verbunden. China ist auf diesem Gebiet dominant, die besonders wichtigen unter diesen Rohstoffen, die sogenannten schweren seltenen Erden, kommen fast ausschließlich aus der Volksrepublik.
Lange schien das kein Problem zu sein. Chinas Exporteure lieferten reichlich und zuverlässig. Warnungen vor zu großer Abhängigkeit wischten auch deutsche Unternehmen beiseite. Diversifizieren? Wozu, wenn es einen funktionierenden Weltmarkt gibt?
Diese Haltung rächt sich nun. Seit US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen einen Handelskrieg mit China losgetreten hat, eskaliert auch Peking – und nutzt dafür seine schärfste Waffe. Anfang Oktober hat China den Export von fünf weiteren Seltenerdmetallen eingeschränkt. Damit stehen nun 12 von 17 der begehrten Elemente auf der Liste jener Rohstoffe, deren Ausfuhr extra genehmigt werden muss. Sogar für die Ausfuhr von Produkten, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, will Peking Genehmigungen verlangen – sofern seltene Erden aus China 0,1 Prozent des Produktwerts oder mehr ausmachen.
De facto bedeutet das harte Beschränkungen. Schon im September sanken die chinesischen Exporte von Seltenerdmagneten. Die Ausfuhren fielen um 6,1 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie aus Angaben der Zollbehörde in Peking hervorgeht. Damit trifft die Regierung Branchen wie die Hersteller von E-Autos, Windkraftanlagen oder Rüstungsgüstern, die auch Deutschlands Zukunft sichern sollen. Am Ende könnte die Volksrepublik weite Teile des globalen Handels und sogar der westlichen Rüstungsindustrie unter ihre Kontrolle bringen.
Vorbei sind die Zeiten, in denen China dem Prinzip »Verstecke deine Stärke und warte ab« seines früheren Anführers Deng Xiaoping folgte, der das Land von 1978 bis 1989 regierte.
Heute steht auf einem Schild am Eingang eines Parks inmitten des Seltenerden-Fördergebiets von Baotou, einer Stadt am Gelben Fluss, ein ganz anderes berühmtes Deng-Zitat: »Der Nahe Osten hat Öl. China hat seltene Erden.«

Seltenerden-Bergbaustadt Baotou in der Inneren Mongolei: Kontrolle bis ins Ausland
Foto: Lian Zhen / Xinhua / AFP»Der Nahe Osten hat Öl. China hat seltene Erden.«
Deng Xiaoping, früherer chinesischer Staatspräsident
Die chinesischen Exportbeschränkungen sollen gestaffelt zwischen Oktober und Anfang Dezember in Kraft treten. Sie erzürnten US-Präsident Trump so sehr, dass er im Gegenzug weitere Zölle von 100 Prozent auf Waren aus China ankündigte. Sollte der Handelskonflikt weiter eskalieren, fürchten Experten in Brüssel einen Zusammenbruch der globalen Lieferketten.
Dumm nur, dass die Reaktionen der Europäer ihre Hilflosigkeit offenbaren. Man sehe die Ausweitung der chinesischen Exportkontrollen »mit großer Sorge«, erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Chinas Regierung gehe »äußerst aggressiv« vor, sagt EU-Handelskommissar Séjourné. Man müsse ihr »die Grundlage der Erpressung nehmen«.
Chinas Weg zur Vorherrschaft
Heute entfallen mehr als zwei Drittel der Weltproduktion an seltenen Erden auf China, rund 90 Prozent des globalen Angebots werden dort raffiniert, 99 Prozent der besonders begehrten schweren seltenen Erden kommen aus der Volksrepublik – und sind ein vom Staat streng bewachtes Politikum.
Wer eine Mine besuchen oder mit einem Forscher reden möchte, hat keine Chance. Westlich von Baotou zieht sich eine zwei Meter hohe Betonmauer um einen künstlichen See, den sie »Schwanz der Minen« nennen. Niemand soll sich ihm nähern, was wohl auch keine gute Idee wäre: Der See ist eine Müllkippe für Dutzende Bergbaubetriebe, er gilt als hochgradig toxisch. Sein Inhalt sickert ins Grundwasser und wohl auch in den nahe gelegenen Gelben Fluss, der 160 Millionen Menschen mit Wasser versorgt.

Chinesische Mine Bayan’obo: Von der Außenwelt abgeschirmt
Foto: Bridgeman ImagesKaum weniger bedrückend wirkt die Szenerie auf dem Weg zur nördlicher gelegenen Mine Bayan’obo, kurz vor der Grenze zur Mongolei. Mehr als die Hälfte der seltenen Erden Chinas wird hier gefördert. Bergbaubetriebe haben die Gegend umgegraben, alle Bäume gefällt, die Natur ausgebeutet. Je näher man der Mine kommt, desto seltener sieht man Bäume, umso öfter schweres Baugerät. Und bereits einige Kilometer vor der Mine ist Schluss, die Straßen sind abgesperrt.
Die Umweltzerstörung ist der Preis, den Chinas Regierung offenbar zu zahlen bereit war, um den Weltmarkt zu beherrschen.
Die Seltenerd-Branche »untersteht in China direkter Kontrolle«, sagt Craig Hart. Der Dozent an der Johns Hopkins University in der US-Hauptstadt Washington war zuvor an der Schule für Umwelt und Rohstoffe der Pekinger Renmin-Universität tätig. Er kennt die chinesische Seltenerd-Branche aus der Nähe.

Motorenfabrik in Baotou: Nachschub geräuschlos abschneiden
Foto: Bei He / Xinhua / AFPHart zufolge könnten die Chinesen die Preise kontrollieren, indem sie festsetzen, welche Mengen an seltenen Erden gefördert und geschmolzen werden. Und sie hätten auch »die Zukunft der Technologie im Würgegriff«, sagt Hart. »Sie bewachen damit die Tore, durch die alle technologische Entwicklung gehen muss. Man kann davon ausgehen, dass sie diese Tore in einem Kriegsszenario schließen würden.«
Entscheidet die politische Führung, einem Land den Nachschub abzuschneiden, setzt der Apparat das schnell und geräuschlos um. Eine Anordnung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie genügt. Praktisch alle großen Förderer und Raffinerien sind Staatsunternehmen. »Und falls noch irgendein Zweifel daran besteht, ob sie den Anweisungen Folge leisten«, sagt Hart, »sitzt in jedem Unternehmen ein Parteisekretär, der de facto der Chef ist.«
China habe sich sein Quasimonopol beharrlich erarbeitet. Indem es billige Kredite an chinesische Produzenten vergab oder ausländische Konkurrenz vom eigenen Markt ausschloss. Indem es dafür sorgte, dass in China nur eine Handvoll Firmen mit großer Marktmacht übrig blieb. Laxe Umweltvorschriften drückten die Kosten, internationale Wettbewerber gaben auf, sagt Rohstoffexperte Hart.
Peking hat sich mit Geduld und staatlicher Steuerung nicht nur eine dominante Rolle verschafft. Es hat auch wirksame Instrumente, sie für lange Zeit zu zementieren.
Europas Kampf gegen die Bürokratie
Theoretisch haben die Europäer drei Möglichkeiten, auf die Macht der Volksrepublik zu reagieren. Erstens: strategische Vorräte anlegen. Zweitens: zügig Handelsabkommen mit anderen Staaten schließen, um Zugriff auf Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten zu sichern. Drittens: eigene Förder- und Raffineriekapazitäten aufbauen. Nur sind sie ziemlich spät dran.

Proben von seltenen Erden: Gar nicht so rarer Rohstoff
Foto: David Becker / REUTERSDas Anlegen strategischer Vorräte könnten die Europäer mittlerweile vergessen, glaubt Jan Giese vom hessischen Seltenerd-Handelsunternehmen Tradium: »Für Europa besteht hier inzwischen keine Chance mehr.« China exportiere kein Material mehr, wenn nicht vollständig offengelegt werde, wie es am Ende genutzt werden solle. Die Behörden verlangten genaue Angaben darüber, wie viel von ihren Rohstoffen in welches Bauteil geht und wofür dieses genutzt wird. Insbesondere bei Dual-Use-Gütern, die auch militärisch nutzbar seien, fürchtet Giese, »werden die Chinesen effektiv unterbinden, dass die EU nennenswerte Vorräte anlegt«.
Und die zweite Möglichkeit, die Handelsabkommen? Sie dauern meist Jahre, und viele Kandidaten sind ebenfalls von China abhängig, entweder bei Rohstoffen oder auf anderen Feldern. Mit dem »Bergbau-Giganten« Indonesien gebe es bereits eine politische Einigung über ein »ambitioniertes Freihandelsabkommen«, so verkündete es EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Mitte September bei einem Treffen mit Chefs deutscher Industrieverbände. Mit Indien wolle man noch in diesem Jahr einen Handelsvertrag abschließen. Auch mit Australien verhandelt die EU über ein Abkommen, das Lithium und seltene Erden einschließen soll. Die erneute Machtübernahme von Donald Trump in den USA habe neuen Schwung in die Gespräche gebracht, heißt es aus Berliner Regierungskreisen.
Doch an die Rohstoffe zu kommen, ist nur der erste Schritt. Mindestens ebenso wichtig ist die Verarbeitung – und die habe China »weitgehend monopolisiert«, wie von der Leyen einräumt.
In Europa gibt es derzeit kaum Kapazitäten, seltene Erden zu verarbeiten. Erst im Januar hat das staatliche Bergbauunternehmen LKAB, Betreiber der Mine in Kiruna, im nordschwedischen Luleå mit dem Bau einer Anlage begonnen, mit dem zunächst gezeigt werden soll, dass das Verfahren im industriellen Stil funktioniert. Sie soll 2026 in Betrieb gehen. Es ist ein kleiner Fortschritt.
Bei ihrem Besuch im September stapft Schwedens Wirtschaftsministerin Busch in schweren Gummistiefeln durch den Stollen tief unter Kiruna, vorbei an riesigen Baggerschaufeln und anderem Bergbaugerät.
Die kathedralenartigen Ausmaße der 1,4 Kilometer tiefen Mine, die sich mit dem Reisebus befahren lässt, passen nicht recht zu Buschs ernüchternder Beschreibung der Lage. »Wir werden keinen Preiskrieg mit China gewinnen«, sagt sie. Die einzige Lösung sei, eine »echte Macht zu haben«, so Busch. »Und das bedeutet eigene Ressourcen.«
Kiruna bietet Bedingungen, die für Europa fast ideal erscheinen: eine dünn besiedelte Region, eine vorhandene Infrastruktur durch den Bergbau, ein Vorkommen mit hohen Konzentrationen. Im Januar 2023 haben die Schweden den Fund von Europas größtem Vorkommen an seltenen Erden nahe der bereits bestehenden Mine verkündet. Anfangs war die Rede von einer Million Tonnen an Seltenerd-Oxiden, inzwischen schätzt LKAB das Vorkommen auf zwei Millionen Tonnen.
Das Bergbauunternehmen glaubt, damit bis zu 18 Prozent des Jahresbedarfs der EU an seltenen Erden decken zu können. Zudem sind sie in der in der sogenannten Per-Geijer-Lagerstätte mit Eisenerz verbunden, das den Großteil der Gewinne einfahren würde. »Die seltenen Erden sind nur die Kirsche auf der Torte«, sagt LKAB-Sprecher Niklas Johansson. Das würde das Vorkommen auch weniger verwundbar für chinesische Preismanipulationen machen.
Doch wer geglaubt hatte, der Abbau würde rasch beginnen, hat die Rechnung ohne die Bürokratie gemacht. Der im Mai 2024 erlassene Critical Raw Materials Act (CRMA), das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen, soll die Dinge eigentlich beschleunigen. Die Kommission hat 31 Materialien sowie alle seltenen Erden zu kritischen Rohstoffen erklärt, essenziell für grüne und digitale Technologien, Raumfahrt und Verteidigung.
Auch die Per-Geijer-Lagerstätte hat den Status eines strategischen Projekts erhalten. Aber: Es braucht auch eine schwedische Konzession und eine Umweltgenehmigung. Was das bedeute, erlebe man derzeit bei einer anderen Mine, die schon seit 130 Jahren bestehe und nun eine neue Genehmigung brauche. »Der Antrag war 8000 Seiten lang«, sagt Johansson. »Ich wäre sehr froh, wenn wir in zehn Jahren mit dem Abbau der Lagerstätte Per Geijer beginnen könnten.«
In Kiruna kommt hinzu, dass ganze Teile der Stadt in der Vergangenheit versetzt werden mussten, um nicht Bergschäden zum Opfer zu fallen. Sogar die historische Holzkirche wurde im August auf Rollen gestellt und an einen neuen Ort gebracht. Zwei Tage lang rollte das fast 700 Tonnen schwere dunkelrote Gebäude in einem Stück durch den Ort, was dort Volksfeststimmung auslöste.

Versetzung der Kirche in Kiruna: Der Volksfeststimmung folgte Katerstimmung
Foto: Bernd Lauter / Getty Images»Die Mine und ihre Möglichkeiten entscheiden über die Souveränität Europas und Schwedens.«
Schwedische Wirtschaftsministerin Ebba Busch
Sie verflog kurz darauf, als bekannt wurde, dass rund 6000 Menschen umziehen müssen. Ihre etwa 2700 Häuser werden – abgesehen von wenigen, die als kulturell oder historisch bedeutend gelten – nicht versetzt, sondern abgerissen. Ihre Eigentümer bekommen ein neues Haus oder den Marktwert ihres Hauses plus 25 Prozent. Viele Menschen müssen sich von Häusern verabschieden, in denen schon ihre Eltern aufgewachsen sind. Die Firma LKAB kostet das alles voraussichtlich rund zwei Milliarden Euro.
Und dann wären da noch die Hirsche. Die Samen – Westeuropas letztes verbliebenes indigenes Volk – fürchten um die letzte Wanderroute ihrer Rentiere. Auch das ist ein brisantes Thema. Die Samen wurden in Schweden lange diskriminiert, ihre Rechte müssen bis heute hinter den Bedürfnissen des Bergbaus zurückstehen.
Sicher, das sei »eine gigantische Herausforderung«, sagt Wirtschaftsministerin Busch – um das Problem gleich vom Tisch zu wischen. »Seien wir ehrlich: Die Mine und ihre Möglichkeiten entscheiden über die Souveränität Europas und Schwedens.« Man habe hier die Gelegenheit, »Europa wieder groß zu machen«. »Make Europe great again«, sagt sie in Anspielung auf die MAGA-Bewegung von US-Präsident Donald Trump. Von ein paar Tausend Rentierhaltern, so die implizite Botschaft, könne man sich da nicht aufhalten lassen.
Die Zeit drängt. Laut den Zielen, die sich Europa selbst gesetzt hat, muss die EU bis zum Jahr 2030 zehn Prozent ihres jährlichen Bedarfs an kritischen Rohstoffen selbst fördern, 40 Prozent auf ihrem Gebiet verarbeiten und 25 Prozent recyceln. Zudem dürfen nur maximal 65 Prozent des jährlichen Bedarfs eines jeden strategischen Rohstoffs aus einem einzelnen Nicht-EU-Land stammen.
Von diesen Zielen ist die EU weit entfernt. Die Verarbeitungsquote liegt derzeit bei 5 statt der angestrebten 40 Prozent, beim Recycling sind es 10 statt 25 und bei der Förderung 2 statt 10 Prozent. Wie diese gigantischen Lücken innerhalb von gut vier Jahren geschlossen werden sollen, kann weder die EU-Kommission noch das Bundeswirtschaftsministerium schlüssig erklären. So viel zur dritten Möglichkeit, auf die Macht Chinas zu reagieren und eigene Förder- und Raffineriekapazitäten aufzubauen.
Selbst wenn Europa bürokratische Hürden im Eiltempo beseitigen würde: China hat Instrumente, auch diesen Ausweg zu versperren.
Von den neuen Exportbeschränkungen mal ganz abgesehen: Die Preise für seltene Erden kann China nach Belieben drücken – und damit europäische Minenprojekte verhindern oder in die Pleite treiben, womöglich selbst das in Kiruna. Europas Unternehmen seien »sehr preissensitiv«, sagt Tradium-Experte Giese – sie kaufen dort ein, wo es am billigsten ist. »Solange die Versorgung stabil erscheint, investieren viele nur zurückhaltend in Diversifizierung oder Vorratshaltung.«
Gegensteuern könnten westliche Regierungen mit Subventionen oder Mindestpreisen. Letzteres wurde bereits im Kreis der G7-Staaten diskutiert. Was sich die Industrie wünscht, sehen viele Ökonomen oder Handelspolitiker kritisch. »Europäische Unternehmen haben sich sehenden Auges in die Abhängigkeit von China begeben, um ihre Gewinne zu maximieren«, sagt Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament. »Warum sollten wir jetzt Steuergelder einsetzen, um das zu reparieren?«
Die Bundesregierung signalisiert Bereitschaft, in begrenztem Umfang zu helfen, etwa bei der Förderung von Lithium. Mit dem Rohstofffonds stehe ein Förderinstrument bereit, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche neulich. »Wo wir einen Beitrag leisten können, werden wir das dort tun«, sagte die CDU-Politikerin. Den Fonds hatte noch Reiches grüner Amtsvorgänger Robert Habeck eingerichtet. Er soll Projekte finanzieren, die die Versorgung mit kritischen Rohstoffen verbessern. Das Budget von insgesamt einer Milliarde Euro wird von der staatlichen KfW-Bank verteilt. Doch ein Jahr nach seinem Start hat der Fonds offenbar noch kein einziges Projekt unterstützt, erst zwei Projekte befinden sich in der »vertieften Prüfung«.
»Die Vorgaben des Fonds sind zu restriktiv«, sagt Matthias Wachter, der beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verantwortlich für Rohstoffe ist. Die Mindestgröße der förderfähigen Projekte liege bei 50 Millionen Euro. »Dadurch sind viele Anträge durchs Raster gefallen.« Oppositionspolitikerin Franziska Brantner, einst Parlamentarische Staatssekretärin unter Habeck und inzwischen Grünenvorsitzende, sagt: »Wenn man nicht bereit ist, auch ein Risiko einzugehen, wird man de facto nichts finanzieren.«
Zwischen Los Angeles und Las Vegas – gleich neben dem Mojave-Nationalpark – machen die USA vor, wie schnell es gehen kann, wenn alle Beteiligten mitziehen. Mit schwerem Gerät wird in Mountain Pass gebuddelt und gegraben, gebohrt und gesprengt, um dem rotbraunen Boden seltene Erden abzutrotzen. Das Unternehmen MP Materials, vor gerade einmal acht Jahren gestartet, ist heute der größte Förderer und Verarbeiter von seltenen Erden außerhalb Chinas.
Mehrmals pro Woche ist in Mountain Pass »blast day«. Dann sprengen sie Gestein auf, das seltene Erden enthält, transportieren es mit gigantischen Radladern zum Brecher und reduzieren es zu pulverartigem Schluff. In der angrenzenden Raffinerie lösen sie mit allerhand Chemikalien schwere und leichte seltene Erden heraus: Neodym, Praseodym, Cerchlorid, Lanthancarbonat, Samarium, Europium, Gadolinium und Terbium. Die Grundzutaten werden nach Texas gekarrt, wo MP Hochleistungsmagnete für General Motors (GM) und Apple gießt, demnächst auch für das US-Verteidigungsministerium.

US-Abbaugebiet Mountain Pass: Die Marktwirtschaft darf mal Pause machen
Foto: Roger Kisby / DER SPIEGEL
F-35-Kampfjet: Mehr als 400 Kilogramm seltene Erden
Foto: Jack Guez / AFP10.000 Tonnen Magnete pro Jahr will MP schon 2028 herstellen, die bestehende Fabrik erweitern, eine neue gleich daneben errichten, zwei Milliarden Dollar investieren. »Das geht jetzt schnell«, sagt MP-Cheflobbyist Matt Sloustcher. Das Ziel: vollständig integrierte Lieferketten, kurze Wege und »eine chinafreie Lieferkette«.
GM und Apple garantieren dem noch jungen Unternehmen über Jahre die Abnahme eines Großteils seiner Produktion. Das US-Verteidigungsministerium ist gleich direkt eingestiegen, hat für 400 Millionen US-Dollar MP-Aktien gezeichnet und zugesichert, zehn Jahre lang die Produkte der Firma aufzukaufen – zum Festpreis. Die Marktwirtschaft darf in Mountain Pass mal Pause machen.
Dass die Lage ernst ist, erkennen auch die Fachleute in den USA. Als China Anfang Oktober seine neuen Restriktionen verkündete, warnte das renommierte Washingtoner Center for Strategic and International Studies vor einer »Bedrohung der Lieferketten der US-Verteidigung«. Modernes Kriegsgerät enthält seltene Erden in rauen Mengen. Für einen F-35-Kampfjet, der in Deutschland die alternden Tornado-Jagdbomber ersetzen soll, sind nach Angaben des Pentagons mehr als 400 Kilogramm seltene Erden nötig, für einen Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse fast 2,4 Tonnen und für ein U-Boot der Virginia-Klasse gar über vier Tonnen.
Auch Raketen benötigen Neodym, Praseodym und Samarium für Magnete und Dysprosium für Hitzeschilde, zur Zielführung und für ihre Kontrollsysteme, wie die Berliner Denkfabrik Merics auflistet.
Die Trump-Regierung legt daher ein ungeheures Tempo an den Tag, sich weltweit Rohstoffe zu sichern, etwa in Grönland oder der Ukraine. Mitte Oktober unterzeichnete Trump mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese ein neues Abkommen. Das Nachsehen könnten auch deutsche Rüstungsunternehmen haben.
Reden wollen sie über ihre missliche Lage ungern. Ein Sprecher von Rheinmetall erklärt kryptisch: »Wir haben verschiedenste und sehr ausdifferenzierte Lieferquellen aus allen Teilen der Welt.« Das aber dürfte sich kaum auf seltene Erden beziehen. Denn die stammen in Deutschland nach Informationen von Merics zu 95 Prozent aus China. Macht die Volksrepublik ihre Ankündigung von Anfang Oktober wahr, die Exporte weiter zu beschränken, dürfte Rheinmetall als Rüstungsbetrieb eigentlich gar keine seltenen Erden mehr aus China bekommen. Der Düsseldorfer Konzern äußert sich nicht dazu.
Die Merics-Experten erwarten, dass auch die von der EU beschlossene Aufrüstung gegen die Bedrohung aus Russland unter dem Mangel an seltenen Erden leiden wird. »Bergbau- und Verarbeitungsprojekte dauern gewöhnlich bis zu 15 Jahre«, schreiben sie. Und leider habe ein EU-Programm für die Beschaffung kritischer Rohstoffe noch kein einziges Projekt öffentlich gefördert.
Hilfe für die Europäer könnte aus Brasilien kommen. »Deutschland und die EU müssen risikobereiter werden, wenn es um die Erschließung und Absicherung von Rohstoffprojekten geht«, sagt Stefan Steinicke, Rohstoffexperte beim BDI. »Ansonsten werden wir im Großmachtkonflikt zwischen den USA und China zerrieben werden.«
Unweit der Stadt Poços de Caldas, im Innern eines vor 80 Millionen Jahren erloschenen Vulkans, steht ein Bohrgerät. Das Gestänge dreht sich und fördert das fein gemahlene Erdreich aus der Tiefe, das schließlich in einem Plastiksack landet. Ein Arbeiter beschriftet ihn sorgfältig und hängt den nächsten Beutel in die Maschine.
Klaus Petersen beobachtet das Geschehen aus ein paar Metern Entfernung. »Der Bohrkopf ist jetzt bei ungefähr zehn Metern«, sagt er. In dieser Schicht stecke besonders viel von jenen seltenen Erden, auf die es Viridis, ein australisches Bergbauunternehmen, abgesehen hat. »Das ist unser Gold!«, sagt Petersen.

Geologe Petersen in Brasilien: »Das ist unser Gold!«
Foto:Gerald Traufetter / DER SPIEGEL
Der 61-Jährige, in Brasilien geboren und in Deutschland aufgewachsen, arbeitet für Viridis, das vom Bundesstaat Minas Gerais Lizenzen zur Suche nach seltenen Erden erworben hat. Die Lagerstätte in dem Vulkan sei »gewaltig«, sagt Petersen. »Wir haben große Zuversicht, hier schon im Jahr 2028 seltene Erden abzubauen.«
Petersen steigt in seinen Geländewagen und fährt zu einer Anhöhe. Von oben sind die Umrisse des alten Kraterrands zu erkennen. Die Caldera misst 30 Kilometer im Durchmesser, das Magma war alkalisch. Es sei reich an seltenen Erden und habe sich in den Millionen Jahren in Ton verwandelt, sagt Petersen. »Das ist der Vorteil gegenüber den meisten anderen Abbaustellen.«
Gewöhnlich stecken seltene Erden in hartem Gestein. Es muss gesprengt, zertrümmert und gemahlen werden. Dann werden Hitze und extrem aggressive Säuren benötigt, um das Oxid herauszulösen. »Die meisten dieser teuren und umweltschädlichen Verfahren können wir uns sparen«, sagt Petersen. Eine milde Salzlösung bei Umgebungstemperatur reiche aus.

Mine im brasilianischen Bundesstaat Goiás: Präsident Lula da Silva will Brasilien zum Seltene-Erden-Exporteur machen
Foto: Eraldo Peres / AP / dpaViridis hat sich zusammen mit einem anderen australischen Unternehmen die größten Flächen gesichert. Das Projekt genießt höchste Priorität, in Minas Gerais und auch in der Hauptstadt Brasília. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will sein Land zu einem der größten Seltene-Erden-Exporteure der Welt machen. Rund 20 Prozent der weltweiten Reserven sollen in dem südamerikanischen Land liegen, einen Großteil davon vermutet Petersen in dem erloschenen Krater, den er als ein »geologisches Einhorn« beschreibt.
Die Ersten, die bei Viridis an die Tür geklopft hätten, seien die Chinesen gewesen. »Mit denen würden wir sofort ins Geschäft kommen«, sagt Petersen. »Sie wollen uns 100 Prozent der Produktion abnehmen.« Aber das will Viridis nicht. Dort erwärmt man sich eher für die Europäer.
Verhandlungen unter anderem mit der deutschen KfW-Bank sind weit gediehen. Der französische Chemiekonzern Solvey und der Autohersteller Stellantis interessieren sich, Kontakte gibt es auch mit Vacuumschmelze, einem Magnethersteller aus Hanau. Das Interesse ist groß. Brasilien ist eine Demokratie und ein enger Handelspartner Europas. Es wäre eine echte Alternative.
Allerdings hat auch die US-Regierung inzwischen ein Auge auf die Mine in Brasilien geworfen. Denn sie enthält die Stoffe, mit denen hitzebeständige Magnete gebaut werden können, das vielleicht begehrteste Produkt mit seltenen Erden.
Europa muss sich beeilen. Doch Tradium-Fachmann Giese ist skeptisch: Die EU habe »weder eine langfristige Strategie noch die nötige Ausdauer, die Entscheidungskraft, das Know-how oder die finanzielle Power, um mit China oder den USA mitzuhalten«.
Das sei etwa so, als wolle man ein 100-Meter-Rennen gegen die Sprinterlegende Usain Bolt laufen. »Nur dass Usain Bolt schon gestartet ist und wir gerade erst feststellen, dass es ein Rennen gibt – für das wir nicht trainiert haben.«
Aber vielleicht müsste man einfach loslaufen.

 vor 2 Tage
2
vor 2 Tage
2








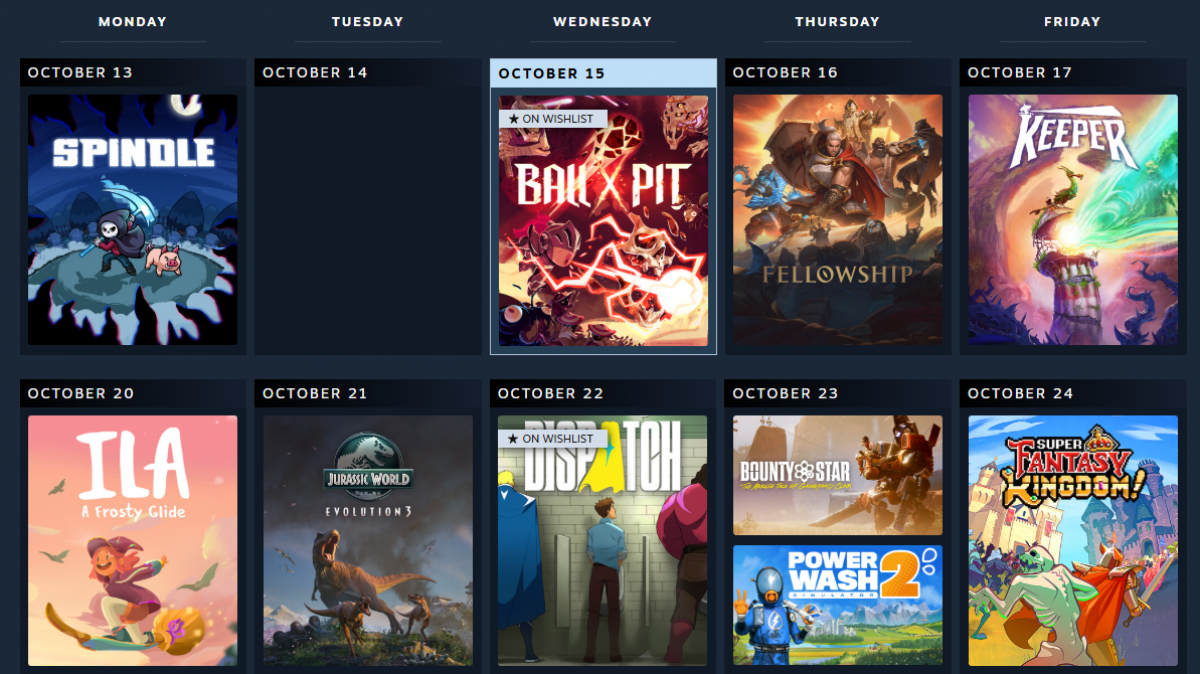


 English (US) ·
English (US) ·