Die Stärke von Kirill Petrenko als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker liegt gewiss nicht darin, dem Publikum durch massenmediale Strategien die Illusion menschlicher Nähe zum Künstler zu verkaufen. Er vermag vielmehr in der Kunst selbst etwas Exemplarisches zu leisten – und das mit solcher Evidenz, dass zumindest am Konzertabend zusätzliche Vermittlungsanstrengungen überflüssig werden.
Mit der einaktigen Oper „Francesca da Rimini“ von Sergej Rachmaninow, viel zu selten zu hören, jetzt konzertant in der Berliner Philharmonie zu erleben, gelingt ihm das wieder. Der 1906 uraufgeführte Einakter mag literarisch eine ungewöhnlich verdichtete Adaption des Canto V aus dem „Inferno“ Dantes sein, über die unglückliche Liebe zwischen Francesca Malatesta und ihrem Schwager Paolo, die durch den eifersüchtigen Ehemann Lanceotto entdeckt und zerstört wird. Rein musikalisch aber ist das Stück ein Essay über zwei Aspekte tonaler Schwerelosigkeit. Haltloses Stürzen – das ist die Hölle. Seliges Schweben – das ist die Liebe.
 Feinzeichner der Bosheit: Vladislav SulimskyMonika Rittershaus
Feinzeichner der Bosheit: Vladislav SulimskyMonika RittershausPetrenko entwickelt die Hölle aus den Seufzerfiguren von Klarinette, Horn und Bratschen, mit denen Rachmaninow den Klagegesang der Kraniche aufgreift, den Dante in den Versen 46 bis 49 des V. Canto beschreibt. Aber Petrenko übertreibt die Gestik des Seufzens und Klagens nicht. Wichtiger ist es ihm, das Fehlen eines tonalen Gravitationszentrums zur Wirkung kommen zu lassen. Nach einem Orchesterfugato, dem Rachmaninow Sinn und Richtung geraubt hat, stöhnt auch der Rundfunkchor Berlin, von Gijs Leenaars glänzend vorbereitet, wie die Kraniche. Nicht nur diese kreatürliche Schuldgemeinschaft zwischen Vögeln und Menschen ist eindrucksvoll, auch die Verbindung von tierischer Vorsprachlichkeit und höllischer Nachsprachlichkeit.
Dann erst fangen Ilia Kazakov als Vergils Schatten und Dmitry Golovnin als Dante an, sprachgebunden zu singen. Ihr Gesang markiert den Grenzgang der Kunst, der Hölle ausgesetzt und ihr zugleich enthoben zu sein.
Fliegenkönnen neben der Spur
Komponiert Rachmaninow in der Hölle das Stürzen nach allen Richtungen durch Schwächung des tonalen Gravitationszentrums, so gestaltet er im Liebesduett zwischen Francesca (der extrem lyrischen, überaus zarten Galina Cheplakova) und Paolo (dem ebenfalls äußerst grazilen Dmytro Popov) das Schweben als Verweilen auf diatonischen Dissonanzen bei klarem Zentrum in Dur. Die Harmonik steuert Nebenstufen und Varianten innerhalb der Tonleiter an, ohne aber den Bezug zum Mittelpunkt des tonalen Systems aufzugeben. Schweben – das besingen die Liebenden auch – ist ein selbstbestimmtes Fliegenkönnen „neben der Spur“.
 Kirill Petrenko (vorn links) mit den Solisten, den Berliner Philharmonikern und dem Rundfunkchor Berlin.Monika Rittershaus
Kirill Petrenko (vorn links) mit den Solisten, den Berliner Philharmonikern und dem Rundfunkchor Berlin.Monika RittershausPetrenko forciert die expressiv-gestischen Anteile dieser Musik niemals. Er friert sie aber auch nicht ein. Den Singenden macht er es durch Zurückhaltung leicht. Sie müssen nicht laut werden, können die Vielfalt situationsbezogener Stimmfärbungen über die Kraftanstrengung stellen. Vladislav Sulimsky als Lanceotto Malatesta kann dessen Herzensfinsternis mit feinster Nadel radieren, ohne Brüllklischees der Bosheit zu bemühen.
Petrenko balanciert dazu die großen Zusammenhänge – den Gegensatz von Hölle und Seligkeit als Frage tonaler Gravitation – hervorragend aus gegen die Details des Dialogs, worin er viel prosodische Flexibilität an den Tag legt.
Vorangestellt werden Rachmaninows Oper im Konzert das Adagio für Streicher von Samuel Barber und „Der Zorn Gottes“ von Sofia Gubaidulina. Bei Barber beweisen die Berliner Philharmoniker, dass sie die legendäre Legatokultur aus der Zeit Herbert von Karajans noch immer beherrschen: Die Trauermusik ist ein fast zäsurloser einziger Fluss. Und auch die Magie, den exakten Punkt der Klangwerdung am Anfang im Unklaren zu lassen, die Grenzdefinition zwischen „noch nicht“ und „schon jetzt“ zu vermeiden, beherrschen die Musiker wie vor fünfzig Jahren.
In Gubaidulinas vier Jahre altem Stück ist freilich genau das Gegenteil gefragt: Präzision klarer, prägnanter Setzungen. Im Knarren der Kontrabässe, der Tuben und Posaunen beschreibt Petrenko gleich am Anfang das Aufreißen des Raumes. Das Gähnende und Klaffende, das hier plastisch beschrieben wird, ist die Wortbedeutung von „Chaos“. Der Zorn Gottes stößt die Welt in den Zustand zurück, aus dem er sie erschaffen hatte.

 vor 13 Stunden
1
vor 13 Stunden
1


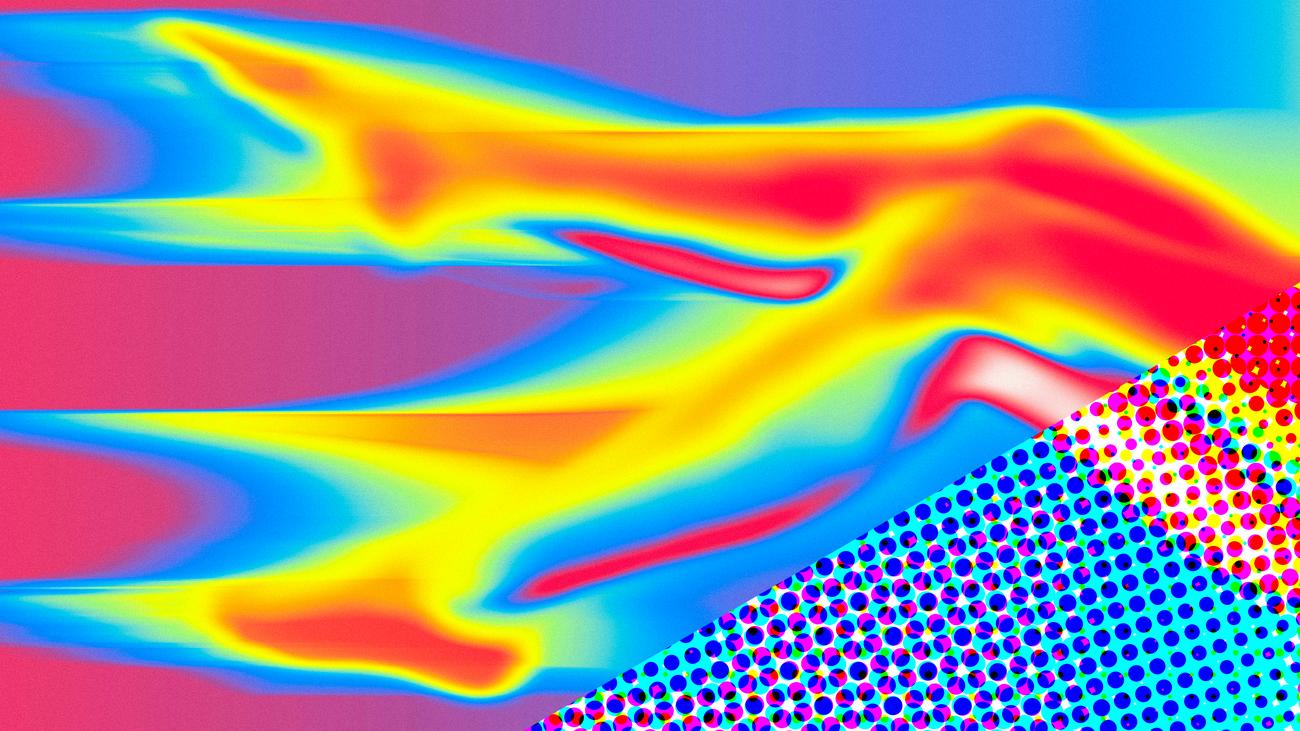








 English (US) ·
English (US) ·