Nach dem Vorbild der Desinformationsplattform X, die Elon Musk aus Twitter gemacht hat, will nun auch Meta die Maßnahmen zurückfahren, mit denen das Unternehmen bisher gegen „hasserfülltes Verhalten“ vorging, wie der Konzern es in den neuen Richtlinien nennt. Darin fehlen nun nicht nur Passagen, die zuvor zum Beispiel explizit untersagten, Frauen als Haushaltsgegenstände zu bezeichnen oder Transpersonen als „es“. Man findet auch Ergänzungen, die sich wie eine Einladung zur Beschimpfung lesen: Ausdrücklich erlaubt sind nun etwa „Unterstellungen von psychischer Erkrankung oder Anomalien, wenn sie auf geschlechtlicher oder sexueller Orientierung basieren“. In der Begründung geht Meta dann gleich selbst mit schlechtem Beispiel voran, indem es im Jargon rechter Kulturkämpfer auf den „politischen und religiösen Diskurs über Transgenderismus und Homosexualität“ verweist.
Auch wenn sich Metas Versuche, auszubuchstabieren, was überhaupt als Hatespeech gelten soll, schon immer wie der hilflose Versuch lasen, die Willkür der Eingriffe durch anschauliche Beispiele nachvollziehbar zu machen, wirken die Änderungen wie eine Verhöhnung besonders angreifbarer Gruppen. Besonders problematisch ist das neue laissez faire im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass demnächst auf Facebook, Instagram oder Threads auch politische Beiträge wieder prominenter angezeigt werden, die man von 2021 an in den Hintergrund gerückt hatte, und zwar mit einem „stärker personalisierten Ansatz“, basierend auf den Likes und Views der einzelnen Nutzer. Denn gerade wenn es um politische Themen geht, sind Hatespeech und andere Formen digitaler Gewalt nie weit. Sie treffen aber nicht alle Teilnehmer am politischen Diskurs gleichermaßen, wie diese Woche eine neue Studie zeigte.
Langanhaltende psychische Schäden
„Angegriffen & alleingelassen: Wie sich digitale Gewalt auf politisches Engagement auswirkt“ heißt der Bericht, den die TU München in Kooperation mit der Menschenrechtsorganisation HateAid verfasst hat und der zeigt, wie drastisch die Auswirkungen für die Betroffenen sind. Das „Lagebild“ beruht auf einer Umfrage unter 1114 Personen, die politisch tätig sind, als Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitiker, Aktivistin oder Influencer, Wissenschaftlerin oder Journalist. 58 Prozent der Befragten haben schon einmal digitale Gewalt erlebt – ein in der Studie bewusst breit definierter Begriff, der nicht nur strafrechtlich relevante Anfeindungen beinhaltet, sondern auch nicht justiziable rassistische, antisemitische oder misogyne Äußerungen. Denn auch diese, so die Studie, könnten durch ihr „wiederholtes oder beinahe alltägliches Auftreten (…) tiefgreifende und langanhaltende psychische und soziale Schäden verursachen“.
 Eine Aktion der Menschenrechtsorganisation HateAid vor dem Berliner Bundestag, 15. Januar 2025Andreas Pein
Eine Aktion der Menschenrechtsorganisation HateAid vor dem Berliner Bundestag, 15. Januar 2025Andreas PeinDie Ergebnisse sind wenig überraschend, sie bestätigen einen seit Jahren sichtbaren Trend. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Frauen stärker von digitaler Gewalt betroffen sind (63 Prozent der Befragten, gegenüber 53 Prozent der Männer) und auf andere Weise: Öfter als Männer erleben sie negative Kommentare über ihr Aussehen oder bevormundende Äußerungen; fast einem Viertel der Betroffenen wurde schon einmal sexuelle Gewalt angedroht. Dass sie daher auch stärker zu „negativen emotionalen Reaktionen“ neigen als Männer, verwundert nicht: 82 Prozent der betroffenen Frauen fühlten sich „eingeschüchtert, gestresst, handlungsunfähig oder spürten körperliche Auswirkungen wie Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit“ (bei den Männern waren es 69 Prozent).
Die physischen Auswirkungen digitaler Gewalt
Wie belastend die ständige Konfrontation mit solchen Angriffen erlebt werden kann, wird auch in zwölf Interviews mit Studienteilnehmerinnen deutlich: „Ich habe immer Sorge, dass es ins Physische umschlägt“, sagt etwa eine Bundespolitikerin. Wozu sie, nach den Ergebnissen der Studie, leider auch gute Gründe hat: 71 Prozent derjenigen, die digitale Gewalt erfahren haben, haben auch schon analoge Angriffe erlebt, physisch oder als Sachbeschädigung, bei Frauen oft auch in Form sexueller Belästigung; bei den Befragten, die online verschont wurden, waren es nur 47 Prozent. Eine der beunruhigendsten Aussagen der Studie ist die Beobachtung, dass die Attacken daher leider oft auch ihr Ziel erreichen: 66 Prozent der betroffenen Frauen schränkten als Reaktion auf digitale Gewalt ihre Nutzung der sozialen Medien ein, passten etwa Ton oder Inhalt ihrer Beiträge an, deaktivierten ihren Account oder dachten sogar ans Aufhören.
Eventuelle Zweifel daran, ob sich vermeintlich virtuelle Angriffe in der physischen Realität auswirken, sollten solche Ergebnisse ausräumen. Genauso gut kann man an der aktuellen Studie aber auch erkennen, wie schwer das Problem der digitalen Gewalt in den Griff zu bekommen ist – nicht nur in der Praxis. Schon theoretisch ist es ein einziger Graubereich. Ob es etwa schon „digitale Gewalt“ ist, wenn man jemanden einen „Schwachkopf“ nennt, wie das zuletzt bei einer Diffamierung von Robert Habeck diskutiert wurde, ist ebenso schwer festzulegen wie die Grenze zwischen Verachtung und Kritik. Genauso komplex ist die Frage, welche Diskriminierungsmerkmale (wie Herkunft, Geschlecht oder Behinderung) als solche anerkannt sind: Gehört das Alter auch dazu? Oder der Dialekt? Und wer soll eigentlich darüber bestimmen, wo Unhöflichkeit endet und Anstiftung zur Gewalt beginnt? Der Besitzer einer Plattform? Ein Gericht? In Deutschland? In den USA? Oder in China?
Alles nur Ausdruck übertriebener Sensibilität?
Ein weiterer populärer Einwand ist, dass es sich bei digitaler Gewalt nur scheinbar um ein Problem handelt: Was früher vielleicht am Stammtisch stattfand, sei heute einfach nur besser sichtbar, die Diagnose einer allgemeinen „Verrohung der Gesellschaft“ nur Ausdruck einer gewachsenen Sensibilität – sowohl einer für das Thema (was die Zunahme der Meldungen und Anzeigen ja auch erklären könnte) als auch einer der Betroffenen: Wer in die Politik geht, dürfe eben nicht so empfindlich sein. Dass es vor allem Frauen sind, die unter dem giftigen Klima leiden, liegt aber, wie die Studie zeigt, nicht daran, dass sie so empfindlich wären; sondern dass sie nachweisbar überdurchschnittlich oft Ziel übelster Attacken werden.

Externer Inhalt von Opinary
Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen .
Wie aber kann man die Situation der Betroffenen verbessern? Die Ratschläge, die etwa HateAid in der Studie gibt, zielen weniger darauf ab, strengere Verbote zu erlassen oder die Meinungsfreiheit einzuschränken. Denn gerade politisch aktiven Personen ist bewusst, dass sie nicht nur Opfer digitaler Diskriminierung, sondern selbst auch auf den Schutz der Anonymität angewiesen sind. Schärfere Überwachung oder eine Klarnamenpflicht lehnt Hate AID daher klar ab. Die Lösungsansätze zielen eher auf parteiinterne Solidarität oder finanzielle und juristische Unterstützung in akuten Gefahrensituationen ab. Von den Behörden fordert man eine konsequentere Strafverfolgung und eine Ausweitung des Paragraphen 188 des Strafgesetzbuches. Das Gesetz, das 2021 als Reaktion auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verabschiedet wurde, stellt „gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung“ unter Strafe, erfasst aber nicht politisch engagierte Personen im weiteren Sinn wie Journalisten oder Aktivisten.
„Politikerbeleidigung“, ein Sonderrecht?
Eine solche Ausweitung wäre auch deshalb sinnvoll, um die Kritik derjenigen zu entkräften, die in dem neuen Straftatbestand der „Politikerbeleidigung“ ein Sonderrecht sehen, mit dem sich Abgeordnete vor Kritik wappnen wollten. Denn die traurige Pointe der „digitalen Gewalt“ ist, dass sie die Mächtigen genauso trifft wie die Marginalisierten. Beim Kampf gegen den Hass im Netz geht es daher weniger darum, einzelne Betroffene privilegiert zu schützen, sondern den Raum für den politischen Diskurs. „Gewalt gegen Personen des politischen Lebens ist kein privates Problem, sondern ein gesellschaftliches“, heißt es in der Studie.
Für den juristischen Umgang mit Beleidigungen ergibt diese Diagnose allerdings ein weiteres Problem – auch das konnte man an Habecks „Schwachkopf“-Beispiel sehen: Wenn es darum geht, grundsätzlich die Vergiftung des politischen Klimas und die Normalisierung solcher Äußerungen zu verhindern, erscheint das Vorgehen gegen eine solche Lappalie durchaus sinnvoll, selbst mithilfe von KI wie im Fall von Habeck. Die Grundvoraussetzung solcher Ehrschutzdelikte, darauf hat zuletzt auch Stefanie Schork in ihrer F.A.S.-Kolumne hingewiesen, ist aber das Empfinden eines Betroffenen, in seiner persönlichen Würde verletzt zu sein. Davon aber kann man schwer ausgehen, wenn Habeck erst durch die automatisierte Suche eines Dienstleisters auf die Diffamierung aufmerksam wurde.
Auch in den sozialen Medien geht es am Ende nicht nur um die Abwägung von Einzelfällen, sondern vor allem um eine Atmosphäre, in der sich alle Nutzer trauen, an gesellschaftlichen Debatten teilzunehmen. Dass sie nun zu einem eher lockeren Umgang mit Hatespeech übergegangen sind, kann man mit dem politischen Opportunismus von Elon Musk und Mark Zuckerberg erklären, unternehmerisch ist die Wende etwas rätselhaft. Bisher jedenfalls schien es vor allem eine ökonomische Devise zu sein, den Hass auf den Plattformen nicht herrschen zu lassen. Nun hat sich das Kalkül offenbar geändert. Schlimmer als die konkreten Änderungen ist daher das Signal: An jenen Orten, die einst vom Klima der Freundschaft lebten, kann sich nun niemand mehr vor Anfeindungen sicher fühlen.

 vor 14 Stunden
1
vor 14 Stunden
1


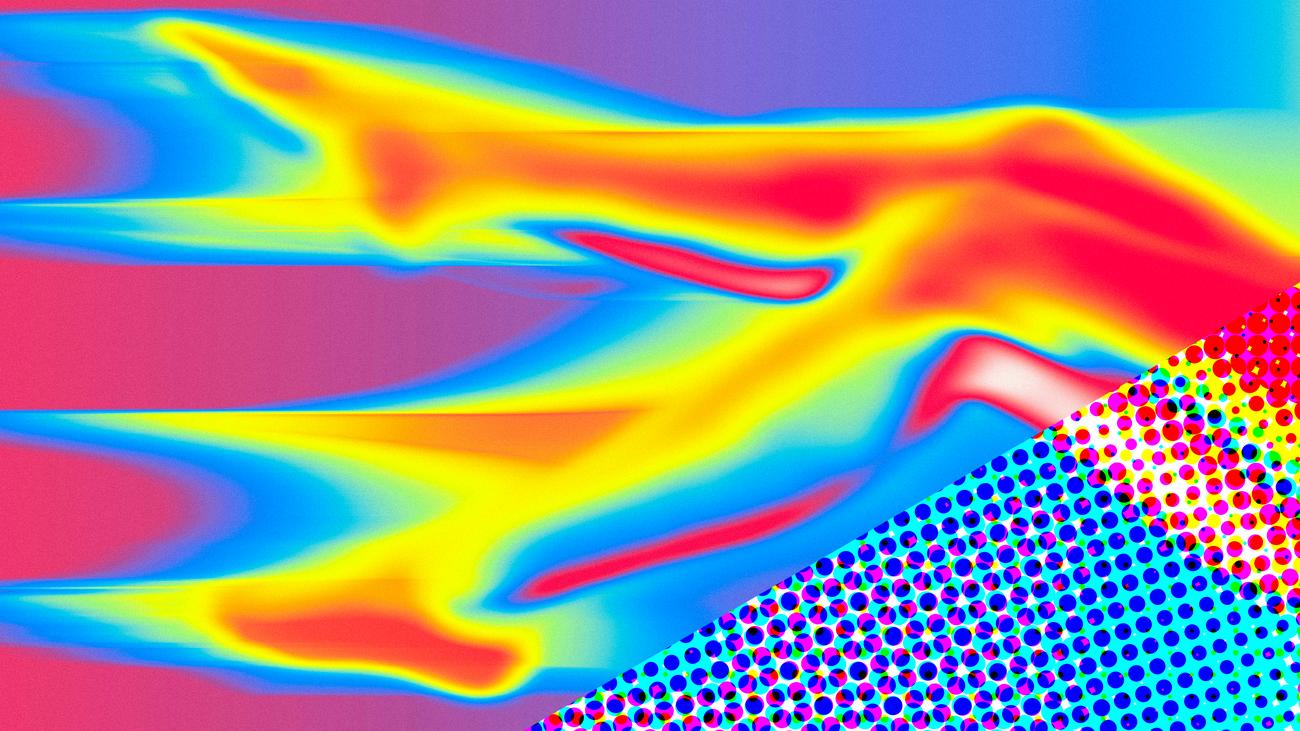








 English (US) ·
English (US) ·