Man muss mittlerweile mit Zeitgenossen leben, die verlauten lassen, dass sie angefasst sind. Es lernt sich natürlich im Nu, dass der angeprangerte Griff nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn zu nehmen ist: die Evokation eines realen Anfassens soll offenbar eine nicht näher bestimmte Betroffenheit zum Ausdruck bringen, und zwar gemeinhin keine angenehme (was im Wort selbst nicht steckt, man muss den „Erlkönig“ ja nicht als Modellverwendung nehmen). Wo das reichhaltige Lexikon der Wendungen schrumpft, mit denen sich mitteilen lässt, wie man zu Äußerungen steht, bleibt nur noch die Mitteilung, dass man durch sie irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde, ganz so, als ob die körperliche Integrität gelitten hätte.
Man ist also nicht irritiert, überrascht, gekränkt, verärgert oder dergleichen, sondern unbestimmt angefasst. Die „Angefasstheit“ ist im Sprachschatz von Sprechern, an denen die Konjunktur von Übergriffsvorhaltungen aller Art nicht spurlos vorübergegangen scheint, gut verankert. Sie wissen sich im Einklang mit dem Phrasenzeitgeist, der sich mit dem „Anfassen“ ja übrigens auch gutstellen kann. Wenn es nämlich als Adjektiv, also als „anfassbar“, zur Qualität einer Zugänglichkeit wird, die man hervorheben möchte (dann natürlich nicht als Element eines „locker room talk“).
Von „nah“ zu „da“
Vor einiger Zeit ließ etwa der Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wissen, dass ein medial umtriebiger Literaturkritiker mit einem neu geschaffenen Preis geehrt würde. Wie ihn also loben, diesen Mann, gerade für die Entschiedenheit, Literatur ins Fernsehformat gebracht zu haben? Das ist jetzt nicht mehr schwer zu erraten: Sein Verdienst sei es, so las man, „Literaturkritik anfassbar und nahbar gemacht zu haben“.
Warum es das Anfassen hier noch zusätzlich zum ohnehin schon etwas gefühligen „nahbar“ brauchte, ist nur durch die Einsicht zu erklären, dass Phrasen einander anziehen. In diesem Fall mit der Variante einer Steigerung, gewissermaßen von „nah“ zu „da“. Dass der Kritiker sein Metier und damit Literarisches den Hörern und Zusehern nahegebracht hat, das wäre gediegene Sprechweise. Aber sie genügt nimmermehr. Anfassbar muss er sie gemacht haben, obwohl doch „fassbar“ schon mehr als genug wäre. Der mittlerweile preisgekrönte Kritiker hätte angesichts solch entgleisten Lobs eigentlich Grund gehabt, etwas angefasst zu sein.

 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1


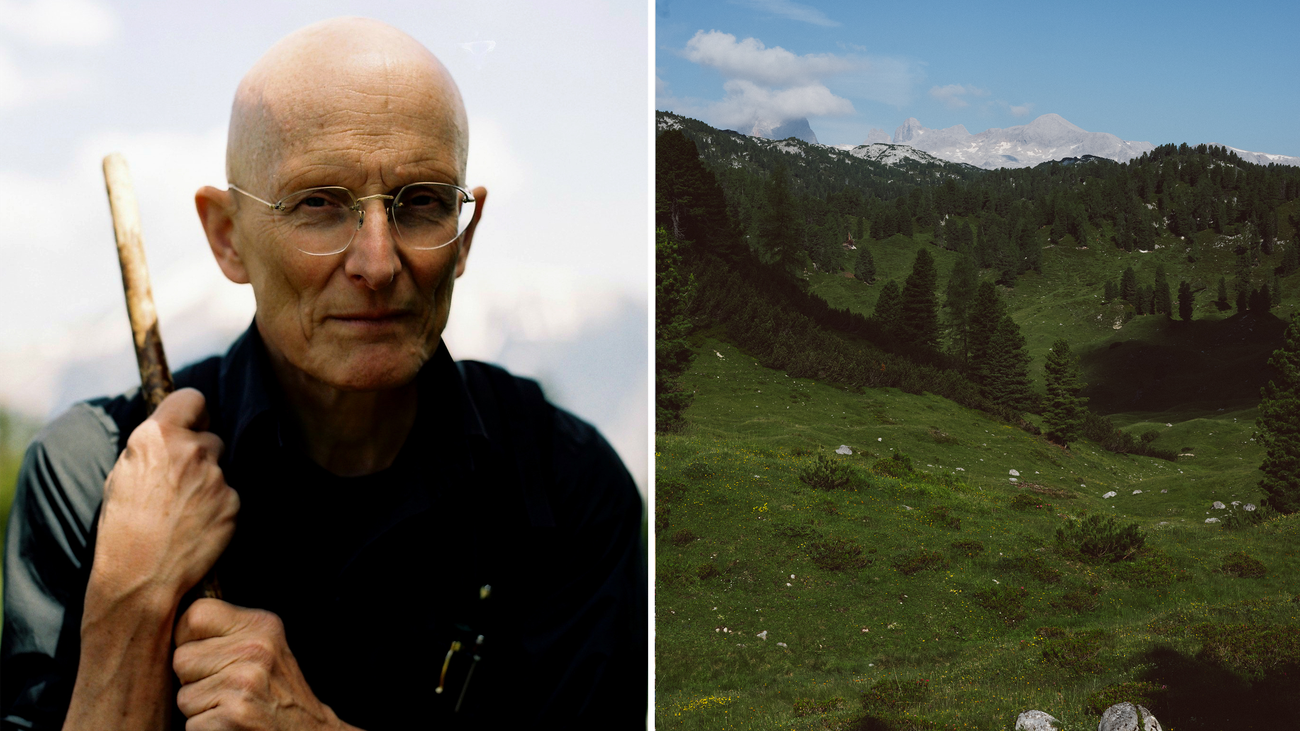








 English (US) ·
English (US) ·