Lars Klingbeil, 47, ist Parteivorsitzender der SPD und Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Dieses Interview basiert auf Auszügen eines längeren Gesprächs im Rahmen des ZEIT-Podcasts "Alles gesagt?". Die Auszüge wurden gekürzt, umgestellt und redigiert, um die Lesbarkeit zu verbessern. Hier geht es zur Originalaufnahme.
Redaktion: Carl Friedrichs, Sophie Hübner
DIE ZEIT: Herr Klingbeil, Sie haben in den vergangenen Wochen den Koalitionsvertrag für die SPD mit ausgehandelt. Wenn Sie darüber nachdenken, in welcher Welt wir uns gerade befinden, wird Ihnen da auch manchmal Angst und Bange?
Lars Klingbeil: Nein, Angst und Bange nicht. Aber während der Koalitionsverhandlungen hatte ich schon einen Moment, als ich zu Fuß nach Hause gegangen bin und dachte: Was machst du hier gerade? Du verhandelst die nächste Regierung der dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. In einer Zeit, in der der Krieg in der Ukraine tobt, Donald Trump Strafzölle auf den Weg gebracht hat und Domino spielt mit der Weltwirtschaft. Da wird einem die Größe der Aufgabe, vor der man steht, noch mal bewusst.
ZEIT: Wie anstrengend sind die Verhandlungen gewesen?
Klingbeil: Ich habe natürlich durchaus Momente gehabt, die mich extrem belastet haben. Jetzt am Ende der Koalitionsverhandlungen war ich echt durch.

Alles gesagt? - Der unendliche Interviewpodcast: Lars Klingbeil, können Sie Vizekanzler?
ZEIT: Ohne Ihnen zu nahe zu treten, bei der Pressekonferenz, die Sie gemeinsam mit Friedrich Merz und Markus Söder gegeben haben, hat man es Ihnen angesehen.
Klingbeil: Ja hat man. Ich habe mich auch so gefühlt, wie ich ausgesehen habe. Aber ich habe alles an Energie reingegeben und bin mit dem Verhandlungsergebnis total zufrieden. Mit der SPD haben wir da was rausgeholt, und das ist schon etwas, wo ich dann auch sehr stolz bin.
ZEIT: Einige Juso-Landesverbände kritisieren die angestrebten Änderungen in der Sozialpolitik. Wie sehen Sie da die neuen SPD-Positionen?
Klingbeil: Der Sozialstaat in Deutschland ist etwas, worauf wir stolz sein können. Die Bürgergeld-Debatte war am Ende geprägt von: Da ruhen sich Leute in einer Vollkasko-Mentalität aus. Das stimmt nicht für die Masse der Menschen, die Bürgergeld empfängt, und hat natürlich auch mit der politischen Debatte zu tun. Dann ist noch die Problematik mit den Menschen aus der Ukraine dazugekommen, die alle ins Bürgergeld gegangen sind. Dafür gab es gute Gründe, aber das hat eine ganz gefährliche Mischung gegeben. Ich habe das immer wieder auf den Veranstaltungen gemerkt, wo SPD-Wähler oder SPD-affine Menschen waren. Für die war das ein Thema, das uns ein Stück weit entglitten ist.
ZEIT: Inwiefern?
Klingbeil: Es gibt ein feinfühliges Gerechtigkeitsempfinden. Wenn die Pflegekraft für 2.500 Euro arbeiten geht und für sie das Leben teurer wird, dann ist es ein Verstoß gegen deren Gerechtigkeitsempfinden, wenn da jemand ist, der Geld vom Staat kriegt, ohne dass er sich anstrengt. Oder wenn die da oben immer noch mehr kriegen, das geht in beide Richtungen. Ich kann das übrigens nachvollziehen, meine Eltern haben teilweise zwei Jobs gemacht: Mein Vater einfacher Soldat, meine Mutter Verkäuferin, beide sind nebenbei noch Taxi gefahren, um sich einen Lebensstandard zu ermöglichen. Es gibt viele so fleißige Leute. Das Bürgergeld ist also nicht nur ein Problem, das die Union, wie ich finde, völlig überzogen thematisiert hat und es viele falsche Mythen gab. Das Thema hat bei meinen Veranstaltungen eine große Rolle gespielt, wie übrigens das Thema Migration auch.
ZEIT: Auch hier gab es Kritik aus der SPD.
Klingbeil: Für mich ist es immer wichtig, das Thema Migration ohne Ressentiments zu diskutieren. Ich glaube, jemand, der sich von sonst wo auf den Weg nach Europa macht, lässt seine Heimat nicht leichtfertig hinter sich. Aber dass wir in Deutschland nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen können, das ist einfach so. Und der Staat muss bei Rückführung und Integration gleichermaßen funktionieren. Das wollen die klassischen SPD-Wähler und das muss ich ohne Ressentiments sagen können. Und wenn eine Partei 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl bekommt, dann ist das Signal nicht: Ihr habt alles richtig gemacht. Sondern dann müssen wir uns fragen, wo wir Sachen falsch gemacht haben. Das war ein Signal an uns, Sachen anders zu machen. Deswegen ja, wir haben uns bewegt bei diesen beiden Punkten, aber ich kann das vertreten.
ZEIT: Halten Sie diese beiden Veränderungen inhaltlich für richtig – und zugleich strategisch für klug? Bisher konnten Sie sich bei diesen Themen auf die schwierigen politischen Konstellationen mit Ampel oder Union berufen.
Klingbeil: Ich will gar nicht zurückgucken, ich muss ja das Jetzt bewerten. Diese beiden Punkte brauchen eine kritische Reflektion in unseren Reihen, und es ist auch die Aufgabe eines Parteivorsitzenden, Sachen zu klären. Ich selbst habe immer wieder durchaus kritisch auf Elemente des Bürgergeldes geguckt, das werden Sie auch schon aus dem Wahlkampf von mir finden. Und beim Thema Migration geht es häufig am Ende gar nicht um die Menschen, die als Flüchtlinge hierhergekommen sind, sondern um die Frage: Wie funktioniert das Land? Es geht um Kitaplätze, Lehrer, Wohnraum, Integrationskurse und Infrastruktur. Das ist ein klassisches Investitionsthema.
ZEIT: Heftig diskutiert wurde auch der Satz aus dem Sondierungspapier, man wolle prüfen, ob Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft unter bestimmten Bedingungen leichter die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann.
Klingbeil: Da ging es um Terroristen, Antisemiten oder Extremisten. Als ich das Sondierungspapier gescannt habe, hätte ich nicht gewettet, dass ich für diese Stelle aus den eigenen Reihen auf die Nase bekomme. Aber nach der ersten Fraktionssitzung habe ich gemerkt: Den Satz muss ich rausbekommen. Ich habe dann junge Abgeordnete mit Migrationsgeschichte zu mir ins Büro eingeladen, weil ich das erstmal verstehen wollte. Die haben mir das Denken erklärt: Wie stark kann ich mich zu Palästina bekennen, oder für die Menschen in den palästinensischen Gebieten demonstrieren, ohne auf einmal als Antisemit oder Extremist zu gelten und meine Staatsbürgerschaft zu verlieren? Was machen wir denn, wenn nicht CDU und SPD, sondern andere mal das Sagen haben? Es gab eine Befindlichkeit, dass man am Ende aufgrund einer politischen Aktivität abgestempelt wird als Staatsbürger zweiter Klasse. Das ist so eine Kategorie, in der ich sozusagen als Bio-Deutscher nie gedacht hätte. Da habe ich wahnsinnig viel von jungen Kollegen mit Migrationsgeschichte gelernt. Man muss sehen, dass wir mit manchen Debatten Leute mit Migrationsgeschichte im politischen Diskurs verlieren. Und wenn wir ein starkes Land sein wollen, dann müssen wir als Einwanderungsgesellschaft funktionieren und uns diesen Fragen stellen.
ZEIT: Wie organisieren wir Migration, damit wir als Einwanderungsgesellschaft funktionieren?
Klingbeil: Reden wir mal nicht vom ganzen Bereich Flucht, sondern über Einwanderungspolitik. Ich finde, der Staat muss jedes Jahr festlegen, wie viele Leute wir hier haben wollen, und es denen als offenes Land schnell ermöglichen, hier anzukommen.
ZEIT: Bringt es dem Land mehr, wenn Person X oder Person Y einwandert, die gerade gesucht wird? Muss man festlegen, wer genau kommen darf?
Klingbeil: Genau, natürlich muss das nach unseren Interessen entschieden werden.
ZEIT: Und wie wägt man dann die Rechte, die im Grundgesetz stehen, dagegen ab? Wie kann man das vereinbaren, über eine Quote für Ethik?
Klingbeil: Wo verstößt es denn gegen das Grundgesetz, wenn unser Land sagt: Wir wollen festlegen, wen wir hier haben wollen und wie viele das sein sollen?
ZEIT: Es gibt ein grundgesetzlich festgeschriebenes Recht, dass Menschen, die Asyl suchen, in Deutschland aufgenommen werden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Krieg in der Ukraine ausbricht, ist es Quatsch, dafür eine Quote festzulegen.
Klingbeil: Das eine ist ja das knallharte Interesse, gute Facharbeitskräfte haben zu wollen und dafür jedes Jahr eine Quote festzulegen. Das zweite ist, dass Leute nicht aus Gründen der Arbeitsmigration, sondern aus Fluchtgründen herkommen. Da können wir nicht sagen, es bricht ein Krieg aus, aber du darfst nicht kommen. In diesen Fällen muss schnell geprüft werden: Kann jemand hierbleiben oder nicht? Gibt es tatsächliche Gründe, Asyl zu gewähren? Dafür haben wir verabredet, sehr schnell die europäische Asylrechtsreform umzusetzen, damit endlich nicht nur wir, sondern ganz Europa Menschen aufnimmt. Aber das Eigentliche, worum es bei einer Einwanderungsgesellschaft geht, ist die Arbeitsmigration. Und da können wir die Regeln sehr klar festlegen.
ZEIT: Auch die Aufnahme von Menschen auf der Flucht ist komplizierter geworden. Im Koalitionsvertrag steht es ungefähr so: In Abstimmung mit den europäischen Partnern können auch mal Menschen an der Grenze abgewiesen werden. Das entspricht der Idee der Abkommen, die es schon gibt, die aber nie so richtig funktioniert haben.
Klingbeil: Das passiert heute schon. Aber nochmal: Das individuelle Recht auf Asyl werden wir nicht antasten. Dafür gibt es mit unserer Geschichte wichtige Gründe. Aber wir müssen besser werden, schnell klarzumachen, ob jemand hierbleiben kann oder nicht.

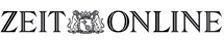 vor 7 Stunden
2
vor 7 Stunden
2











 English (US) ·
English (US) ·