Warren Brodey, der am 10. August im Alter von 101 Jahren in seinem Haus in Oslo verstarb, war vielleicht der einflussreichste Tech-Visionär, von dem Sie noch nie gehört haben – ein Psychiater, der zum Kybernetiker wurde und dessen radikale Ideen über reaktionsfähige Technologien in den 1960er-Jahren unsere digitale Gegenwart mitgeprägt haben, wenn auch nicht in einer Weise, die ihm gefallen hätte. Seine Geschichte liest sich wie ein Cyberpunk-Roman: von der CIA finanzierte Experimente mit übersinnlicher Wahrnehmung, ein Computerlabor, das gleichzeitig das weltweit erste Tech-Start-up war, intellektuelle bromances mit Marshall McLuhan und Gregory Bateson und ein Lebensweg, der ihn vom MIT über eine norwegische Eisengießerei bis ins maoistische China führte.
Die Bedeutung von Brodey liegt jedoch nicht in diesen schillernden Details, sondern in einer grundlegenden Frage, die er vor einem halben Jahrhundert stellte: Sollte sich die Technologie an uns anpassen, oder sollte sie uns dazu anregen, uns zu entwickeln? Das Silicon Valley entschied sich für den ersten Weg und versorgte uns mit Algorithmen, die jedes unserer Bedürfnisse vorhersagen. Brodey setzte sich für den zweiten Weg ein – für Technologien, die „weich“ und reaktionsfähig sind, nicht um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um uns dabei zu helfen, Bedürfnisse zu entdecken, von denen wir nicht wussten, dass wir sie hatten.
Jazz statt Muzak
Als Nicholas Negroponte, der Brodey als „einen der frühesten und wichtigsten Einflüsse“ auf sein Denken bezeichnete, 1995 über eine Zukunft schrieb, in der „Ihr Interface-Agent jede Nachrichtenagentur und Zeitung lesen kann . . . und eine personalisierte Zusammenfassung erstellt“, griff er Brodeys Vision von responsiven Umgebungen auf. Aber wo Brodey Jazz sah – Improvisation, Überraschung, Wachstum –, hörten Negroponte und Silicon Valley Muzak: vorhersehbar, beruhigend, profitabel.
 Warren Brodey, Anfang der NullerjahreSammlung Familie Brodey
Warren Brodey, Anfang der NullerjahreSammlung Familie BrodeyIm Environmental Ecology Lab am Lewis Wharf in Boston, das Brodey 1967 gemeinsam mit dem Ingenieur Avery Johnson (dem Erben des Palmolive-Vermögens) gründete, begegneten Besucher dem wohl weltweit ersten Tech-Start-up im modernen Sinne – mit einem sehr gegenkulturellen Ethos und einer zutiefst experimentellen Atmosphäre. Ihre „Soft Control Materials“ – mit Gas gefüllte Kunststoffblasen, die je nach Temperatur ihre Form veränderten – schufen Oberflächen, die atmeten und auf Berührungen reagierten.
Brodeys Weg zum Techno-Propheten war nicht unbedingt erwartbar. 1924 in Toronto geboren, wurde er als Pionier der Familientherapie zu einem aufstrebenden Star der amerikanischen Psychiatrie. In seiner bahnbrechenden Arbeit wandte er kybernetische Prinzipien an, um Familiendynamiken als komplexe Systeme zu verstehen. Seine Arbeit mit begabten blinden Menschen für die CIA lehrte ihn, dass die menschliche Wahrnehmung radikal erweitert werden kann – eine Erkenntnis, die durch seine Teilnahme an LSD-Experimenten der Regierung noch verstärkt wurde.
Ein Haus aus Schaumstoff
1965 gab Brodey seine lukrative Praxis in Washington auf und nahm eine unbezahlte Stelle am MIT an. Sein Timing war so perfekt wie furchtbar. Der Vietnamkrieg eskalierte, und Brodey sah mit Entsetzen, wie Militärausgaben seine Vision korrumpierten. „Das ganze Geld fließt in Technologien zum Töten“, schrieb er in sein Tagebuch. „Diese Umgebung ist böse.“
Das Labor zog in einen alten Steinbruch in New Hampshire um, der als Kommune mit fungierte, in der das Tragen von Kleidung optional war und der Persönlichkeiten wie einen Rüstungsberater anzog, der den größten Teil einer Interkontinentalrakete in Brodeys Gästezimmer zusammenbaute. Brodey baute sich dort ein Haus aus Schaumstoff – nicht nur als Ort zum Nachdenken, sondern als seinen tatsächlichen Wohnsitz, der seine Philosophie verkörperte, dass Architektur weich, reaktionsfähig und lebendig sein sollte.
 Warren Brodey in den frühen 1960er JahrenSammlung Familie Brodey
Warren Brodey in den frühen 1960er JahrenSammlung Familie BrodeySeine Ideen verbreiteten sich über Untergrundkanäle wie die Zeitschrift „Radical Software“, Gespräche mit McLuhan und Bateson oder als Mentor junger Denker wie Negroponte. Doch während Negroponte durch die Anpassung von Brodeys Ideen an die großen US-Konzerne berühmt wurde, entschied sich Brodey selbst für das Exil. Er zog 1972 nach Norwegen, wandte sich dem Maoismus zu und arbeitete jahrelang als Hilfsarbeiter in einer Eisengießerei, wo er Jøtul-Holzöfen herstellte. Dabei verbarg er seinen bürgerlichen Hintergrund als Arzt vor seinen Kollegen und verbot seinen Kindern, den wahren Beruf ihres Vaters preiszugeben. 1980 lehrte er in China „biologische Kybernetik“, um schließlich auch davon desillusioniert zu werden, was er als eine weitere Version der mechanistischen Gesellschaft betrachtete, vor der er geflohen war.
Die komplette Entfremdung
Brodey verstand, dass das eigentliche Problem nicht in solchen mechanistischen Vorstellungen der menschlichen Psyche lag, sondern dass der Kapitalismus selbst humanistische Technologie in großem Maßstab unmöglich machte. Sein Umzug ins sozialistische Skandinavien spiegelte diese Erkenntnis wider – der Warren Brodey von 1975, der Lenin und Mao studierte, hätte über die heutigen Vorschläge für einen „netteren“ Informationskapitalismus gelacht. Als ich ihn 2014 zum ersten Mal in Oslo traf – ein schicksalhafter Besuch, der zu einer jahrzehntelangen Reihe von Gesprächen und schließlich zu einem zehnteiligen Podcast führte –, gab er eine schonungslose Einschätzung der heutigen digitalen Landschaft ab: „Die Entfremdung ist zu diesem Zeitpunkt wirklich restlos komplett. Und der Computer hat einen riesigen Teil dazu beigetragen.“
Was Brodey verstanden hatte und was das Silicon Valley nicht wahrhaben will, ist, dass responsive Technologie ohne Sinn für die menschliche Entwicklung lediglich raffinierte Manipulation ist. Seine „weichen“ Maschinen sollten Partner in einem ökologischen Tanz sein, keine Diener, die unsere nächsten Schritte vorhersagen. „Wir sind gegen ein großes standardisiertes Netzwerk, das sich um die ganze Erde erstreckt“, erklärte Brodey 1971. Stattdessen stellte er sich Netzwerke vor, „die sich auf natürliche Weise organisieren, wie ein Feld oder eine Wiese“.
Dieses alternative Internet kam nie zustande. Stattdessen bekamen wir Negropontes „Daily Me“ – heute verkörpert in unseren Social-Media-Feeds –, wo Algorithmen uns genau das liefern, was wir wollen, bevor wir wissen, dass wir es wollen. Warren Brodey verbrachte seine letzten Jahrzehnte damit, zuzusehen, wie seine Albträume wahr und seine Träume monetarisiert wurden. Doch sein Vermächtnis lebt in einer einfachen, radikalen Frage weiter: Was wäre, wenn unsere Technologien uns helfen würden, uns selbst fremd zu werden, anstatt zu bestätigen, wer wir bereits sind? In einem Zeitalter der algorithmischen Selbstbespiegelung ist diese Frage dringender denn je.
Aus dem Englischen von Harald Staun

 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1



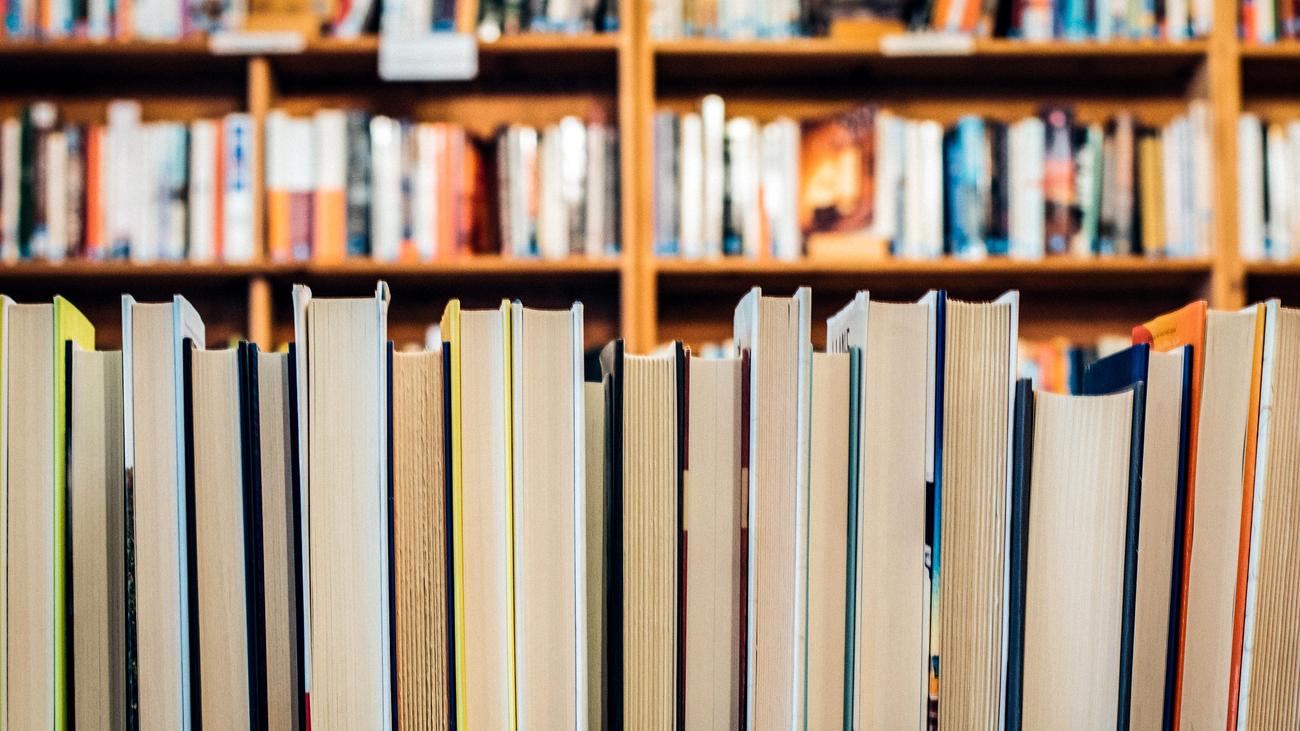







 English (US) ·
English (US) ·