Die Polizei erfasste im vergangenen Jahr 29.000 Messerangriffe – im Bereich gefährlicher und schwerer Körperverletzung war darunter ein Anstieg um fast elf Prozent. Wie erklären Sie sich diesen Zuwachs?
Man kann das nur mit diesem Kreislauf erklären, der inzwischen entstanden ist. Insbesondere bei jungen Menschen sehen wir, dass einige aufgrund gestiegener Unsicherheiten glauben, sich mit einem Messer bewaffnen zu müssen, um sich im Notfall wehren zu können.
Sie bewaffnen sich also gar nicht, um jemandem zu schaden, sondern aus Angst?
Schülerbefragungen geben Hinweise darauf, dass sie Messer tragen, um sich bei einem Angriff verteidigen zu können. Und je mehr Menschen Messer tragen, desto mehr wollen sich auch davor schützen. Und das führt dazu, dass diese auch eingesetzt werden – im schlimmsten Fall mit der Folge schwerster Verletzungen oder gar des Todes.
Und warum nimmt dieser Kreislauf dann gerade jetzt so zu?
Das kann man nicht verallgemeinern. Einerseits ist eine Verrohung in der Gesellschaft zu beobachten. Das fängt in der Sprache an, etwa auch im Parlament. Dazu kommt, dass in den sozialen Medien jede Menge Videos kursieren, von denen eines brutaler ist als das andere. Das macht etwas mit jungen Menschen und ihrer Wahrnehmung der Realität.
Zuletzt verletzten häufig auch psychisch auffällige Menschen andere mit Messern.
Auch das ist keine Überraschung. Wir wissen auf der Grundlage von Gesundheitsdaten, dass die Zahl psychischer Erkrankungen zuletzt stark angestiegen ist. Und ein Messer ist ein Alltagsgegenstand, es ist für jeden frei verfügbar.
Für besonders hitzige Debatten sorgen oft Täter mit ausländischen Wurzeln. Welche Rolle spielt die Herkunft bei diesen Taten?
Die Farbe des Ausweisdokuments sagt nichts über kriminelle Neigungen aus. Aber bei Menschen mit Migrationsgeschichte bündeln sich oft verschiedene Risikofaktoren.
Messerverbotszonen sind dann eine Lösung, wenn sie auch konsequent kontrolliert werden.
Kriminologe Stefan Kersting
Welche sind das?
In der Regel junge Männer. Diese haben grundsätzlich ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko. Zudem leiden sie oft unter einer gewissen Perspektivlosigkeit, die ebenso zu einem höheren Risiko führt. Und man darf nicht vergessen, dass Menschen mit Fluchterfahrung während dieser oder auch in ihrem Herkunftsland schreckliche Dinge erlebt haben, die zu einer Belastungsstörung führen können.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind Menschen mit Migrationsgeschichte bei Messerkriminalität tatsächlich überrepräsentiert.
Für die Kriminologie erklärt sich das schlicht aus der Bündelung von Risikofaktoren. Würden dieselben Faktoren bei einem Deutschen vorliegen, wird der auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit kriminell. Jeder trägt natürlich eine persönliche Verantwortung für eine Tat, aber Kriminalität hat in der Regel soziale Ursachen.
Immer wieder werden von der Politik sogenannte Messerverbotszonen vorgeschlagen. Sehen Sie darin eine Lösung?
Auf jeden Fall. Messerverbotszonen sind dann eine Lösung, wenn sie auch konsequent kontrolliert werden.
Aber wer soll diese durchsetzen?
Einfach nur ein paar Schilder aufzustellen, bringt jedenfalls nichts. Deshalb müssen die Sicherheitsbehörden ermächtigt werden, an begrenzten Orten anlasslose Kontrollen durchzuführen. An Bahnhöfen etwa oder in klassischen Vergnügungsvierteln. Allerdings hilft das nur bei jenen Fällen, wenn jemand ein Messer trägt, um sich zu schützen. Wenn jemand gezielt Menschen verletzen will, schreckt ihn eine Verbotszone auch nicht ab.
Hat die Polizei denn die Kapazitäten, das auch noch zu übernehmen?
Das ist ein Problem. Die Polizei ist jetzt schon am Limit.
Messerangriffe führen zu einer erheblichen Verunsicherung in der Bevölkerung, das individuelle Sicherheitsgefühl sinkt. Was kann man dagegen tun?
Idealerweise objektive Sicherheit schaffen. Das heißt, wir müssen ganz früh mit der Prävention anfangen. Also schon in der Grundschule, indem man den Kindern beibringt, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und wir müssen Kindern und Jugendlichen den physischen Raum wieder näherbringen.
Was meinen Sie damit?
Der digitale Raum hat für Jugendliche eine immense Bedeutung, entsprechend empfänglich sind sie für Gewaltdarstellungen dort. Zugleich wissen sie immer weniger, wie man im physischen Raum Konflikte erkennt, wie man ihnen aus dem Weg geht und wie man sie gewaltfrei löst. Das muss man trainieren.
Aber reicht das, um den aktuell steigenden Zahlen zu begegnen?
Wir müssen auch den steigenden Zahlen psychischer Erkrankungen entgegenwirken. Da ist auch das Gesundheitssystem gefragt, damit es da frühzeitig und niedrigschwellig Hilfe gibt.
Was erwarten Sie sich von der Politik, allen voran Innenminister Alexander Dobrindt?
Es muss dafür Sorge getragen werden, dass Waffenverbotszonen konsequent durchgesetzt werden – in besagten Vierteln, an Bahnhöfen, in Zügen. Da braucht es auch schlicht mehr Polizeipräsenz, denn diese hilft auch, ein individuelles Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

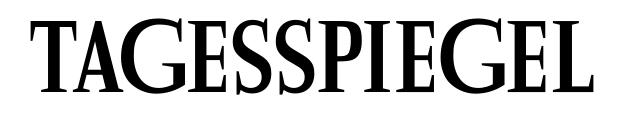 vor 7 Stunden
1
vor 7 Stunden
1










 English (US) ·
English (US) ·