Am Oberlandesgericht München hatte man für die „Aserbaidschan-Affäre“ schon Termine bis weit in die zweite Jahreshälfte geblockt. Doch im Verfahren um Korruption in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (Pace) könnte es nun schneller gehen als erwartet und schon Ende Juli zum Urteil kommen. Denn der Angeklagte Eduard Lintner (CSU), langjähriger Bundestagsabgeordneter und Europaratsdelegierter, hat in den vergangenen zwei Verhandlungstagen im Wesentlichen eingeräumt, was ihm die Generalstaatsanwaltschaft München vorwirft: Geld der aserbaidschanischen Regierung an Politiker weitergeleitet zu haben, die dann in Pace oder im Bundestag „aserbaidschanfreundliche Positionen“ vertreten sollten. Die Pace erarbeitet Empfehlungen für den Europarat, die nationalen Parlamente entsenden Delegierte in das Forum.
Lintner, in der Regierungszeit von Helmut Kohl Parlamentarischer Staatssekretär und bis 2010 Pace-Mitglied, arbeitete nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag als Lobbyist für Aserbaidschan. Bis 2016 soll er laut Anklage über ausländische Briefkastenfirmen mehrere Millionen Euro erhalten haben, die er zum Teil an andere Abgeordnete weiterreichte. Auch an die CDU-Politikerin Karin Strenz, die 2021 überraschend starb. Lebte sie noch, säße sie mit auf der Anklagebank. Sie soll insgesamt 150 000 Euro von Lintner bekommen haben.
„Ich habe das für die Art von Lobbyismus gehalten, die bis heute praktisch allgegenwärtig ist.“
Das Geld stammte zwar direkt aus Baku, wurde nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber über Lintner umgeleitet, um die Herkunft zu verschleiern. Dazu diente unter anderem ein mit monatlich 7500 Euro dotierter „vorgeschobener“ Beratervertrag. Dafür sollte Strenz von November 2014 an „in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Pace und als Mitglied des Bundestags in den für Aserbaidschan wichtigen Themen gemäß den Vorgaben Aserbaidschans tätig“ werden.
Die Anklage nennt das Bestechung. Was in diesem Fall besonders gravierend wäre, schließlich geht es um die Redlichkeit von Volksvertretern. Und um ein autoritär regiertes Land, in dem es mehr als 200 politische Gefangene geben soll. Lintner jedoch stellt sein Handeln als etwas ganz Normales dar: „Ich habe das für die Art von Lobbyismus gehalten, die bis heute praktisch allgegenwärtig ist.“ Ob das Geld direkt an Strenz gegangen sei „oder über uns, darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht“. Natürlich habe Strenz gewusst, dass das Geld „aus der Präsidentialkanzlei“ in Baku stamme. „Ich zahle der doch nicht aus eigener Tasche was.“ Er sei auch immer offen mit den Zahlungen umgegangen. Dass sie aus Aserbaidschan stammten, habe er aber nicht angegeben, widerspricht ihm der Vorsitzende Richter Jochen Bösl.
Lintner hatte die Vorwürfe gegen ihn vor Beginn des Verfahrens im Januar als „großen Unsinn“ abgetan. Die Freimütigkeit, mit der der Unterfranke plötzlich aussagt, erstaunt sogar die Staatsanwaltschaft. Vielleicht glaubt Lintner wirklich, nichts Unrechtes getan zu haben. Der 80-Jährige wirkt zerbrechlich, manchmal desorientiert. Aber wenn es um die Frage geht, warum er sich für Aserbaidschan engagiert, wird er wach und erzählt vom Unrecht, das dem Land durch den Verlust der Region Berg-Karabach geschehen sei, vergleichbar mit der deutschen Teilung.
Hat er nun ein Geständnis abgelegt? Lintner weist das zurück. Über die rechtliche Bewertung werde das Gericht befinden, informiert ihn Richter Bösl am Montag. Wenn man die Vorwürfe der Anklage einräume, sei dies eine geständige Einlassung und im Falle einer Verurteilung strafmildernd zu berücksichtigen.
Der Fall Lintner ist nur ein Beispiel für das Netz an Einflussnahme, das Aserbaidschan spannte
Das Verfahren in München beleuchtet nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Netz von intensiver Einflussnahme, das die aserbaidschanische Führung seit dem Europaratsbeitritt 2001 nach Ansicht von Experten über Westeuropa spannte. Dutzende im Europarat tätige Politiker aus mehreren Ländern sollen teure Geschenke erhalten und auf Reisen ans Kaspische Meer eingeladen worden sein. Im Gegenzug bescheinigten sie dem Land angeblich faire Wahlen oder stemmten sich gegen Verurteilungen der Menschenrechtslage in Aserbaidschan.
Lintner ist aktuell der einzige Angeklagte in München. Der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer soll ebenfalls Geld aus Aserbaidschan bekommen haben, ihm wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Das Verfahren gegen ihn musste nach mehreren Krankmeldungen des Angeklagten vom Hauptverfahren abgetrennt werden, es wird wohl im Herbst aufgenommen und dürfte schwieriger verlaufen. Denn anders als bei Strenz liegen keine Überweisungen vor, Fischer soll das Geld – im fraglichen Zeitraum etwa 26 000 Euro – laut Anklage in bar direkt aus Afghanistan erhalten haben. Der Politiker bestreitet alle Vorwürfe, wurde allerdings durch Aussagen von zwei weiteren Mitangeklagten schwer belastet.










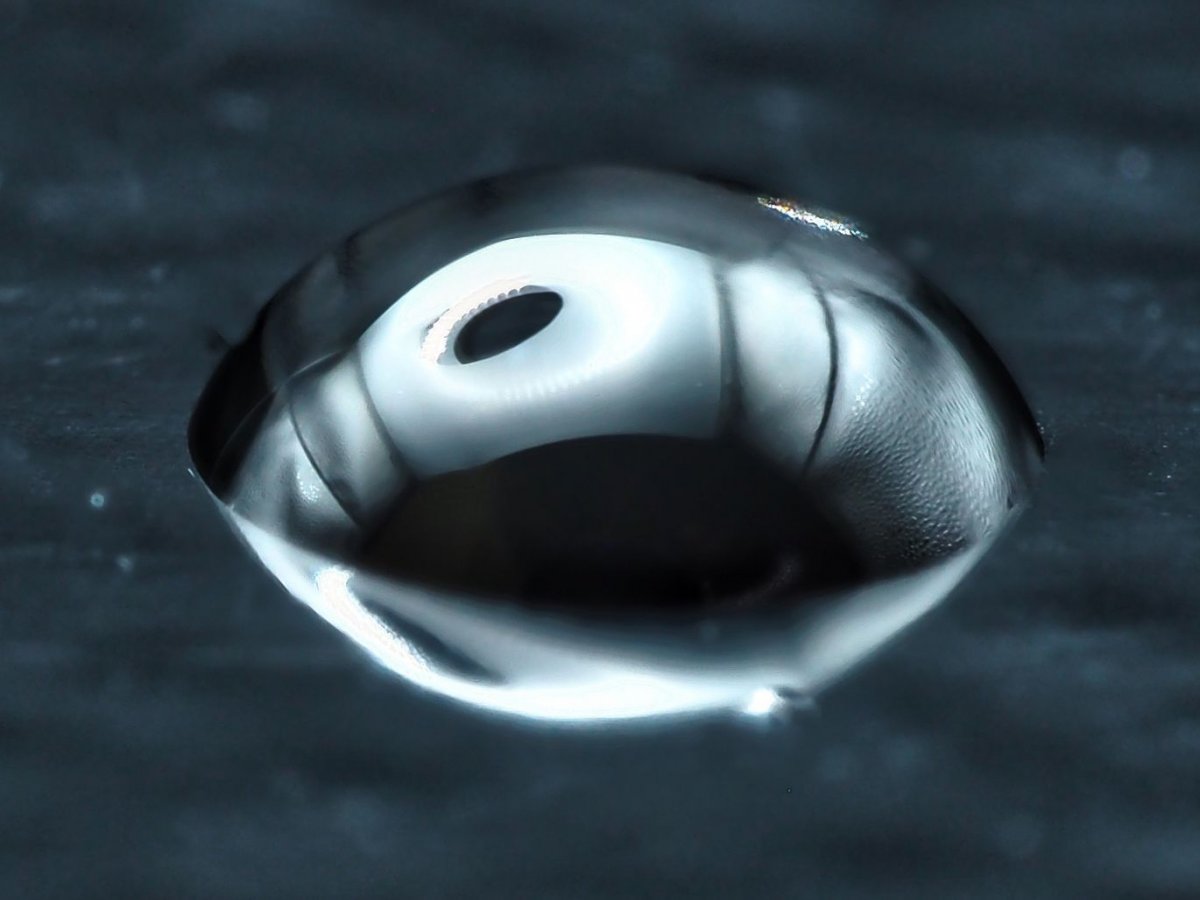

 English (US) ·
English (US) ·