Die Mehltüte kommt in die Papiertonne, der Joghurtbecher in die Plastiktonne. Die Müllabfuhr fährt morgen vor. Klappe zu, Gewissen gut. So handhaben viele Menschen in Deutschland und in anderen Ländern der nördlichen Hemisphäre ihren Abfall. Kaum jemand macht sich Gedanken, wo und wie der Müll tatsächlich entsorgt wird.
Der Reporter Alexander Clapp wollte es wissen. Er hat zwei Jahre lang in den Ländern des Südens die Spur des Wohlstandmülls aus den reichen Industriestaaten verfolgt. Sein Buch „Der Krieg um unseren Müll“ erzählt eine gruselige Geschichte, die alle Verbraucher kennen sollten.
Seit Jahrzehnten exportieren die wohlhabenden Länder einen Teil ihres Abfalls in Länder des Südens. In den Siebzigerjahren luden sie ihren Giftmüll dort ab, später folgten Plastik, Papier oder Elektrogeräte. Das Basler Abkommen aus dem Jahr 1989 sowie nationale und internationale Gesetze verbieten oder erschweren inzwischen den Export von Giftmüll in Entwicklungsländer. Trotzdem fliegen immer wieder Firmen auf, die umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe in armen Ländern abladen, wie zum Beispiel der Rohstoffhändler Trafigura.
Die Idee des Recyclings in armen Ländern funktioniert nicht
Das Schweizer Unternehmen lud laut Amnesty International im Jahr 2006 mehr als 540000 Liter Giftmüll auf 18 Deponien in der ivorischen Hauptstadt Abidjan ab. 15 Menschen starben. 100 000 klagten über massive Beschwerden. Trafigura hat das nie zugegeben, bezahlte aber 200 Millionen Dollar an die Regierung der Elfenbeinküste.
Anders als bei Giftmüll verbieten es die Gesetze nicht, Abfall wie Plastik oder Elektroschrott in die Länder des Südens zu exportieren. Im Gegenteil. Für diese Sorte Müll gibt es Abkommen zwischen reichen und armen Ländern. Der Müll soll auf der südlichen Hemisphäre recycelt werden, was wiederum arme Menschen in Lohn und Brot bringen und das Wirtschaftswachstum ankurbeln soll. Laut den Recherchen von Clapp geht diese Rechnung allerdings nicht auf.
So beschreibt der Autor etwa, wie ein Lastwagenfahrer Plastikmüll aus Europa in den Obsthain des kurdischen Bauern Izzettin Akman schmeißt und dort anzündet. Der Bauer löscht den Brand mühselig. Doch einen Monat später werden die Blätter der Bäume gelb und die Orangen und Zitronen fallen auf den Boden. Akman muss um seine Existenz fürchten.

Clapp kritisiert das Recycling von Plastik generell. Es handele sich dabei um eine „Lüge“. Denn anders als bei Papier oder Stahl enthalten Plastikprodukte viele verschiedene Stoffe. Dies mache reines Recycling unmöglich, so Clapp. Bei recycelten Plastikprodukten müsse stets neues Plastik beigemischt werden.
Ghana ist ein Zentrum für Elektroschrott
Clapp nennt in seinem Buch zahlreiche Beispiele dafür, wie Müll aus den Ländern des Nordens die Menschen, Tiere und die Natur in ärmeren Ländern schädigt. So schreibt er: „Nigerianische Kühe erstickten am Qualm, der bei der Verbrennung von Abfall-PCB aus einer Mailänder Autofabrik entstand“. Großen Raum im Buch nimmt auch die Elektroschrotthalde in Agbogbloshie ein, einem Vorort der ghanaischen Hauptstadt Accra. Ghana ist ein Zentrum für Elektroschrott, mit dem Segen der Regierung. Allerdings kümmert sie sich wie viele Regierungen in Entwicklungsländern wenig darum, ob Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Außerdem kommen die Regierungen nicht gegen die mafiösen Netzwerke an, die sich den Müllhandel zu eigen machen.
Die Banden der organisierten Kriminalität haben das Verschieben von Müll längst als gutes Geschäft entdeckt. Clapp zitiert Joseph Poux von Interpol: „Einige Gruppen steigen vom Drogen- und Waffenhandel auf den Müllhandel um. Das Geschäftsrisiko ist geringer, und die Gewinne sind größer.“ Die Spuren des illegalen Müllhandels seien mindestens so verworren wie die Spuren von Schwarzgeld, stellt Clapp fest.
Der Autor kritisiert vor allem die Ölindustrie
Lange Zeit hat China den Ländern des Nordens ihren Abfall abgenommen, insbesondere Plastik. Denn die reichen Staaten bezahlten gut dafür. Doch 2017 zog China die Notbremse, weil die Regierung die Umweltschäden für zu riskant hielt. Seither landet der Müll aus den Industrieländern in Afrika, Asien, Mittelamerika oder Osteuropa. Einige Müllhändler dort stammen aus China. Sie haben ihr Geschäft kurzerhand ins Ausland verlagert.
Der freie Journalist Clapp sieht die Sache mit dem Müll vor allem als ein Gerechtigkeitsproblem zwischen armen und reichen Ländern und als ein Problem des Kapitalismus, der künstlich Bedürfnisse bei den Konsumenten schaffe. Clapp kritisiert hauptsächlich die Ölindustrie, die immer mehr Plastik produzieren will. Das jüngst in Genf gescheiterte Plastikabkommen gibt ihm dabei recht.
In einzelnen Fällen führt Clapp sogar Müll-Projekte auf, die sich gar nicht nachweisen lassen. Sein Argument dafür: Worüber man nichts wisse, sei noch bedenklicher als die bekannten Betrügereien. Das trifft für die Müllbranche sicherlich zu. Doch diese Beispiele schmälern die Aussagekraft des Buches. Clapp hätte sie nicht gebraucht. Seine Recherchen zeigen die Tragweite des Müllproblems in eindrücklicher Weise.
Der Autor fordert eine öffentliche Debatte und mehr Aufklärung über die Abfallströme. Seine Hoffnung: Wer darüber Bescheid weiß, ist bereit zu handeln.










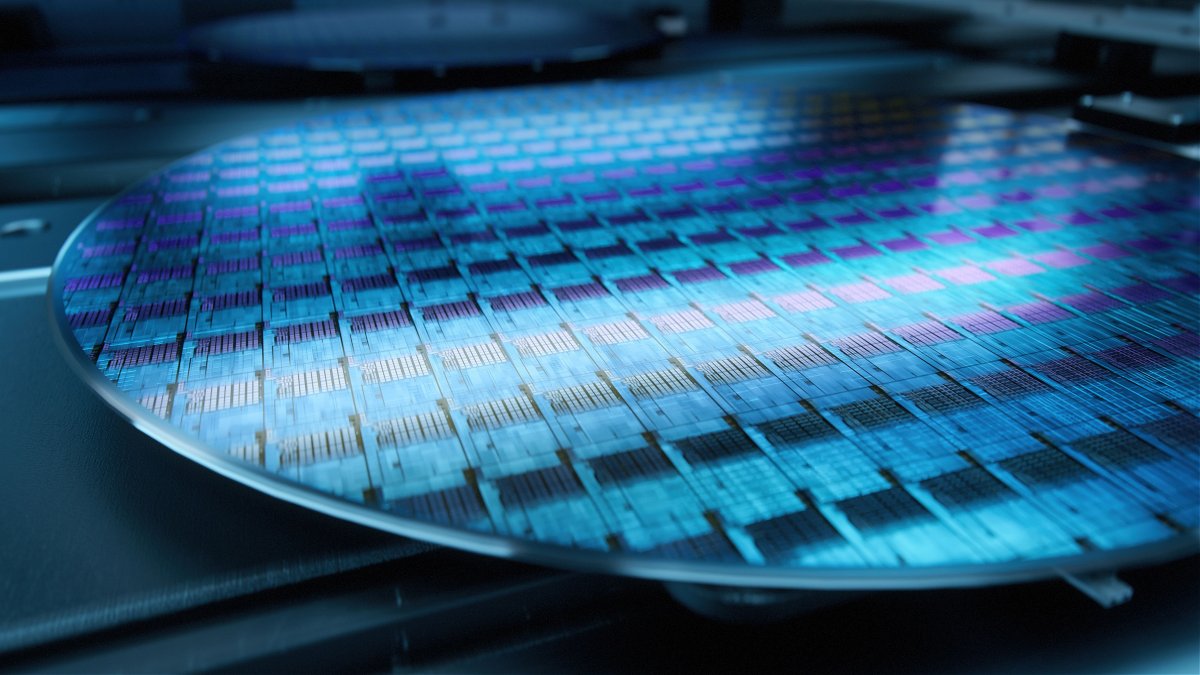

 English (US) ·
English (US) ·