Frau Haberlandt, was bedeutet der Satz: „Zieh uff Null die Pfütze“?
Das ist ein Trinkspruch. Was man im Glas hat, das ist die Pfütze, und die muss man auf Null ziehen. Ich bin sehr stolz auf diesen Satz, ich habe schon viele Runden damit erfreut. Aufgeschnappt habe ihn von einer Dramaturgin, die wie ich Ost-Berlinerin ist.
In Ihrem neuen Film „Wilma will mehr“ haben Sie mit diesem Satz eine schöne Szene. Er klingt fast ein bisschen literarisch, aber er könnte auch Volksmund aus der Lausitz sein. Wer ist diese Figur Wilma?
Wilma ist eine Frau aus der Generation meiner Mutter. Sie ist Jahrgang 1951. Sie ist in der DDR geboren und sozialisiert, hat im Kraftwerk gearbeitet. Der Film spielt Ende der Neunziger. Wir steigen ein, als sie schon arbeitslos ist und viele Umschulungen hinter sich hat. Dann findet sie heraus, dass ihr Mann sie betrügt.
Die Regisseurin Maren-Kea Freese hat sich lange in der Lausitz umgehört und mit Wilma so etwas wie ein Kollektivporträt einer Ost-Frau geschrieben.
Maren Kea-Freese ist ja aus dem Westen, hat aber wirklich gründlich recherchiert. Ich musste ihr nichts erklären. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, dann aber schnell begeistert, weil diese Figur so vielschichtig ist. Und trotzdem ist sie eine ganz normale Frau aus der DDR, die in der Mitte des Lebens, als es die DDR schon nicht mehr gibt, ihr Leben noch mal so richtig umkrempelt.
Wie kam Maren-Kea Freese auf Sie?
Sie hat mir erzählt, sie war im Theater und hat mich nach der Vorstellung noch in der Bar beobachtet. Ich hatte, was ich immer mache, meine eigene Stulle mitgebracht. Das gefiel ihr.
Viele Menschen bringen eine Stulle zur Arbeit mit. Sie auch. Obwohl es eine Kantine gibt?
Ich bin ja viel unterwegs und finde es schwierig, auf Essen angewiesen zu sein. Deswegen habe ich eine Brotzeit immer dabei.
Eine besonders gesunde Brotzeit?
Nein, ich bin jetzt auch nicht vegan oder so was. Lange habe ich gesagt, wenn mich jemand nach meiner Lieblingsspeise gefragt hat: Leberwurststulle.

Also sehr alltäglich. Wilma geht nach Wien. Die Stadt wird in Deutschland oft ein wenig verklärt. Von Ihnen auch?
Total. Wien ist für mich ein Sehnsuchtsort, ich fahre regelmäßig da hin. Wien ist fremd, hat aber etwas Ostiges. Ich fühle mich da mehr zu Hause als in den meisten deutschen Städten.
In „Wilma will mehr“ steht Wien auch für Reste von Hoffnungen auf Sozialismus. Für „das Gute an Marx“. Können Sie das etwas nachvollziehen?
Wir sind ja nach der Wende aus Berlin nach Hamburg gezogen, und meine Eltern hatten viele Freunde, die sich als links bezeichnet haben. Diese Freunde wollten immer hören, dass die Utopie stimmt. Menschen im Westen, die keine Ahnung hatten, was es wirklich hieß, in der DDR zu leben, hielten den Traum vom Sozialismus hoch. Das spiegelt sich in den Gesprächen von Wilma in Wien auch wieder.
Sie haben fünfzehn Lebensjahre in der DDR verbracht. Woran erinnern Sie sich?
Es gibt zwei Erzählungen. Meine Kindheit war sehr schön und unbelastet am Rand von Berlin. Trotzdem wusste ich über meine Eltern, dass das private und das öffentliche Leben zwei Dinge waren, und dass man dadurch zwei Gesichter haben musste. Ich wurde durch meine Eltern sehr geprägt, denn sie haben sich schon in der DDR nicht angepasst. So wurde ich ein sehr politischer Mensch. Ich frage immer: Wie kann man sich beteiligen? Der Umbruch war eine Befreiung, aber meine Eltern wurden relativ schnell arbeitslos, und mir war auch schon als junger Frau bewusst, dass das nicht gleichberechtigt zusammenwuchs.
Haben Sie sich schon in der Zeit der Wende an etwas beteiligt?
Zuerst bin ich bei Amnesty International eingetreten, ich war Gründungsmitglied in der kleinen Gruppe in Köpenick. Den Aufruf „Für unser Land“ von unter anderem Christa Wolf habe ich auch unterschrieben, das habe ich auch gegen meine Eltern vertreten. Ich hätte das damals interessanter gefunden, wenn die DDR ein eigener Staat geblieben wäre. Aber das war wahrscheinlich illusorisch.
Seit wann heißen Sie Fritzi?
Immer schon. Das steht so im Reisepass. Ältere Semester glauben oft, dass ich nach der Sängerin Fritzi Massary benannt wurde. Das gefällt mir, trifft aber nicht zu. Es ist toll, wenn man Namen nicht weiter abkürzen kann. Ich habe nie Spitznamen gehabt. Oft bekomme ich aber Post an Herrn Fritzi Haberlandt. Das nehme ich in Kauf.
Woher kam der Wunsch, Schauspielerin zu werden?
Schon gleich nach der Wende gab es einen Spielkurs in der Schule. Da hat es mich gepackt. Früher wollte ich Lehrerin werden. Schauspielerin ist etwas sehr Ähnliches. Ich versuche, den Menschen etwas zu erzählen. Die Schauspielschule Ernst Busch Berlin war dann zufällig die erste, an der ich mich beworben habe, und die haben mich gleich genommen.
 Fritzi Haberlandt (links) mit Meret Engelhardt und Simon Steinhorst in „Wilma wil mehr“.Steffen Junghans/Ma.ja.de Fictio
Fritzi Haberlandt (links) mit Meret Engelhardt und Simon Steinhorst in „Wilma wil mehr“.Steffen Junghans/Ma.ja.de FictioSo kamen Sie in eine Klasse, die heute legendär ist: mit Nina Hoss, mit Lars Eidinger, mit Devid Striesow.
Dass wir so unseren Weg gemacht haben, war schon unerwartet. Eigentlich waren wir ja für das Theater ausgebildet. Außerdem galten wir zwischenzeitlich als „schwacher“ Jahrgang.
Man erarbeitet in der Schule ja Szenen und Rollen, die werden dann vorgespielt, und wenn man da nicht so gut ist, kriegt man ein „Fähnchen“. Das ist der Jargon. Bei uns hatten einmal sieben Leute ein Fähnchen. Das ist irre viel. Insofern galten wir als schön wackelig, was lustig ist im Nachhinein.
Welche Bühnenrolle bedeutet Ihnen besonders viel?
Ein Höhepunkt war die „Lulu“ in Hamburg mit Michael Thalheimer. Das war eine Rolle, die andere mir nicht zugetraut haben. Auch mir war diese Figur zunächst fremd. Es war eine große Herausforderung und dann irgendwann auch Freude, ihr meine Sicht und meine Art zu geben.
Zum Kino kamen Sie auch schon früh.
Beim Abschlussvorsprechen an der Ernst Busch waren schon Casterinnen, da wurde ich gesehen. Und Rainer Kaufmann hatte den Mut, mich als Anfängerin in „Kalt ist der Abendhauch“ zu besetzen. Ich habe zuerst einfach so vor mich hingespielt. Rainer hat mich dann gefragt: Fritzi, weißt du eigentlich, wo die Kamera ist? Ich war immer verdeckt, weil ich gar nicht darauf geachtet habe. Ich habe mich wie auf der Bühne verhalten.
Ist Ihnen das Theater heute immer noch näher als Film und Fernsehen?
Die Bühne ist schon so ein bisschen meine Heimat. Da fühle ich mich autonomer. Das ist dann mein Raum, den kann ich bestimmen. Aber in einem Film Gedanken sichtbar zu machen, das ist auch ein großer Reiz. Es kommen aber nicht andauernd interessante Drehbücher. Ich bin Künstlerin und möchte Kunst machen. Im Moment spiele ich wieder mehr Theater, was mich sehr erfüllt. Und ich muss nicht warten, dass jemand mich besetzt.
Die Kultur am Theater hat sich stark gewandelt zuletzt, stimmt das?
Es hat sich verändert, auch in meiner Biographie. Ich habe mit tollen Regisseuren gearbeitet, gar keine Frage, aber der Umgang miteinander! Der ginge heute so hoffentlich nicht mehr. Jetzt habe ich mit der Regisseurin Anita Vulesica am Deutschen Theater gearbeitet. Es ist ein großer Unterschied für mich, ob da eine Frau sitzt. Das ändert alles, wie man arbeitet, wie man spricht, wie man sich wohlfühlt. Ganz anders als in einem männerdominierten Raum. Ich bin davon gerade sehr begeistert. Das war wie eine Offenbarung, dass man so miteinander arbeiten kann. Auf Augenhöhe.
Der Mythos war ja immer: Am Theater muss man an Grenzen gehen, dafür braucht es extreme Methoden.
Das ist doch eine Unterstellung, dass ich keine hundert Prozent gebe, wenn ich nicht angeschrien werde. Wir machen gemeinsam Theater, das ist die tollste Sache der Welt. Ich kann über Grenzen gehen, wenn ich mich sicher fühle. Ich hab schon relativ früh begriffen, dass nur ich wissen kann, wie mein Körper funktioniert, und wieviel ich ihm zumuten kann. Ich kenne ja auch viele Leute, die Rückenschäden oder kaputte Knie davongetragen haben.
Gibt es eine Traumrolle, die Sie noch nicht gespielt haben?
Die besten Rollen kamen immer so, dass ich nicht damit gerechnet habe. Aber Männerrollen würden mich interessieren. Ein klassischer Bösewicht. Alles, was nicht so leicht einzufangen ist und ins Extreme gehen kann.
Sie sind in einer Beziehung mit dem Regisseur Henk Handloegten, einem der drei Köpfe hinter der Serie „Babylon Berlin“. Da haben Sie wohl auch die letzten zehn Jahre stark mit drin gesteckt. Im Herbst kommt die letzte Staffel heraus.
Ja, ich habe das Projekt von Anfang an begleitet. Man sagte mir, dass die Idee, mich als Elisabeth Behnke zu besetzen, von Tom Tykwer kam, nicht von Henk.
Die Figur hat im Lauf der Jahre und Staffeln deutlich an Profil gewonnen.
Das Tolle ist doch: Erst einmal ist das eine ganz normale Frau mit dem Herz am rechten Fleck. Und dann wird sie in ziemlich große politische Affären hineingezogen und merkt, sie muss sich verhalten. Sie wächst kontinuierlich über sich hinaus. Innerlich hat sie sicher Angst, aber sie macht Sachen mit einer Coolness. Es gibt auch einen leichten Anflug von Komödie. Auch in der neuen Staffel wird es wieder einen Knaller geben.
Sie ist fast schon so etwas wie eine Widerstandskämpferin, noch vor dem Nazi-Regime.
Es gibt in dem ganzen Kosmos wenige Figuren, die gut sind. Bei ihr kann man sehen: Man hat immer die Wahl. Das sind ja alles einzelne Schritte, die sie macht;sie bleibt immer bei sich und hat einen großen Gerechtigkeitssinn.
Interessant ist auch, dass ihr Begehren eine Rolle spielen darf. Figuren wie Elisabeth Behnke waren ja jahrzehntelang asexuelle Matronen.
Es gibt in der ersten Staffel die Szene, in der Frau Behnke bei Gereon Rath im Bett ist. Nach dem Dreh gab es Diskussionen, ob das glaubwürdig ist und ob man das drinlässt. Ich war sehr froh, dass das nicht verworfen wurde, denn das gibt ihr eine Facette, die selten erzählt wird.
Was halten Sie von der Analogie zwischen den Dreißigerjahren und heute, die oft beschworen wird?
Lange hätte ich gesagt, man kann es nicht vergleichen, und wir haben ja jetzt auch die Erfahrung von damals, um es besser zu machen. Wir wissen aber auch, dass man schon mal gedacht hat: Wir haben das im Griff. Man kann nicht genug dagegen halten. „Babylon Berlin“ ist eine Serie über die Geschichte Deutschlands, die mittlerweile im Hier und Heute angekommen ist.
Sind bei Ihnen auch Freundschaften in die Krise geraten, wie bei so vielen Menschen, weil bei so vielen Themen in der öffentlichen Debatte unversöhnlicher Streit herrscht?
Für mich fing das mit Corona an, wo man zwei Wahrheiten hatte, und die kamen so gar nicht zusammen. Mittlerweile gibt es mehrere Themen, denen ich auch im privaten Umfeld eher aus dem Weg gehe. Weil ein Dialog schwierig geworden ist.
Sie haben sich in dieser Phase von den Grünen für die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten delegieren lassen. Welches Bekenntnis steckt da dahinter?
In der Pandemie gab es viele Kolleginnen, die mich zu Aktionen bewegen wollten, die ich zweifelhaft fand. Meine Reaktion darauf war: Ich wollte unbedingt in eine demokratische Partei eintreten. Bei den Grünen gab es die meisten Übereinstimmungen, auch wegen des Klimaschutzes. Ich finde da auch nicht alles richtig, aber das halte ich aus.
Ein Anker, denn es prasselt ganz ordentlich was auf einen ein die ganze Zeit.
Ich muss mich schon ein bisschen schützen. Wenn ich mich über jede Äußerung von Trump oder Merz aufrege, habe ich keine Kraft mehr. Ich versuche mich von dieser Hysterie nicht anstecken zu lassen.
Wo können wir Sie demnächst sehen?
Als nächstes beschäftige ich mich mit dem neuesten Roman von Miranda July „Auf allen Vieren“. Wir sind ein Theaterkollektiv von vier Frauen, zwei Regisseurinnen, zwei Schauspielerinnen und wir werden das Buch als Uraufführung in Berlin auf die Bühne bringen.

 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1






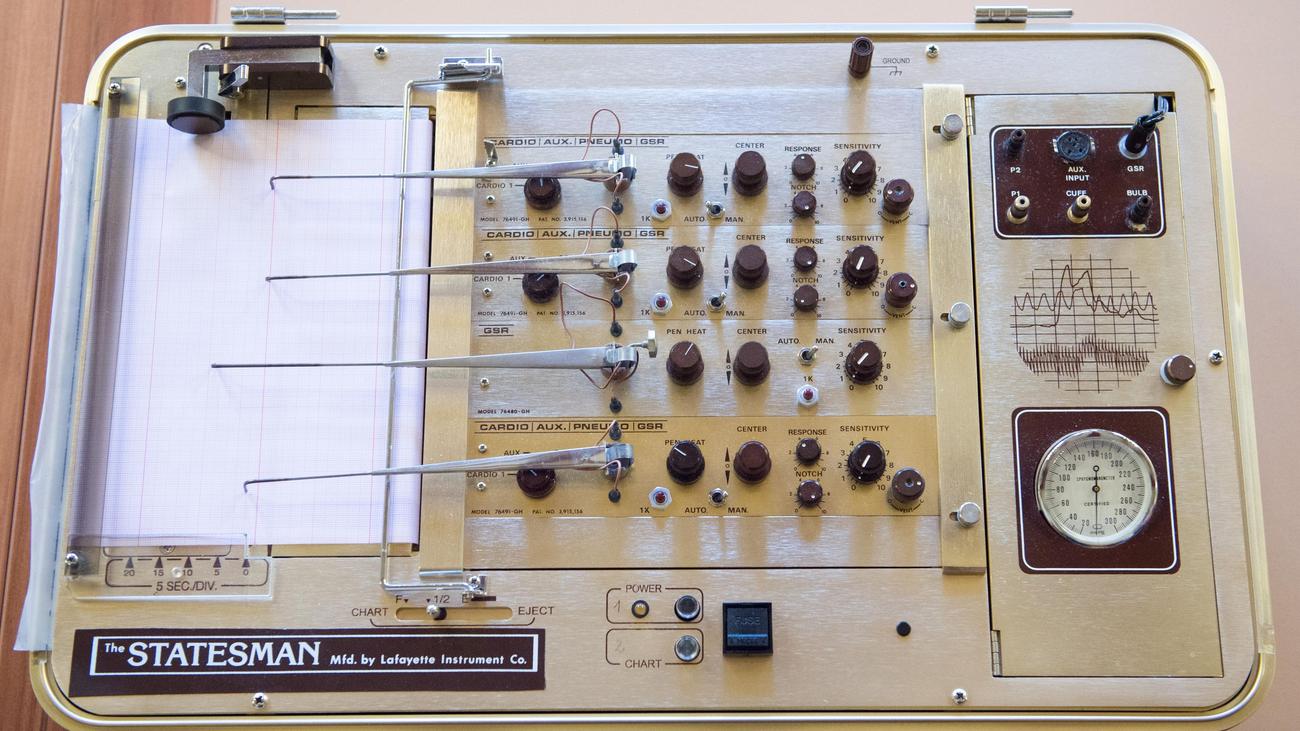





 English (US) ·
English (US) ·