Ein Schwabinger Einfamilienhaus, ehemals Wohnsitz der Familie Trautwein, ist durch die Heirat von deren Tochter Johanna, genannt Hanne, mit dem Schriftsteller Hermann Lenz zu einem bedeutenden Münchner Literaturort geworden, weil das Ehepaar seinen letzten Wohnsitz darin genommen hat. Hermann Lenz starb 1998, Hanne Lenz 2010. Einen Monat zuvor war noch einmal Peter Handke zu Besuch gekommen, der hier in den Siebzigerjahren kurzzeitig „eine Art von Unterschlupf“ gefunden hatte. Seitdem verband ihn eine enge Freundschaft mit seinen damaligen Gastgebern.
Daran erinnerte Rachel Salamander, in deren auf jüdische Literatur spezialisierter Münchner Buchhandlung Hanne Lenz Stammkundin war, zum Auftakt einer Gedenkveranstaltung am Tag von deren 110. Geburtstag. Ihr Schauplatz: Das Haus in der Mannheimer Straße, heute Sitz der Hermann Lenz Stiftung, die das Anwesen in dem Zustand erhält, in dem es zum Zeitpunkt des Todes von Hanne Lenz war. Wo früher zwei, gelegentlich durch Aufnahme von Gästen wie Handke drei Menschen lebten, drängten sich nun achtzig im ersten Obergeschoss, wo mit einem bunten Strauß von Redebeiträgen an eine Frau erinnert wurde, die ihre eigene Begabung als Schriftstellerin zurückgestellt hatte, um die Karriere ihres Mannes zu fördern: Hanne Lenz verdiente als Verlagslektorin in der Nachkriegszeit besser als Hermann. Die wenigen Texte, die wir von ihr kennen, zeigen, dass sie auch mindestens so gut wie er schrieb.
Eine Frau wie Porzellan
Proppevolle Räume in der Mannheimer Straße; wer in den toten Winkeln zum Mikrophon saß, der musste sich mit der Aussicht auf das Porzellan des Ehepaars Lenz im Eckvitrinenschrank trösten. Oder auf das sich durchs ganze Treppenhaus ziehende Ensemble von Privataufnahmen, die eigens rund um den Gedenktag dort aufgehängt worden sind. Im Vorfeld war gemunkelt worden, dass womöglich Handke wieder vorbeischauen könnte, doch er beließ es bei einer eigens erstellten Erinnerung an seinen ersten Aufenthalt, für deren Abfassung er sich indes sieben Tage Zeit genommen hat und die am Festabend vom Dichter (und Vorsitzenden der Lenz Stiftung) Albert Ostermeier verlesen wurde. „Für mich war Ende der Siebziger rein nichts mehr zu wollen“ – im unverkennbaren Handke-Sound bekommt man eine Hommage an Hanne Lenz vorgetragen, die jedoch noch viel mehr ein Porträt des Literaturnobelpreisträgers als demoralisierter junger Mann ist, der seinerzeit durch einen Zuruf seiner Gastgeberin aus der Lethargie gerissen worden sein will: „All mein Gehabe ist von mir abgefallen, und ich wurde so frei, ein ganz anderes Spiel zu spielen.“ Hanne Lenz bescherte ihm, so Handke in seiner Erinnerung, die er der F.A.Z. zur Publikation überlassen hat, eine „Schwellen-Übermittlung“.
Nicht Handke persönlich also an diesem Abend, aber dafür das literarische München. Neben Salamander und Ostermeier trugen Michael Krüger und Stephan Sattler zum lobenden Gedenken bei, und die neunzehnjährige Poetry-Slammerin Svea Paul machte sich ihren smartphonegestützten Reim auf Hanne Lenz und den Inhalt des Eckvitrinenschranks: „Es gibt Menschen, die sind wie Porzellan, sie füllte die Risse mit Gold.“ Im Publikum saßen unter anderem der Historiker Norbert Frei, das Übersetzerehepaar Elisabeth Edl und Wolfgang Matz, der Schriftsteller Fridolin Schley. Dessen Kollegin Anna Katharina Hahn war aus Hermann Lenz’ Geburtsstadt Stuttgart gekommen, der Publizist Rainer Moritz, dem die Welt die erste Dissertation übers Werk von Hermann Lenz verdankt, aus Hamburg, der Kulturwissenschaftler Michael Schwidtal, Herausgeber des vorehelichen Briefwechsels zwischen Hanne und Hermann Lenz, aus Frankfurt.
Besonders die Briefschreiberin Hanne Lenz wird nach diesem Abend unvergesslich bleiben, denn Michael Krüger las eine Probe vor: aus ihrer Korrespondenz mit Paul Celan, einem weiteren guten Bekannten des Ehepaars. Der hatte nach Erscheinen von Hermann Lenz’ erstem Roman, „Der russische Regenbogen“ (1959), in Paris unter deutschen Schriftstellern böse Bemerkungen über Lenz’ Zeit als Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg gemacht, was Hanne Lenz erschütterte: einmal wegen des Treuebruchs, vor allem aber, weil sie mit ihrem Mann über den gemeinsamen Abscheu angesichts des Nationalsozialismus zusammengekommen war.
Nur sie, ließ sie Celan indigniert wissen, könne das Verhalten von Hermann Lenz im „Dritten Reich“ beurteilen, und besonders empörte sie, dass der Freund „mit noch Fremderen als fremden Leuten“ darüber gesprochen habe. Wenn sie in ihrem Brief als Beispiel für diese „noch Fremderen“ dann Günter Grass nennt, stockt einem der Atem. Aber auch über die Sprachgewandtheit dieser Frau – und ihre Konsequenz, den Kontakt zum von ihr bewunderten Celan danach bis kurz vor dessen Tod abzubrechen. Die große Briefschreiberin als große Briefschweigerin. Man wünscht sich mehr zu lesen von Hanne Lenz und über sie.

 vor 13 Stunden
1
vor 13 Stunden
1






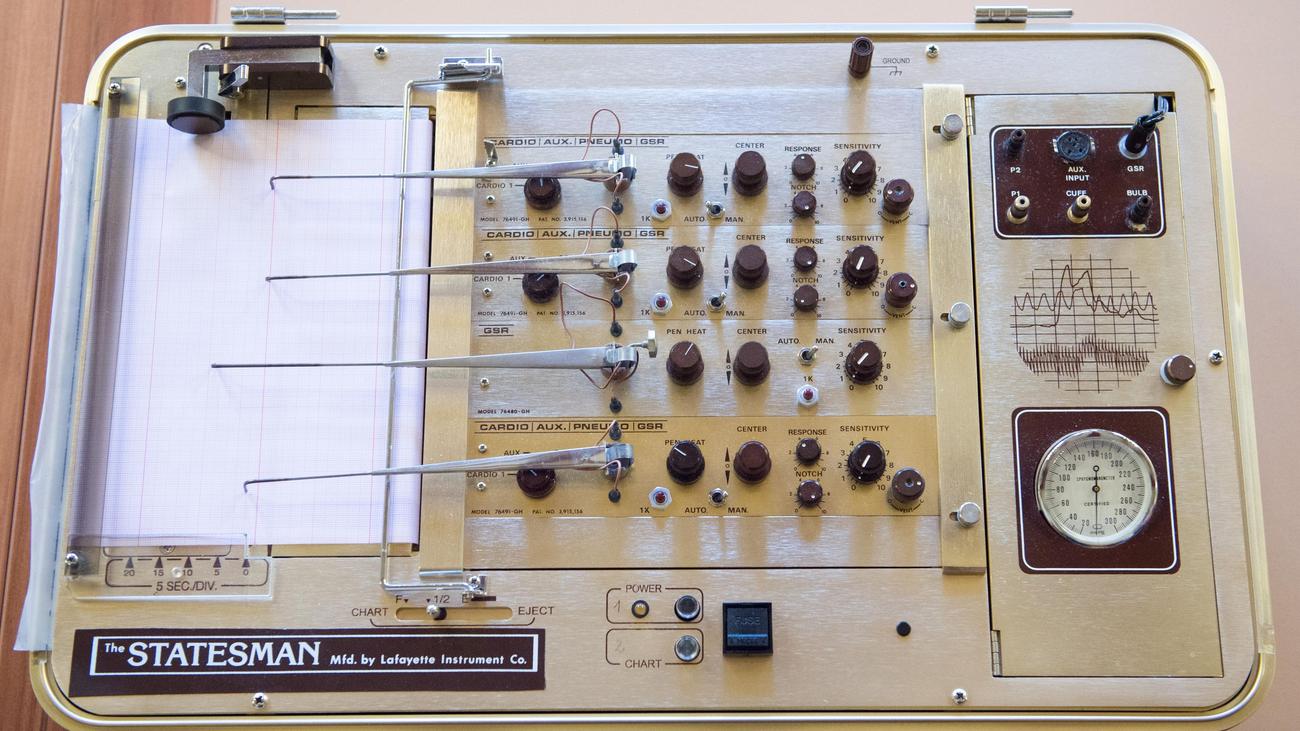




 English (US) ·
English (US) ·