In Berlin sieht es kulturpolitisch aktuell trüb aus.
Ach, wissen Sie – Museen schauen einerseits in die Geschichte und andererseits in die Zukunft. Sie betrachten anders als die Tagespolitik lange Zeiträume. Ich konnte mich in Berlin von bestimmten Kampflinien fernhalten, etwa wenn es um die Frage ging, wie soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz neu positioniert werden. Für mich war immer wichtig, die Autonomie von Häusern zu befördern. Ich denke schon, dass es mir gelungen ist, die Alte Nationalgalerie zu einer neuerlichen Blüte zu bringen. Dabei spielten viele gesellschaftliche Unterstützer eine Rolle. Der Freundesverein der Nationalgalerie ist finanziell sehr potent, auch als unterstützende Organisation, mit ihm zusammen konnte ich viel erreichen. Er hat Ausstellungen ermöglicht, die jenseits des üblichen Budgets lagen und ein großes Publikum anlockten. In Berlin habe ich gelernt, dass sich auch außerhalb gegebener Strukturen Dinge realisieren lassen. Dieses Wissen kann ich auf die Situation der Albertina übertragen – man verlässt sich nicht allein darauf, was man vom Staat bekommt.
Wie viel bekommen Sie denn vom Staat?
Als sogenannte Basisabgeltung erhalten wir 12,9 Millionen Euro. Aber allein die Personalkosten für unsere 290 Mitarbeiter liegen darüber. Ausstellungen oder weitere betriebliche Kosten müssen durch Eigenerlöse finanziert werden. Diese sind für uns überaus wichtig: Die Albertina ist ein großes Haus mit einer Bilanzsumme von 95 Millionen Euro.
Ihr Vorgänger Klaus Albrecht Schröder hat die Albertina in 25 Jahren von einer Grafiksammlung mit wenigen Tausend Besuchern pro Jahr zu einem Supertanker mit internationaler Ausstrahlung ausgebaut. Was haben Sie vor?
Mein Anspruch ist, zu gestalten und einen Schritt weiterzugehen. Ich möchte ein Museum von heute für morgen verwirklichen, in dem die Bereiche Sammlungen und Ausstellungen integraler gedacht werden. Um die Albertina entsprechend ihrer in der Sammlung angelegten Bedeutung als international herausragendes Museum positionieren zu können, spielt ein attraktives Ausstellungsprogramm eine zentrale Rolle für die Wahrnehmung. Die Aufgabenstellungen sind jedoch viel weiter gesteckt: Es gilt zugleich mit Blick auf die große Expertise in den grafischen Künsten die langfristige sammlungsbasierte Forschung auszubauen und die Albertina als Kompetenzzentrum für Kunst auf Papier sichtbarer zu machen.
Die Albertina hatte zuletzt rund 1,3 Millionen Besucher im Jahr. Sie haben schon bei Ihrer Vorstellung gesagt, die Turbojahre seien vorbei.
Wir bespielen an drei Standorten – Albertina, Albertina Modern, Albertina Klosterneuburg – knapp 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist eine Menge, und das wird so bleiben. Und ich verspreche: Wer die Albertina liebt, wird sie auch künftig lieben. Ich habe ein facettenreiches Programm mit achtzehn Ausstellungen für 2025 zusammengestellt, das ich in den vergangenen eineinhalb Jahren zusammen mit dem Team erarbeitet habe.
 Achtzehn geplante Ausstellungen allein für 2025: Ralph Gleis, neuer Generaldirektor der Albertina Wien und ihrer DependancenMafalda Rakos
Achtzehn geplante Ausstellungen allein für 2025: Ralph Gleis, neuer Generaldirektor der Albertina Wien und ihrer DependancenMafalda RakosAlso von Anfang an Ihre Handschrift, keine Erbstücke vom Vorgänger?
Ja, das Programm trägt meine Handschrift, auch wenn selbstverständlich auf sammlungsbasierte Forschung der letzten Jahre zurückgegriffen wird. Altmeister-Ausstellungen brauchen in der Regel am längsten bei Vorbereitungen. Um die Ausstellung „Leonardo – Dürer. Meisterzeichnungen auf farbigem Grund“, die wir vom 7. März an zeigen werden, vorzubereiten, bin ich direkt im Herbst 2023 nach Windsor Castle, London und in den Louvre gefahren, um die Leihgaben zu sichern. Das war auch eine Art Vorstellungstour, um mein Netzwerk zu pflegen und neue Kontakte zu generieren.
Wie waren die Reaktionen: Übertrumpft das Renommee des Albertina-Generaldirektors jenes des Direktors der Alten Nationalgalerie?
Viele Kolleginnen und Kollegen kannten mich schon, aber eine Begegnung blieb doch hängen: Christophe Leribault, der damalige Präsident des Musée d’Orsay, stellte mich 2023 einer Mitarbeiterin vor: Das ist Monsieur Gleis, er ist Direktor der Alten Nationalgalerie und künftiger Generaldirektor der Albertina. Die Dame antwortete „O, wow!“. Das hat mir bewusst gemacht, dass die Alte Nationalgalerie zwar internationale Aufmerksamkeit genießt, sich aber in der vielfältigen deutschen Museumslandschaft nicht so abhebt, wie es die Albertina in Österreich tut. Wien ist eine Kulturwelthauptstadt, und das merkt man auch in New York.
Gleichzeitig ist die Albertina ein Lieblingsmuseum der Wiener.
Tatsächlich kommen vierzig Prozent unserer Besucher aus Wien und Österreich. Bei uns gibt es einen permanenten Besuchsanreiz, weil wir so häufig neue Ausstellungen zeigen. Die Vielfalt der Kunsterlebnisse ist das Besondere an der Albertina: Sie kommen etwa gezielt wegen Leonardo und entdecken dann Francesca Woodman. Anders als im Belvedere, wo „Der Kuss“ von Klimt hängt, weswegen das Haus auf der Liste aller Touristikunternehmer steht. Da haben wir es mit grafischen Künsten, die nicht permanent ausgestellt werden können, natürlich schwerer. Deshalb müssen wir neue Kreise ansprechen, die Digitalisierung und das virtuelle Museum fortschreiben. Viele Besucher informieren sich vorab im Internet, wie sieht die Sammlung aus und wie ist das Programm.
Die Bespielung der Ausstellungsfülle lässt sich nur stemmen, weil Sie aus dem Vollen schöpfen können?
Die Albertina ist ein riesiger Kunst- und Wissensspeicher mit rund einer Million Druckgrafiken und Zeichnungen von der Gotik bis zur Gegenwart, 65.000 Bildern und Skulpturen von Malern des 20. und 21. Jahrhunderts, mehr als 130.000 Fotografien sowie einer bedeutenden Architektursammlung. Daraus lässt sich in der Tat schöpfen. Wir sind in vielen Bereichen führend, etwa in der Fotografie. In Österreich gibt es kein Fotografie-Museum, und bei uns kann man zeitgenössische Positionen am besten erleben. In der Albertina Modern eröffne ich nächste Woche die Ausstellung „True Colours. Farbe in der Fotografie“, da geht es nicht um die landläufige Vorstellung, die wir mit Polaroids der Siebziger verknüpfen, sondern um Arbeiten aus den Jahren 1849 bis 1955. Die Bilder von 1880 sehen teilweise aus, als wären sie von Andy Warhol gemacht worden.
Womit wollen Sie die Zukunft gewinnen?
Indem wir viel Neues wagen. Wir zeigen allein sechs Soloausstellungen über Künstlerinnen, darunter Jenny Saville, Jitka Hanzlová, Leiko Ikemura. Dazu kommen themenbasierte Ausstellungen wie „Gothic Modern“, die ich lange mit Oslo und Helsinki vorbereitet habe. Wir wollen den für die Moderne angeblich immanenten Traditionsbruch untersuchen. Da werden Dürer und Grünewald neben Hauptwerken von Beckmann, Kollwitz und Munch hängen. Und man muss oft zweimal hinschauen, um zu erkennen, was Mittelalter und was 20. Jahrhundert ist. Das sind Projekte, die sich aus der wissenschaftlichen Bearbeitung der Sammlung ergeben, die ich verstärken möchte. Ich möchte auch internationale Kooperationen ausbauen: Wenn eine Kuratorin aus Oslo unsere Sammlung sichtet, tut sie das anders, als wir es tun würden. Skandinavien geht uns ohnehin weit voraus, was die Einbindung des Publikums und auch den Wissenschaftsbegriff in Museen angeht.
Wie sieht das dort in der Praxis aus?
Einerseits gibt es einen hohen Anspruch an wissenschaftliche Publikationen, die oft in Zusammenarbeit mit Universitäten entstehen. Andererseits sind Ausstellungen dort absolut niederschwellig, weil das Museum längst als sozialer Ort entdeckt wurde. Das sind Dinge, auf die wir erst hinarbeiten.
Wie könnte das funktionieren?
Indem wir partizipativer werden und nicht wie in früheren Jahrhunderten als Lehrmeister mit Schulbuchwissen auftreten. Ein Beispiel: Wir zeigen ab dem 7. Mai Zeichnungen von Damien Hirst, die noch nie zu sehen waren. Hirst bereitet seine Kunstwerke in der Zeichnung vor, aber nicht altmeisterlich, er scribbelt eher. Bei meinem Studiobesuch erzählte er mir von seinem ersten Stipendium, das er vom DAAD bekommen hatte und das ihn nach Berlin führte. Dort hat er eine Zeichenmaschine gebaut, die eigentlich jeder bedienen kann. Diese Maschine werden wir jetzt einsetzen, und damit werden wir, davon bin ich überzeugt, ein neues Publikum ansprechen. Außerdem sollte man das Publikum nie unterschätzen, das bringt schon etwas mit. Und wir wollen ja keine Zwangsbeglückung.
Aktuell dominiert das Mantra, Museen müssten nachhaltiger und ökologischer werden.
Nachhaltigkeit heißt für mich, Projekte mit strategischen Partnern zu suchen, deren Sammlungen komplementär zur unseren sind, damit für beide Seiten ein Gewinn entsteht. So wie wir es etwa beim Austausch der Sezessions-Ausstellungen zwischen dem Wien Museum und der Alten Nationalgalerie gemacht haben. Das bedeutet für Leihgaben: Nicht hundert Werke aus hundert Destinationen, sondern ressourcenschonende Zusammenarbeit mit einem Partner, mit dem ich große Blöcke austauschen kann.
Planen Sie weitere Dependancen?
Nein.
Angesichts der politischen Lage: Macht Ihnen die Möglichkeit einer FPÖ-geführten Bundesregierung Sorgen?
Bislang hatte ich den Eindruck, man sei sich in Österreich über Parteigrenzen hinweg einig, dass Kultur hier einen höheren Stellenwert genießt als in anderen Ländern. Somit würde ich erwarten, dass auch künftig die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, damit die Museen ihrem demokratischen gesellschaftlichen Auftrag nachkommen können. Klar ist, Kunst soll frei sein, sie braucht ein Klima der Meinungsfreiheit und Reflexion und ist kein Instrument der Politik.

 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1


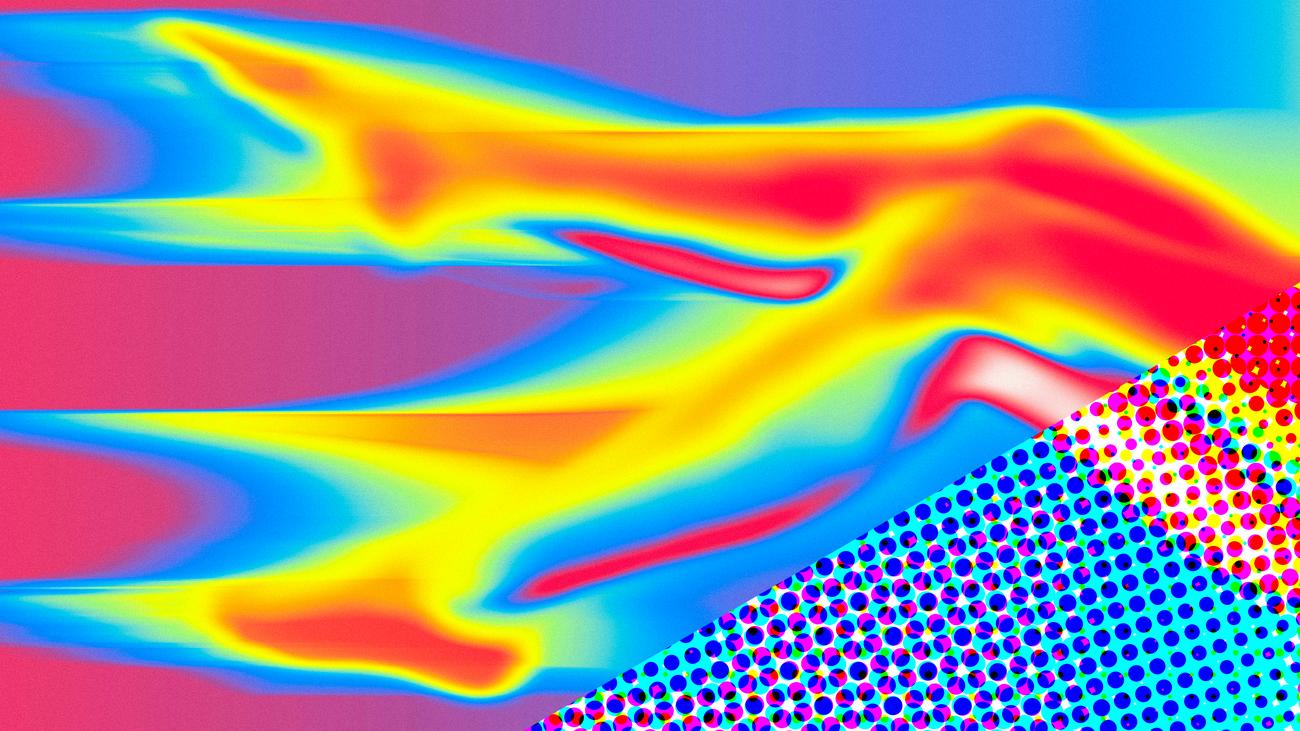








 English (US) ·
English (US) ·