An einer Stelle in diesem an Rätseln reichen Film bricht Elisabeth in schallendes Gelächter aus. Nicht sofort, sie lacht nicht laut los, sondern leise, albern, klein, ein Lachen, das sie wider besseres Wissen nicht unterdrücken kann und das sich, je konsternierter die anderen sie anschauen, je entschiedener sie sie zur Vernunft rufen, immer unbändiger wird, lauter, auch ansteckender. Wie stets bei derlei ist der Moment völlig unpassend. Elisabeth hat gerade erfahren, dass ihrem Sohn Armand vorgeworfen wird, einen anderen Jungen sexuell belästigt zu haben. Nun sitzen Eltern, Lehrer und die Schulleitung bei dem hilflosen Versuch zusammen, „in einen Dialog zu treten“, wie der Direktor sagt.
Was wirklich geschehen ist, ist völlig egal
Der Anfall von Elisabeth dauert handgestoppte fünf Minuten, und die Kamera von Pål Ulvik Rokseth blickt in dieser quälend langen Zeit reihum in die Gesichter aller Anwesenden – von Sarah (Ellen Dorit Petersen) und ihrem Ehemann Anders (Endre Hellestveit), den Eltern des vermeintlichen Opfers, zum Schuldirektor Jarle (Øystein Røger) und seiner Assistentin Ajsa (Vera Veljovic), dann hinüber zur Lehrerin Sunna (Thea Lambrechts Vaulen) und zu Elisabeth (Renate Reinsve), die seit dem Tod ihres Mannes alleinerziehend ist. Sie schlägt sich prächtig für ihren Sohn, den vor unbewiesenen Anschuldigungen zu schützen ihr mütterlicher Instinkt fordert. Aber Elisabeth, das wurde in dem Film „Armand“ zu diesem Zeitpunkt bereits geschickt erwähnt, ist Schauspielerin, will sagen: Sie könnte alles nur spielen. Könnte – oder auch nicht.

Externer Inhalt von Youtube
Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen .
„Armand“, der erste Film des Norwegers Halfdan Ullmann Tøndel, der auch das Drehbuch schrieb und für sein Debüt beim Filmfestival in Cannes mit der Caméra d’Or geehrt wurde, ist ein schönes Lehrstück über öffentliche Moral, die zerstörerische Kraft von Gerüchten und die Verführbarkeit der Menschen. Der von Renate Reinsve grandios gespielte Anfall Elisabeths ist nur der Höhepunkt eines Geschehens, in dem ein ganzes Sozialgefüge wie in Zeitlupe auseinanderfliegt und ausnahmslos jeder dazu getrieben wird, Grenzen zu überschreiten, von denen man eigentlich dachte, sie stünden für immer: Die Lehrerin Sunna plaudert aus, was vermeintlich geschehen ist (womit sie ihr Wort bricht); Anders nähert sich Elisabeth an (womit er seine Frau verrät), und Sarah versucht den Direktor zu beeinflussen (was manipulativ ist). „Ist das wirklich so passiert?“ ist die wiederkehrende Frage, die durch die leeren, in dunkel-diffuses Licht getauchten Gänge der Schule wabert, in denen alle Schritte klingen wie eine unabwendbare Gefahr. Folgerichtig tauchen die beiden sechs Jahre alten Kinder, um die es eigentlich geht, in dem Film niemals auf. Was genau geschehen ist, lässt sich ohnehin nicht rekonstruieren.
Ambivalenzen aushalten - komme, was wolle
Stattdessen zeigt „Armand“, wie leicht sich die Sicherheitsnetze, die eine gut meinende und entwickelte Gemeinschaft gesponnen hat, durch unangepasstes und übergriffiges Verhalten dekonstruieren lassen. Wer darin Parallelen zu gesellschaftlichen Entwicklungen dieser Tage sehen will, liegt vielleicht nicht ganz verkehrt. Es ist völlig egal, was tatsächlich geschehen ist. Eine Behauptung allein reicht aus, um Spekulationen auszulösen, die sich in „Armand“ bald aus alten Geschichten speisen, die wiederum nur anzudeuten dem Film ein unheimliches Vergnügen bereitet. So erfahren wir en passant, dass die beiden Mütter Elisabeth und Sarah eigentlich verschwägert sind. Dass Elisabeths Mann Thomas, Sarahs Bruder, bei einem Unfall ums Leben kam – oder war es Suizid? Wir lernen, dass Elisabeth eine wilde Vergangenheit und ihren beruflichen Zenit überschritten hat. War ihr Sohn Armand schon immer auffällig? Ist es allein deswegen gerechtfertigt, ihn zur Rechenschaft zu ziehen? Wofür?
Dass all diese Andeutungen ihre verstörende Wirkung entfalten können, liegt an dem unbedingten Willen des Regisseurs, Ambivalenzen nicht nur aufzubauen, sondern auch auszuhalten, komme, was wolle. Es liegt an den Schauspielern, vor allem den beiden Müttern Renate Reinsve und Ellen Dorrit Petersen, die absolut taktsicher manches sagen, während sie anderes verschweigen. Und es verdankt sich dem schönen Widerstreit zwischen der Kameraführung von Pål Ulvik Rokseth, der die Zeit in unendlich langsamen, zunehmend ins Psychodelische gleitenden Bildern dehnt und dem engen Raum, in dem Regisseur Tøndel, übrigens ein Enkel von Ingmar Bergman und Liv Ullman, seine Geschichte erzählt. Von einer kurzen Szene im Schulhof und einem Blick aus einem regenverschwommenen Fenster abgesehen spielt das ganze Geschehen im Inneren der Schule, die keinen Ort bietet, an dem man vor den anderen sicher wäre, nicht mal auf der Toilette.
Für diesen ästhetischen Wagemut ist „Armand“ zuletzt mit einem Platz auf der Shortlist für die Oscarnominierungen als „bester internationaler Film“ belohnt worden. Ob er tatsächlich nominiert wird, wird sich zeigen. Verdient hätte er es, auch wenn manche Kritiker dem Film wenig nachvollziehbar vorwarfen, wie ein Puzzle zu sein, dessen Teile nicht zusammenpassten. Aber natürlich tun sie das nicht, das ist ja der Witz: Es geht gar nichts zusammen in „Armand“, und genau so ist es sehr gut.
„Armand“ läuft von dieser Woche an im Kino.

 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1


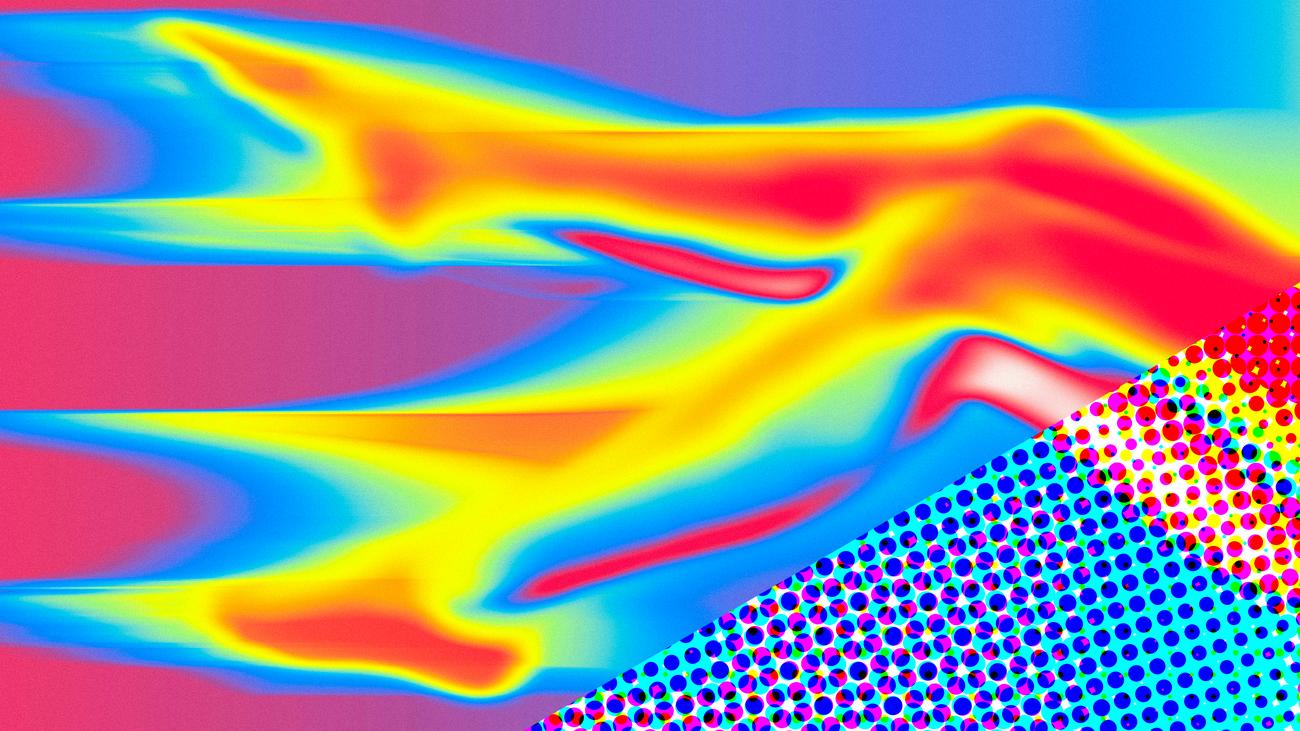








 English (US) ·
English (US) ·