Reden wir über die erstaunlichste Abrundung eines Zyklus in der deutschen Comic-Geschichte. Nicht, weil es keine umfangreicheren gegeben hätte. Oder populärere. Ja, nicht einmal, weil es etwa an welchen gefehlt hätte, deren Vollendung noch mehr Zeit in Anspruch genommen hat – Hansrudi Wäscher erweiterte seine Piccolo-Comicgeschichten aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren noch in den Neunzigern. Nein, worum es hier geht, ist ein Zyklus, mit dessen Abrundung niemand gerechnet hätte. Schon deshalb, weil man gar nicht wusste, dass ein Teil fehlte.
Die Rede ist von „Salut, Deleuze!“ des Szenaristen Jens Balzer und des Zeichners Martin tom Dieck. Ausgangspunkt dieses Comics war eine bald nach dem Freitod des französischen Philosophen Gilles Deleuze (1995) von Martin tom Dieck noch allein gestaltete Kurzgeschichte, die die Ankunft von Deleuze beim Fährmann Charon zeigt, jener antiken Sagengestalt, die Verstorbene über den Acheron rudert, jenen Fluss, der das Totenreich von der Welt der Lebenden trennt. Am anderen Ufer erwarten den Frischverschiedenen seine Kollegen Roland Barthes, Jacques Lacan und Michel Foucault – alle schon ein wenig länger tot als Deleuze, aber immer noch quicklebendig als prominente Protagonisten der französisch-strukturalistischen Philosophie.
 Die Comic-Kolumne von Andreas PlatthausF.A.Z.
Die Comic-Kolumne von Andreas PlatthausF.A.Z.Ein großer Spaß war dieses Zusammentreffen, das in der fünfzehnten Ausgabe der Comicanthologie „Lapin“ auf neun Seiten à vier gleichgroße Panels publiziert wurde – damals das hippste Forum, das man für Autoren-Comics bekommen hatte. Und bald folgte auch die Publikation auf Deutsch – auf vier großformatige Seiten ummontiert – im Schweizer Comicmagazin „Strapazin“, Nr. 45. Auch nicht gerade eine anspruchslose Adresse.
Ein renommierter Publikationsort nach dem anderen
Großen Spaß hatten auch Martin tom Dieck und der dann als Autor dazugestoßene Jens Balzer bei der Erweiterung der Ausgangsgeschichte auf fünffache Länge, was ihnen dadurch gelang, dass sie Deleuze noch insgesamt weitere viermal mit Charon übersetzen ließen – der Begriff der „Wiederholung“ ist ein zentraler im Werk von Deleuze. Daraus wurde dann ein ganzes Buch, auf Französisch erschienen bei Fréon, im deutschsprachigen Original schließlich 2000 beim Schweizer Verlag Arrache Coeur. Noch einmal zwei höchst prestigeträchtige Publikationsorte.
 So ging es 1996 los: die erste Seite aus „Salut, Deleuze!“Reprodukt
So ging es 1996 los: die erste Seite aus „Salut, Deleuze!“ReproduktDiese deutsche Ausgabe wiederum begeisterte mich damals dermaßen, dass ich Jens Balzer und Martin tom Dieck bat, eine weitere Fortsetzung zu erstellen: für die damals seit Kurzem existierenden „Berliner Seiten“ der F.A.Z., auf denen unsere Zeitungscomictradition begründet worden ist. Drei Monate lang lief dann dort vom Januar 2001 an unter dem Titel „Neue Abenteuer des unglaublichen Orpheus“ in einem seitenhohen Vertikalformat die Erweiterung von „Salut, Deleuze!“, die wiederum bei Arrache Coeur als Buch veröffentlicht wurde (noch im selben Jahr 2001).
 Here we go again: der Beginn der Fortsetzung von „Salut, Deleuze!“, jetzt unter dem Titel „Neue Abenteuer des unglaublichen Orpheus“.Reprodukt
Here we go again: der Beginn der Fortsetzung von „Salut, Deleuze!“, jetzt unter dem Titel „Neue Abenteuer des unglaublichen Orpheus“.ReproduktWunderbare Wandlung durch Wiederholung
Und dann fast ein Vierteljahrhundert nichts mehr von Jens Balzer und Martin tom Dieck über Deleuze. Warum auch? Mit dem zweiten Band war eine wunderbare Weiterung erfolgt, die gleichsam wieder an den Beginn des ersten zurückgeführt und somit die Wiederholung einmal mehr etabliert hatte. Und wir warteten ja auch noch auf Martin tom Diecks damals längst angekündigten, bislang aber nicht erschienenen Comic zu Walter Mehring. Darauf warten wir weiter, während ohne jede Erwartung plötzlich ein neuer Band „Salut, Deleuze!“ angekündigt wurde: jetzt beim Reprodukt Verlag und 176 Seiten stark, darin beide längst vergriffenen ersten Alben und eine ganz neue Fortsetzung namens „Holy Deleuze“ mit sechzig Seiten Umfang.
 Begrüßen wir als neuen Gast im Denkerreigen: Dr. Sigmund Freud (rechts). Links außen sitzt Foucault, in der Mitte Lacan.Reprodukt
Begrüßen wir als neuen Gast im Denkerreigen: Dr. Sigmund Freud (rechts). Links außen sitzt Foucault, in der Mitte Lacan.ReproduktDieser Band ist nun da, und auch wenn ich ihn nicht erwartet und also auch nicht darauf gewartet hatte, bin ich begeistert. Erst einmal darüber, dass sich das unvergleichliche (weil absolut singuläre) „Deleuze“-Lesegefühl wieder genauso einstellt wie im Jahr 2000. Und dann, weil es konsequent weitergeht. Es wird zwar nicht übergesetzt, aber das philosophische Quartett aus dem Titelhelden, Barthes, Foucault und Lacan ist wieder da. Eurydike aus der „Orpheus“-Fortsetzung ist wieder mit dabei, und es gibt eine neue Hauptfigur: Sigmund Freud. Und eine grandiose neue Nebenfigur: René Magritte.
Ein Phallokrat namens Freud
Freud passt perfekt in den Deleuze-Comic-Kosmos, denn für Lacan ist sein Werk die wichtigste Bezugsgröße, und auch die anderen drei Philosophen haben zumindest (wie der ganze Strukturalismus) eine immense Dankesschuld gegenüber den freudschen Texten abzuleisten. Es wird denn auch einfallsreich mit diesen Bezügen gespielt, wobei Freud selbst als eher skurrile, natürlich phallozentrische Figur auftritt, die vor allem (selbstverständlich phallisch aussehende) Pilze sammeln will – ein biographisches Detail, das Balzer aus den Erinnerungen von Freuds Sohn entnommen hat (die Recherche zur Geschichte war einmal mehr denkbar akribisch und zugleich assoziativ).
 Da sind die Nighthawks der Unterwelt.Reprodukt
Da sind die Nighthawks der Unterwelt.ReproduktMagritte wiederum ist Gast in einer an Edward Hoppers Gemälde „Nighthawks at the Diner“ angelehnten Bar, in der bereits Foucault, Barthes und Lacan das trinken, was ihnen die an der Comicfigur Betty Boop angelehnte Euyrdike als Barkeeperin serviert. Das uns bekannte Trio fragt sich, warum es so lange nichts von Deleuze gehört hat, der doch bald seinen hundertsten Geburtstag feiern könne (was tatsächlich kürzlich als Datum anstand und womöglich den Anlass zur Abrundung der Comictrilogie geboten hat). Dabei entspannt sich ein Gespräch mit Magritte über dessen paradox-sprachspielerisches Gemälde „Ceci n’est pas un pipe“, in dem Balzer auf einen eigenen Aufsatz aus dem Jahr 2011 rekurriert, in dem er den Gebrauch von Comicspezifka durch Magritte analysierte.
Im Rasterschema erweist sich der Einfallsreichtum
Solche Anspielungen werden im Anhang des Buchs entschlüsselt, womit das komplexe Gefüge – man könnte mit Deleuze auch sagen: die Rhizomstruktur – des Textes ausgewiesen wird. Dieser Anhang ist ein hochwillkommener Zugewinn in der neuen Sammelausgabe, denn die Anmerkungen erstrecken sich auch auf die ersten beiden „Deleuze“-Bände. Und jeder Teil der Trilogie hat auch philosophisch einiges zu bieten.
 Kopfgeburten wie von der Osterinsel: das Cover zu „Salut, Deleuze!“Reprodukt
Kopfgeburten wie von der Osterinsel: das Cover zu „Salut, Deleuze!“ReproduktWas diesen „Sammelband“ indes besonders bemerkenswert macht, ist nicht nur die inhaltliche Kontinuität oder die Qualität des Einbezugs von Deleuze‘ Gedanken (und denen seiner Begleiter in der Unterwelt) in einen Comiczyklus, sondern auch dessen ästhetische Vielfältigkeit. Nicht, dass Martin tom Dieck bewusst unterschiedliche Stile anstrebte – fast dreißig Jahre Arbeit sorgen ja schon für genug Veränderung. Aber die Konsequenz, mit der der in Hamburg lebende und in Essen lehrende Comiczeichner seine Seitenarchitekturen anlegt – wie erwähnt jeweils vier gleichgroße Panels in Teil 1, dann ein Neun-Panel-Raster in Teil 2 und jetzt zum Abschluss nur noch zwei jeweils identisch große horizontale Panels pro Seite –, vermittelt neben der Strenge des jeweiligen Konzepts eine Lust am Spielerischen in der Gesamtschau.
Und nie vorher ist so deutlich geworden wie jetzt im Finale, dass sich die Figurengestaltung an den Moai der Osterinseln orientiert: jenen Steinfiguren, die nur aus Kopf zu bestehen scheinen – als „Gehirntiere“ hat Arno Schmidt einmal kluge Schriftsteller bezeichnet. Das sind Deleuze & Co. hier sichtbar. Und Martin tom Dieck und Jens Balzer hätten auch Anspruch auf den Titel.

 vor 2 Stunden
1
vor 2 Stunden
1



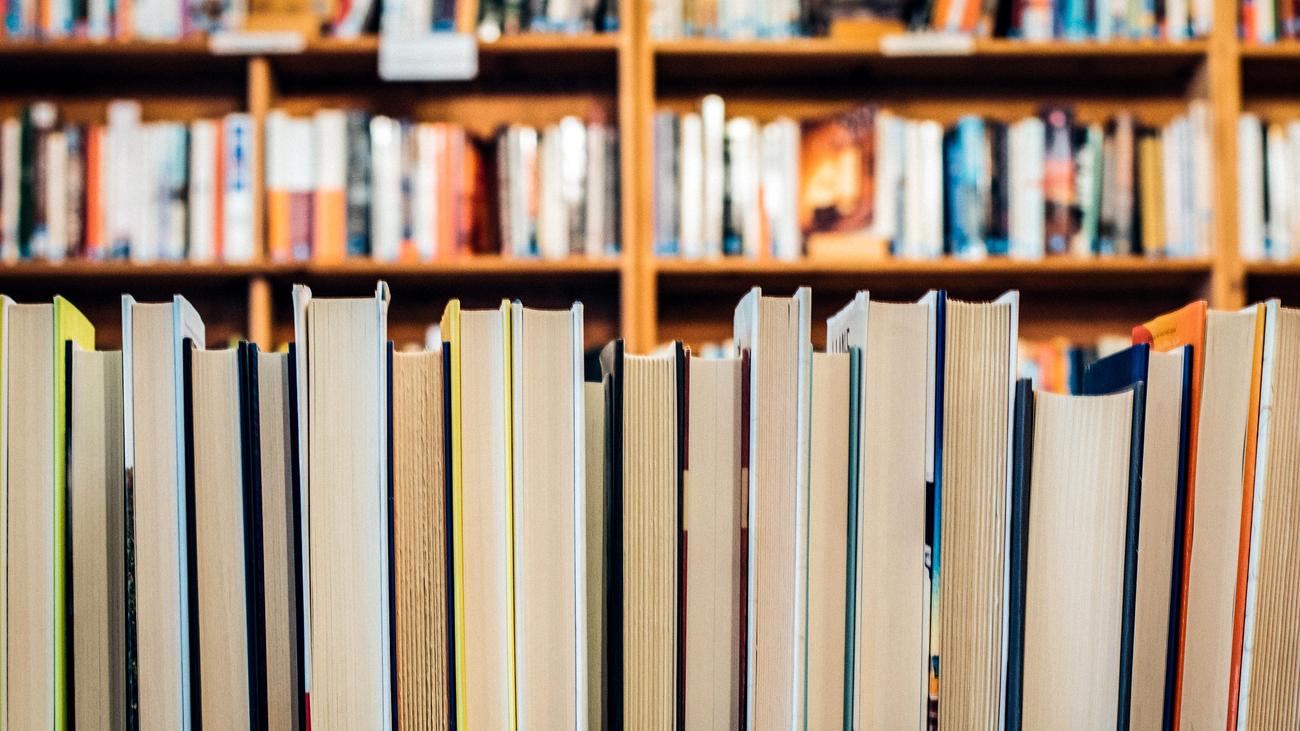







 English (US) ·
English (US) ·