Zum Wesentlichen, zu den Sachen selbst dringt nur vor, wer Phrasen und Gemeinplätzen misstraut. So zumindest will es ein Gemeinplatz, der die moderne Literatur von Flaubert bis zu den Wortführern der historischen Avantgarden prägt. Alle Formeln und vorgefassten Begriffe gelten ihnen als Hemmnis des individuellen Ausdrucks. Authentisch ist nur das Werk, das sich jeder Rhetorik entzieht. Doch was bleibt von den Versuchen, die Literatur von leeren Worten zu befreien, damit sie endlich von wahren Empfindungen, der gesellschaftlichen Realität oder dem inneren Diktat des Geistes zeugt? Wiederum nur Worte. Und so endet jede Formzertrümmerung in neuen Formen.
 Jean Paulhan: „Die Erfahrung des Sprichworts“.Konstanz University Press
Jean Paulhan: „Die Erfahrung des Sprichworts“.Konstanz University PressKeiner hat die verdrängte Macht der Rhetorik so elegant dargestellt und so überzeugend für ihre Unvermeidlichkeit plädiert wie Jean Paulhan (1884–1968), unbestrittener Doyen des französischen Literaturbetriebs der Zwanziger- bis Sechzigerjahre. Vier Jahrzehnte lang beriet er als Lektor Gaston Gallimard, fast ebenso lange war er Herausgeber der „Nouvelle Revue Française“. Doch hinter der Maske der grauen Eminenz verbarg sich ein Autor höchsten Ranges.
Madegassische Sprichwörter
Warum Paulhan als solcher hierzulande kaum wahrgenommen wird, erklärt sich, wenn man sein 1941 erschienenes, auf Deutsch beim verdienstvollen Schweizer Verlag Urs Engeler verfügbares Hauptwerk „Die Blumen von Tarbes“ aufschlägt: Hier versteht es einer, die programmatische Dimension seines Nachdenkens über Sprache und Literatur geschickt zu überspielen und imposante Begriffe durch Anekdoten und Paradoxien zu ersetzen. Freilich war Paulhan auch in seiner Heimat lange vergessen. Erst als sein Sprachdenken, vermittelt durch Maurice Blanchot, in die literaturtheoretischen Spielarten der Dekonstruktion einging, begann man, auf diesen großen Unbekannten aufmerksam zu werden.
Aus dem Blick geriet dabei zumeist die Erfahrung, der Paulhan seine Faszination für die Formelhaftigkeit und Performanz sprachlicher Äußerungen verdankte: seine Studien zu den Sprichwörtern Madagaskars. Eine vom Dresdner Literaturwissenschaftler Bernhard Stricker zusammengestellte, übersetzte und mit einem exzellenten Nachwort versehene Ausgabe erlaubt es nun, diese weit über Paulhans Biographie hinaus bedeutsamen Texte zu entdecken, die die Literaturtheorie des zwanzigsten Jahrhunderts heimlich prägten.
Ritualisierte Rededuelle
Knapp drei Jahre verbringt Paulhan zwischen 1908 und 1910 als junger Lehrer am Collège de Tananarive auf Madagaskar. Er wohnt bei einheimischen Familien und unternimmt ausgedehnte Reisen in das Landesinnere. Während die Kolonisatoren das Französische zur verbindlichen Landessprache erklären, lernt Paulhan zum Verdruss seiner Vorgesetzten eifrig Malgasy. Er sucht die Nähe zu den Merina, zeichnet ihre Erzählungen auf, studiert ihre Tabus und Speisevorschriften. Interessieren ihn die lokalen Sprichwörter, die „ohabolana“, anfangs nur aufgrund der Vorschriften, die sie kodifizieren, so gilt sein Augenmerk zunehmend ihrer Form. Unter den dreitausend Stück, die er sammelt, sind fast achthundert zu dieser Zeit unveröffentlicht – denn schon seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hatten sich Missionare und Folkloristen mit der Sprichwortkultur Madagaskars beschäftigt.
Anders als seine Vorgänger zielt Paulhan jedoch nicht auf eine Klassifikation dieser Sprichwörter. Vielmehr erkundet er ihren sozialen und pragmatischen Kontext. So stößt er auf ihre Verwendung in den ritualisierten Rededuellen der Merina, den „hain-teny“, einer Gattung mündlicher Spruchdichtung, die häufig der Fiktion eines Liebesdisputes mit verteilten Rollen folgt. Wer die Rede des Kontrahenten mit mehr Sprichwörtern überbietet, erringt den Sieg.
Eine lange Beschäftigung
Paulhan ist der Erste, der diese wegen ihrer Freizügigkeit verpönten und nur noch in der einfachen Landbevölkerung praktizierten Rededuelle aufzeichnet. 1913 erscheint seine Anthologie „Les hain-teny merinas“, die sowohl in der Fachwelt als auch bei Dichtern wie Apollinaire und Breton Anklang findet. Eine bei Lucien Lévy-Bruhl angemeldete Doktorarbeit wird dagegen nie fertig.
Dennoch kam Paulhan immer wieder auf jene Jahre zurück. Das Streben nach wissenschaftlicher Objektivität weicht allmählich einem autobiographischen Ton. Die Erfahrung des Sprichworts ist für ihn eine der Verunsicherung und des Selbstverlusts, der tastenden Annäherung an das Fremde und ihres Misslingens. Erst frustriert ihn sein unsicherer Gebrauch der Sprichwörter, dann seine Unfähigkeit, ihre erfolgreiche Anwendung zu erklären.
So offenbarten die madagassischen Sprichwörter ihm jenen Punkt in der Sprache, an dem Idee und Wort, Bedeutung und Gebrauch, persönliche Schöpfung und stereotype Wendung wie Kippfiguren einander abwechseln. In seinen späteren theoretischen Werken hat Paulhan diese Erfahrung als wesentliche Ambivalenz der Sprache verallgemeinert. Und sie zugleich verdrängt: „Man braucht nicht nach Madagaskar zu fahren, um die Erfahrung des Sprichworts zu machen.“
Jean Paulhan: „Die Erfahrung des Sprichworts“. Ethnographische Texte. Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Bernhard Stricker. Konstanz University Press, Göttingen 2025. 162 S., geb., 26,– €.

 vor 4 Stunden
1
vor 4 Stunden
1

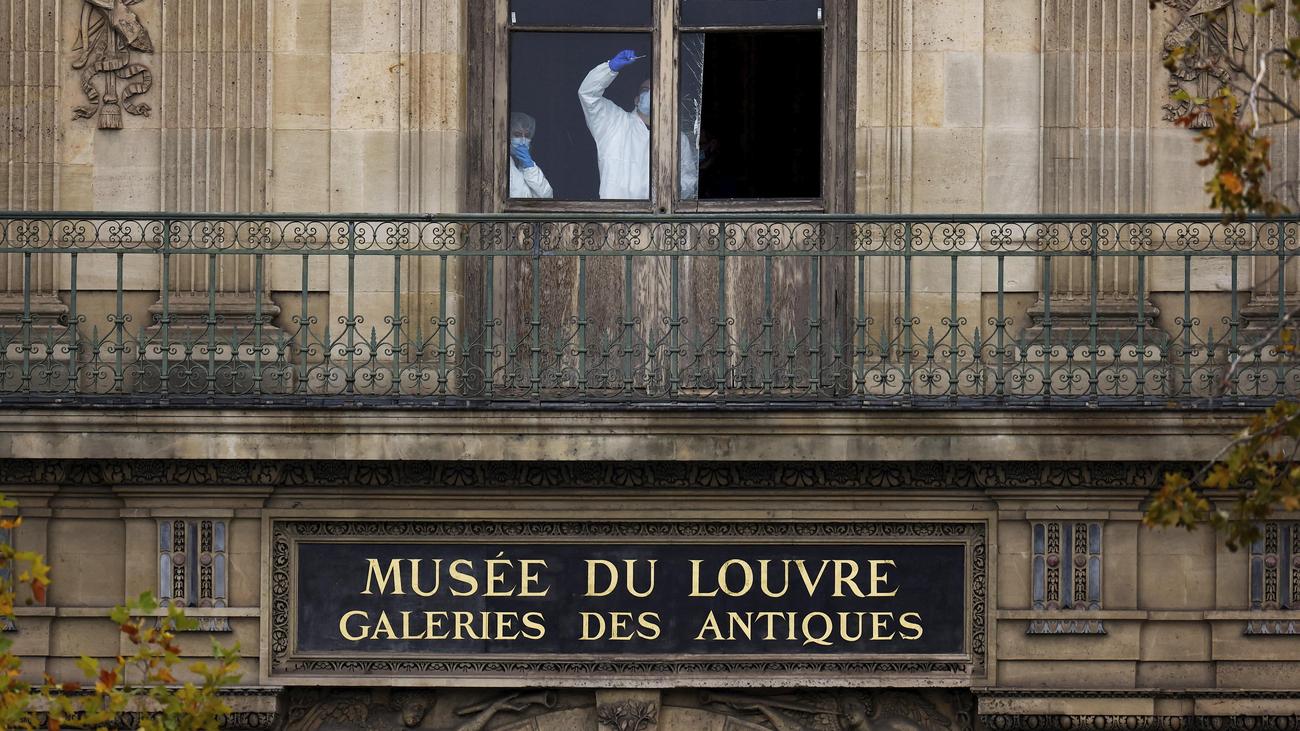









 English (US) ·
English (US) ·