Die Lage für unabhängige Journalisten aus Belarus bleibt auch nach der überraschenden Freilassung des Oppositionellen und Videobloggers Sergej Tichanowskij und 13 weiterer politische Gefangener prekär. Natalia Belikova vom Presseclub Belarus erklärt, dass für Journalisten die Freilassung von Ihar Karnej von Radio Free Europe eine besondere Symbolwirkung hatte. Er war im Juli 2023 wegen der Zusammenarbeit mit der von den Behörden in Minsk als extremistisch eingestuften Belarussischen Journalistenvereinigung (BAJ) zu drei Jahren Haft verurteilt worden.
Die Repressionen gegen unabhängige Medien begannen nach den Massenprotesten von 2020 und verschärften sich von 2021 an dramatisch. Viele Journalisten mussten innerhalb weniger Stunden das Land verlassen, um sich vor Verhaftung, Hausdurchsuchungen oder Gewalt zu schützen. Die Flucht bedeutete jedoch nicht das Ende ihrer Arbeit. Viele setzten ihre Tätigkeit im Exil fort – zunächst in der Ukraine, nach Beginn des russischen Angriffskriegs dann vor allem in Litauen und Polen. Die Herausforderungen sind groß: „Sie müssen ihre Institutionen und Prozesse in einem völlig neuen Umfeld neu erfinden, um weiterhin die Menschen in Belarus zu bedienen“, so Belikova. Dabei sei Anonymität oberstes Gebot – aus Angst vor Repressionen gegen zurückgebliebene Familienmitglieder. Der freigelassene Ihar Karnej lebt jetzt in Litauen, in Belarus gilt er weiterhin als Extremist. Jeder, der einen Text von ihm teilt, kann selbst Opfer der Strafverfolgung werden.
Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte die Freilassung als Zeichen an Donald Trump arrangiert, da er darauf hofft, von einer möglichen Einschränkung der Sanktionen gegen Russland profitieren zu können. Die überraschende Wirksamkeit der US-Außenpolitik wirft die Frage auf, wie die deutsche Außenpolitik auf die Situation reagiert. Im Schatten der medialen Aufmerksamkeit für das wiedervereinte Paar Tichanowskij liegt das Schicksal von mehr als 1150 Belarussen, unter ihnen 38 Journalisten, die im Juni nicht freikamen.
Deutschland kommt eine Schlüsselrolle zu
Noch immer gilt für Belarus die Regel: Medienvertreter sind heute entweder im Gefängnis, im inneren Exil oder außer Landes geflüchtet. Deshalb spielen Medienprojekte im Ausland, die wie die Plattform Zerkalo mit ihrem Publikum in Belarus in Kontakt stehen, eine zentrale Rolle, um überhaupt etwas über die Veränderungen im Land zu erfahren. Natalia Belikova vom in Warschau ansässigen Presseclub Belarus betont, dass die Europäische Union auch nach der Freilassung weiterhin geeint auftreten müsse und jede Lockerung von Sanktionen an konkrete Reformen wie die Entkriminalisierung unabhängiger Medien knüpfen müsse. Deutschland komme dabei eine Schlüsselrolle zu, um Belarus auf der europäischen Agenda auch in Zeiten des Krieges in der Ukraine zu halten.
In einer Verlautbarung des Presseclubs schreibt sie: „Die Bundesrepublik verfügt über das größte Budget zur Förderung von Demokratie innerhalb der Europäischen Union.“ Außerdem existiere „hier auch das stärkste Netzwerk von Unterstützerorganisationen, das die belarussische Medienlandschaft im Blick hat.“ Zu Belikovas konkreten Vorschlägen gehört, bestehende Programme zur Unterstützung konkreter Exilmedien deutlich aufzustocken und in Berlin eine große Konferenz über Medienfreiheit in der Region zu organisieren, bei der die Frage nach struktureller Förderung gemeinsam diskutiert werden könne.
Hintergrund dieses Vorschlags sind die Auswirkungen des weitgehenden Rückzugs aller US-Programme zur Förderung von Zivilgesellschaft und Medien in der Region. Im Kontrast zur Förderlogik deutscher Institutionen sahen diese bis zum Amtsantritt von Donald Trump auch eine institutionelle Förderung und den Anschub unkonventioneller Projekte vor. Statt in Zeiten des Krieges strategisch zivilgesellschaftliche Projekte in der Region zwischen Russland und der Europäischen Union zu stärken, hatte das Auswärtige Amt nach der Ausweitung der Kampfzone in der Ukraine umfangreiche Kürzungen vorgenommen, von denen auch zahlreiche Belarus-Projekte betroffen waren.
Das Unterstützungssystem ist dysfunktional
Die Gleichzeitigkeit des demonstrativen Ausstiegs der USA und die in Deutschland übliche Fehlbedarfsfinanzierung brachte 2025 mehrere Medienprojekte und NGOs an den Rand des Zusammenbruchs. Da der Bundeshaushalt frühestens im September feststehen wird, können Projektanträge bis auf Weiteres nicht bewilligt werden. Die im Oktober oder November eingehenden Bewilligungen sehen vor, dass das Geld bis Jahresende ausgegeben werden muss.
Dieses dysfunktionale System ist auch für deutsche Trägervereine, die über keine Eigenmittel verfügen, eine Belastung. Belarussische Initiativen, die als Reaktion auf die größte Emigrationswelle in der Geschichte der Republik Belarus nach 2020 entstanden waren, können diese Art der Haushaltsführung weder nachvollziehen noch abfedern. Ein klar verständliches Zeichen hingegen war die Abschaffung des Regierungsbeauftragten für die Zivilgesellschaft in Belarus im Mai dieses Jahres. Damit fehlt ein konkreter Ansprechpartner für die dringenden Belange, die Medienvertreter und NGO-Aktivisten aus Belarus teilen: Bei der Vergabe humanitärer Visa kommt es bei belarussischen Staatsbürgern im Vergleich zu russischen Staatsbürgern zu systematischen Benachteiligungen.
Sinnbildlich für das fehlende Wissen über die dramatische Situation in Belarus in deutschen Behörden ist die fünf-jährige Haftstrafe für einen Dolmetscher aus Minsk, der über Jahre für deutsche Einrichtungen gearbeitet hatte, um einen deutsch-belarussischen Dialog zu ermöglichen. Sein Gesuch auf ein humanitäres Visum, das er 2024 in einem Konsulat der Bundesrepublik gestellt hatte, wurde wegen einer Intervention des deutschen Innenministeriums abgelehnt. Es folgte die Verhaftung in Belarus, ein nicht rechtsstaatliches Verfahren sowie eine fünfjährige Haftstrafe, weil der Übersetzer 2020 eine Spende für die Unterstützung politisch Verfolgter in Belarus getätigt hatte.
Gäbe es in Deutschland ein ressortübergreifendes Bewusstsein für die politische Situation in Belarus, wäre es nicht zu diesem Vorfall gekommen. Umso wichtiger ist, dass die Bundesrepublik weiterhin Passersatzdokumente für verfolgte Belarusen ausstellt. Alexander Lukaschenko verbot die Beantragung neuer Pässe in den Auslandskonsulaten, um die im Exil Lebenden zur Einreise in die Republik Belarus zu zwingen – eine Falle für alle, die sich 2020 an den Protesten beteiligt hatten.
Bereits existierende Förderinstrumente, die sofort ausgeweitet werden könnten, sind die unkomplizierte Bereitstellung von Mitteln für psychosoziale und juristische Betreuung Verfolgter sowie die Ermöglichung des Familiennachzugs. Zur wirksamen Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft könnte die Bundesregierung, anders als in den zurückliegenden Jahrzehnten, langfristige Förderformate stärken, anstatt sich auf die kurzfristige Projektförderung zum Jahresende zu beschränken. Für das Überleben wirksamer belarussischer Auslandsmedien sind Fördermittel notwendig, die auch Verwaltungskosten abdecken, damit Exilinitiativen und NGOs nachhaltig arbeiten können. Zudem könnte das Auswärtige Amt mehr Freiräume für die Förderung von Medienprojekten und gesellschaftlichen Initiativen nutzen, um die Resilienz demokratischer Strukturen im Exil zu sichern. Dazu gehört auch die Unterstützung von Resonanzräumen, in denen die Situation in Belarus analysiert und erklärt wird. Die auf Russland und Belarus spezialisierte Plattform Dekoder schlägt in einem Appell vor, das Überleben unabhängiger Medien auch als Teil der Abwehr hybrider Kriegführung zu verstehen und EU-Mittel aus dem Programm „ReArm Europe/Readiness 2030“ für institutionelle Förderungen bereitzustellen.
Der Autor lehrt an der Fernuniversität Hagen Public History mit einem Belarus-Schwerpunkt.

 vor 9 Stunden
1
vor 9 Stunden
1


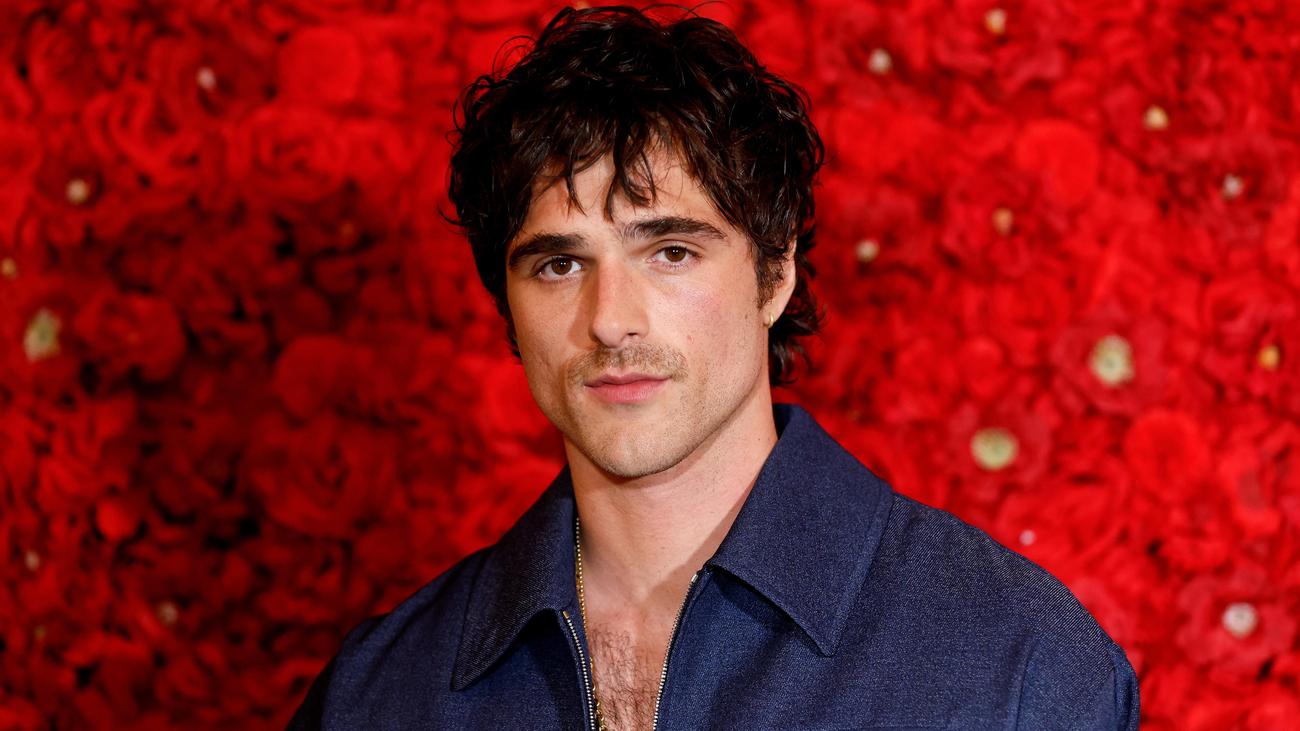








 English (US) ·
English (US) ·