In den sieben Stunden Lesezeit, die Graeme Lawson für sein Buch „Soundtracks“ veranschlagt, kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Welches ist der aufregendste Befund der Musikarchäologie? Die große Anzahl von Mundharmonikas an Kriegsschauplätzen, die belegen, dass Musik für Soldaten überall wichtig war, wenn sie gerade nicht mit dem Kämpfen und Töten zu tun hatten? Die Barockgeige aus dem Wrack des schwedischen Kriegsschiffs Kronan, das 1676 vor Öland gesunken war und uns ein in seinen Maßen völlig unverändertes Instrument überliefert – anders als die vielen im neunzehnten Jahrhundert umgebauten Stradivari-, Guarneri- und Amati-Geigen? Oder der Fund von Unmengen an Harfen-Stimmwirbeln in Oxford, der belegt, dass es dort schon um 1450 einen Musikfachhandel gegeben haben muss, wo man jenseits von Hof und Kirche Instrumente kaufte oder reparieren ließ?
Jeder wird, entsprechend eigenen Interessen, eine andere Lieblingsgeschichte in diesem munter plaudernden und doch konzentrierten Buch finden. Aber das Staunen nimmt zu, je tiefer sich der Autor in die Geschichte zurückgräbt bis zu dem, was man gemeinhin „Vorgeschichte“ nennt. Denn so ist das Buch aufgebaut: Es beginnt bei Schellackplatten und Lochstreifen für mechanische Klaviere im frühen zwanzigsten Jahrhundert, die uns wichtige Hinweise zur Interpretationsgeschichte, Tempowahl, Artikulation und Agogik des Klavierspiels liefern, und endet bei den Fußspuren mehrerer Exemplare des Australopithecus vor etwa 3,5 Millionen Jahren, die deutliche rhythmische Muster erkennen lassen und damit den Verdacht auf eine musikalisch strukturierte Körperbewegung nahelegen – bei einer ausgestorbenen Spezies, die zu den Vorläufern des Menschen gehört!
Baumrinden- und Knochenflöten
Die Lektüre von Lawsons Buch ist ein Vergnügen, weil aus der konkreten und erzählerisch vermittelten Anschauung eines jeden Fundes allgemeine Begriffe und methodologische Probleme der Musikarchäologie entwickelt werden. Zwar zählen Knochenflöten mit bis zu 40.000 Jahren zu den ältesten Musikinstrumenten, die wir kennen. Das heißt aber nicht, dass sie auch die ältesten sind. Denn Baumrindenflöten, die in gegenwärtigen Kulturen überall auf der Welt nachgewiesen werden können, sind viel leichter herzustellen, aber viel schwerer haltbar.
All solche Hinweise sind äußerst sympathisch, weil sie die Empirie gegen die Spekulation stellen. Anfang des Jahres beispielsweise hatte der Philosoph Christoph Türcke eine „Philosophie der Musik“ vorgelegt, die archäologische Funde gleich psychoanalytisch deutete als Ursprung der Musik aus dem Opferkult, der Bewältigung von Tötungstraumata und der Übertönung von Opferschreien wie dem Abbau von Tötungshemmungen (F.A.Z. vom 22. März). In Knochenflöten sah Türcke die Vergegenwärtigung des Opfertiers im Klang. Solchen Spekulationen begegnet Lawson mit fröhlicher Nüchternheit. Er macht gleich auf den ersten Seiten des Buches klar: Archäologie ist keine Teleologie. Man gräbt zwar in eine Richtung, doch was „Entwicklung“ in der Musik heißen kann, wird mit jedem Fund neu verhandelt werden müssen. „Wir sind einfach da, wo wir jetzt sind“ lautet die Formel seines methodischen Pragmatismus.
 Graeme Lawson: „Soundtracks“. Auf den Spuren unserer musikalischen Vergangenheit.Piper
Graeme Lawson: „Soundtracks“. Auf den Spuren unserer musikalischen Vergangenheit.PiperErörtert werden Grundsatzfragen wie: Was sagt der Zustand eines Instruments über dessen tatsächliche Gestalt aus? Kann man die Spielweise allein durch die überlieferten Objekte erkennen? Gerade bei älteren Pfeifen oder Flöten darf man vermuten, dass es inzwischen fehlende Mundstücke oder Rohrblätter zur Schallanregung gegeben hat. Wer hat was wann wo und warum hingelegt oder vergraben? Daraus lässt sich die Relevanz von Gegenständen in einer bestimmten sozialen Praxis ablesen. Sind es Zufallsfunde infolge von Kriegen, Naturkatastrophen oder Unfällen? Oder handelt es sich um Grabbeigaben und Kultspuren?
Ähnlichkeiten über Jahrhunderte hinweg
Der Verweischarakter des Fundobjekts auf eine umfassende soziale Praxis spielt bei Lawson eine große Rolle. Besonders eindrucksvoll ist die Schilderung eines mexikanischen Blumenflötenrituals, bei dem junge Männer ein Jahr lang als Flötisten hofiert und mit allen irdischen Genüssen regelrecht gemästet wurden, bis man sie rituell schlachtete. Zuvor mussten sie selbst ihre Flöten zerbrechen.
Wir erfahren, dass Funde von Cistern – Zupfinstrumenten der Spätrenaissance – darauf hindeuten, dass es gut achtzig Jahre vor Johann Sebastian Bach bereits ein Musizieren in wohltemperierter Stimmung, also unter Ausnutzung der chromatischen Gesamtheit aller 24 Tonarten, gegeben haben muss. Die Sensibilität für Intonationsreinheit und Abstimmung der Instrumente aufeinander lässt sich sogar schon für die Zeit um 1100 durch Knochenflötenfunde in Schleswig belegen, die Stimmspuren aufweisen.
Doch damit nicht genug. Die etwa achttausend Jahre alten Flöten, die im chinesischen Jiahú gefunden wurden, ähneln in ihren Stimmspuren „ihren Gegenstücken aus dem europäischen Mittelalter so genau, dass es fast unheimlich ist“, schreibt Lawson. Auch die Intervallpräferenz, die Arbeit mit Ganz- und Halbtönen, reicht bis in die Jungsteinzeit zurück, was auf eine ungeheure historische wie geographische Stabilität des Tonalitätsverständnisses schließen lässt.
Obwohl archäologische Funde gelegentlich so etwas wie Universalien des Musikverständnisses suggerieren, ist ihre Vielfalt doch derartig groß, dass Lawson sie eher als Einspruch gegen „eine westliche Selbstgefälligkeit“ wertet. Diese Offenheit für das Besondere wie das Allgemeine macht Lawsons Buch grundsympathisch.
Graeme Lawson: „Soundtracks“. Auf den Spuren unserer musikalischen Vergangenheit. Aus dem Englischen von Henning Dedekind. Piper Verlag, München 2025. 432 S., Abb., geb., 26,– €.

 vor 18 Stunden
1
vor 18 Stunden
1



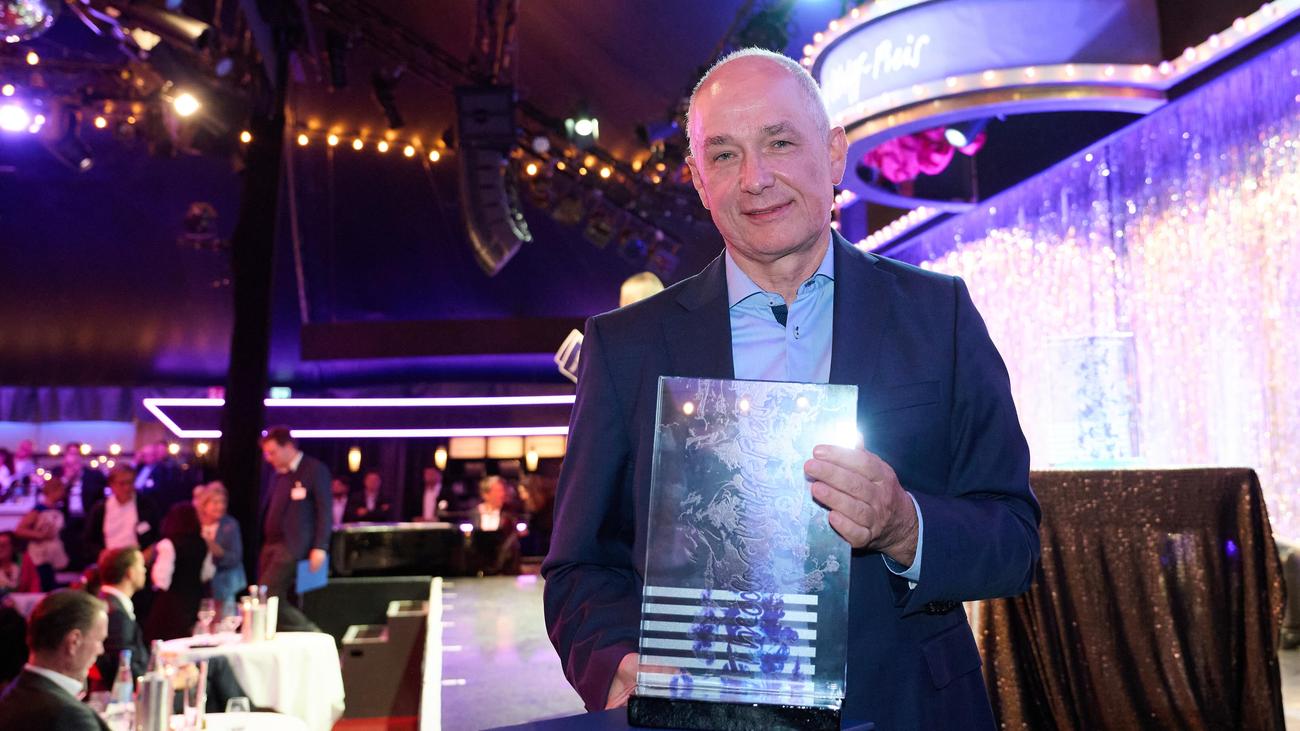







 English (US) ·
English (US) ·