In Christian Petzolds Thriller "Miroirs No. 3" ist vieles unwahrscheinlich. Macht überhaupt nichts.
Aus der ZEIT Nr. 40/2025 Aktualisiert am 17. September 2025, 19:21 Uhr

In diesem Film scheint nichts zu stimmen. "Wahrscheinlichkeitskrämer", wie Hitchcock einmal die Zuschauer genannt hat, die gern nach unglaubwürdigen Handlungsmomenten suchen, werden in Christian Petzolds Film Miroirs No. 3 massenhaft fündig. In der ersten Viertelstunde gelingt es der Heldin, zweimal eine Handtasche zu verlieren. Zweimal innerhalb von Minuten gerät ein Cabrio aus der Spur; der Unfall, der die Geschichte in Gang setzt, ereignet sich mit einem lapidaren Knall im Off, und die Kamera findet den Wagen adrett auf der Seite liegend, als hätte ihn das Filmteam aus Jux umgekippt. Die Überlebende quartiert sich nahezu wortlos bei einer Fremden ein, mit der sie im Vorbeifahren hypnotische Blicke gewechselt hatte. Die beiden entwickeln sofort eine vertrauliche, ja zärtliche Beziehung.
Nun war Christian Petzold noch nie ein Erzähler, dem es um Plausibilität geht. Manche seiner Geschichten entstammen unmittelbar dem Reich der Kolportage, sind schockgefrostete Versionen "heißer" Stoffe. So etwa Wolfsburg, wo sich eine Frau ahnungslos zu dem Mann hingezogen fühlt, der ihr Kind überfahren hat, oder Phoenix, in dem eine Schoah-Überlebende nach dem Krieg unerkannt eine Romanze mit ihrem eigenen Mann beginnt – die Krimis und Thriller des Film noir sind nicht sehr weit weg. Auch bei Miroirs No. 3, der im Titel nicht nur ein Musikstück von Ravel, sondern auch das Spiegelmotiv aufruft, könnte man an diese Geschichten denken, in denen Frauen mit Namen wie Laura oder Betty auf mysteriöse Art ins Bild treten – und wieder verschwinden.
Laura und Betty also, Paula Beer und Barbara Auer. Laura, Klavierstudentin in Berlin, betritt den Film als personifizierte Schwermut; die ersten Einstellungen zeigen sie an einem Flussufer, wo ein gespenstischer Stand-up-Paddler sie im Vorbeigleiten fixiert – der Fährmann, der die Toten in den Hades schifft? Ein geplanter Ausflug zu einem Produzenten, der für Lauras mit sich selbst beschäftigten Freund beruflich wichtig ist, endet tatsächlich fatal: für den Freund.
Betty wohnt allein in einem verwunschenen Haus an einer Landstraße. In der schönen Fremden, die das Schicksal hereinweht, erkennt sie jemanden: "Yelena", rutscht es aus ihr heraus. Sie bereitet Laura ein Bett, beruhigt sie mit einer Geschichte, legt Kleider zurecht. Laura nimmt das hin, aber der Zuschauer ahnt: Betty modelliert die junge Frau nach dem Vorbild einer Toten – ähnlich wie James Stewart am Ende von Vertigo eine Lower-Class-Version von Kim Novak in das elegante Schneiderkostüm seiner verschwundenen Geliebten steckt. Nur dass es sich bei Petzold nicht um eine "Veredelung" des Auftritts handelt. Die angehende Pianistin mit dem Großstadt-Background taucht im abgetragenen pinkfarbenen T-Shirt mit Babybel-Logo aus dem Jugendzimmer von Bettys Tochter auf.
Mit ihren Handtaschen hat Laura jedoch symbolisch Ballast abgeworfen; sie kann sich auf das ländliche Milieu einlassen, die traumatisierten Frauen blühen auf. Und ihr Glück wirkt ansteckend auf Bettys entfremdete Familie, auf Mann und Sohn – Matthias Brandt und Enno Trebs als stoffeliges, entschieden undynamisches Duo –, die im nahen Dorf eine Autowerkstatt betreiben. Ihr Geschäftsmodell beruht auf einem Trick, noch so ein kriminelles Motiv: Kunden in teuren dunklen Limousinen lassen das von den Autoherstellern eingebaute GPS-Signal unterbrechen – sie wollen nicht getrackt werden. Und so funktioniert auch die Inszenierung, die auf Auslassungen, Ellipsen, manchmal einen harten Schnitt setzt. Man muss nicht alles wissen. Nicht, wie genau Bettys Familie zerbrochen ist, warum niemand nach Laura forscht, wer die vielen Bücher im Wohnzimmer des kleinen Hauses liest und ob Matthias Brandts Mechaniker mal was anderes gemacht hat, als Dichtungen von Spülbecken zu erneuern.
Miroirs No. 3 ist ein Film des Hier und Jetzt, angesiedelt in der weiten spätsommerlichen Landschaft der Uckermark, luftig genug, dass man nach den Leitmotiven Wasser und Feuer in Petzolds Undine und Roter Himmeltatsächlich vom Abschluss einer Elemente-Trilogie sprechen könnte. Das glasklare, reduzierte Setting gibt den Figuren die Chance, sich neu zu orientieren, und es beginnt eine zweite Geschichte, die den Thriller unterläuft. Eine, in der die Dinge des Lebens und des Alltags in ihr Recht treten und die auch hübsch absurde Momente hat. Es wird viel gegessen und getrunken, Kaffee und Croissants in der Morgensonne, Königsberger Klopse und Weißwein beim Familiendinner; es muss diskutiert werden, ob Pflaumenkuchen mit Hefe- oder Mürbteig besser schmeckt; in der schönsten Szene hocken Paula Beer und Enno Trebs vor der rostigen Werkstatt beim Bier zusammen und hören einen Song von Frankie Valli. Und es wird viel gewerkelt ums Haus: der Zaun gestrichen, Unkraut gejätet, ein tropfender Wasserhahn repariert, eine gebrochene Fahrradstange geschweißt. Gibt es auch eine Reparatur der verletzten Seelen und Beziehungen? Unwahrscheinlich, aber nicht unvorstellbar: Miroirs No. 3 dürfte Christian Petzolds wärmster Film sein.

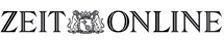 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·