Gerade mal zwei Stunden haben die ersten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren gedauert. Mehr als die Verabredung auf einen Gefangenenaustausch und eine ungewisse Perspektive auf weitere Gesprächsrunden kam dabei nicht zustande. Dafür fanden die Verhandler Zeit, der Ukraine mit neuen Feldzügen in weiteren Regionen und einem jahrzehntelangen Krieg zu drohen.
Bis auf den geplanten Gefangenenaustausch ist nichts davon überraschend. Denn die vage Hoffnung auf echte Friedensverhandlungen, die nach Ankündigung der Gespräche aufgekeimt war, verblasste sich schon vor deren Beginn. Der Grund war die Besetzung der russischen Delegation: Wladimir Medinski, Putins Beauftragter für Geschichtsfälschung in selbstverfassten Schulbüchern, führte sie an – genauso wie Anfang 2022. Ein Affront: Russlands Präsident schickte Wolodymyr Selenskyj nicht nur einen drittrangigen Beamten entgegen. Sondern auch einen, der in seinen historischen Abhandlungen immer wieder das Existenzrecht der Ukraine negiert.
Die Ukraine reagierte entsprechend naserümpfend auf die "dekorative" Besetzung des russischen Verhandlungsteams, wie es Selenskyj formulierte. Worüber das hinwegtäuscht: Die Besetzung der Delegation war ohnehin deutlich weniger entscheidend als es die Diskussion am Donnerstag, als die Unterhändler in der Türkei eintrafen, nahelegte. "Wir wissen, wer in Russland die Entscheidungen trifft", sagte Selenskyj. Damit drückte er seinen Unmut über die Abwesenheit Putins aus, den er zu einem persönlichen Treffen aufgefordert hatte. Im Wissen, dass Putin der Aufforderung nicht nachkommen würde.
Tatsächlich bedeutet Selenskyjs Aussage nichts anderes, als dass jede denkbare russische Delegation kein Mandat für Entscheidungen hat – unabhängig davon, wer sie anführt. Oder, wie es der britische Sicherheitsforscher Mark Galeotti ausdrückte: Die Entsendung Medinskis sei ein Zeichen mangelnden Respekts, ja. Aber auch ein Zeichen dessen, dass Putin den Gesprächsprozess kontrollieren wolle. Medinski sei eine "menschliche Drohne" und damit ein durchaus legitimer Vertreter des russischen Staatschefs. Putins Gesandter bewies das gleich nach der Ankunft in Istanbul: Er sehe die Gespräche als Fortsetzung der 2022 gescheiterten Verhandlungen, sagte Medinski am Donnerstag vor dem russischen Generalkonsulat. Klarer ausgedrückt: Alle russischen Forderungen von damals seien noch aktuell, der dreijährige Widerstand der Ukraine völlig zwecklos gewesen.
Das ist, in der Tat, die unverfälschte Position Putins. Und ein Hinweis darauf, dass Russland keine nennenswerten Fortschritte bei den Gesprächen anstrebt. So berichtete es auch das Exilportal Meduza unter Berufung auf kremlnahe Quellen: Russische Propagandisten hätten im Vorfeld Anweisungen erhalten, wie über das Treffen zu schreiben sei. Es seien im Wesentlichen Argumentationshilfen, wie der Ukraine die Schuld an ihrem Scheitern zuzuschieben sei, ein Erfolg sei nicht vorgesehen.
Die Türkei hingegen, die das Treffen ausrichtete, versuchte dennoch, das Beste daraus zu machen. "Es gibt zwei Wege", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan bei der Eröffnung der Gespräche, "einer wird uns zum Frieden führen, der andere zu noch größeren Zerstörungen." Die beiden Kriegsparteien würden "selbst entscheiden, welchen Weg sie wählen." Ein optimistischer Satz.
Doch der aktuellen Lage im nunmehr vierten Kriegsjahr wird er leider kaum gerecht. Denn das Chaos bei den Gesprächen zeigt: Der militärische Stillstand an der Front in der Ukraine hat die politische Ebene erreicht. Und weder Russland noch die Ukraine noch die USA noch Europa haben derzeit eine Friedenslösung anzubieten, die realistisch erscheint.
Putin jedenfalls ist nicht daran interessiert. Drei Jahre Krieg, der Verlust von mutmaßlich mehr als 200.000 Soldaten (Verletzte nicht mitgerechnet) und Tausenden Einheiten schweren Militärgeräts sowie inzwischen 16 europäische Sanktionspakete haben den Willen des russischen Staatschefs, sein Nachbarland zu unterwerfen, nicht gebrochen. Seine Forderungen bleiben aus ukrainischer Sicht ebenso inakzeptabel, wie sie es 2022 waren. Zwar kam die russische Armee in den vergangenen beiden Jahren in der Ukraine kaum voran, sie kontrolliert derzeit ein um mehr als ein Drittel kleineres Gebiet als während der ersten Verhandlungen Anfang 2022 und muss zudem hinnehmen, dass sich die Reserven an Panzern und Artilleriesystemen aus Sowjetzeiten stetig leeren. Doch kommt aus Nordkorea und dem Iran ausreichend Nachschub. Und die hohen Verluste werden weiterhin durch die Rekrutierung von Zehntausenden Soldaten pro Monat ausgeglichen. Mit beidem scheint Putin noch auf Jahre hinaus zu planen. Mit erfolgreichen Offensiven der Ukrainer, wie im Herbst 2022, rechnet er hingegen offenkundig nicht.
Und die Ukraine? Dass Selenskyj auf Sicht fährt, ist spätestens seit vergangenem Herbst offenkundig. Damals stellte er im ukrainischen Parlament seinen sogenannten Siegesplan vor, eine Liste an Forderungen an seine westlichen Verbündeten, die dabei helfen sollten, den Krieg zu beenden. Mehr militärische Unterstützung, härtere Sanktionen, ein Weg für die Nato-Aufnahme der Ukraine unmittelbar nach Kriegsende. Kurz: Keine Impulse für kriegsentscheidende Fortschritte, in denen die Ukraine nicht vom Westen abhinge. Der beeindruckende Ausbau der ukrainischen Rüstungsindustrie verschafft dem Land zwar eine gewisse Autarkie, doch diese Autarkie ist nicht umfassend genug, um langfristig planen zu können. Und das Problem des Soldatenmangels ist auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Diskussion darüber nicht gelöst.
"Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir nicht mal mehr wissen, was morgen passiert", sagte Selenskyj vor wenigen Tagen dem Spiegel. Klarer kann das Eingeständnis, nicht über den Luxus einer eigenen Planungssicherheit zu verfügen, kaum sein. Der Regierungswechsel in den USA hat die Planungszyklen der Ukraine weiter verkürzt. Trump zu besänftigen, ist zur neuen Hauptaufgabe des ukrainischen Staatschefs geworden. Immer wieder bittet er darum, die militärische Unterstützung aufrechtzuerhalten und den Druck auf Russland zu verstärken. Mehr als den Status quo zu halten, kann Selenskyj derzeit nicht hoffen. Nicht mit Donald Trump.
Der US-Präsident wiederum scheint, wenn überhaupt, nur sehr langsam zu erkennen, dass das Gewicht seines Landes notwendig ist, um die Dynamik des Krieges zu verändern – militärisch wie politisch. Nachdem er zunächst der Ukraine damit gedroht hatte, ihr die Unterstützung zu entziehen, drohte er Putin vor wenigen Wochen härtere Sanktionen an. Eine vage Ansage, aber immerhin ein erstes Signal des Drucks auf Russland. Doch Trump agiert erratisch, fordert eine Waffenruhe, um sich dann mit den Istanbuler Gesprächen zufriedenzugeben. Er fordert direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, nur um noch vor deren Beginn zu verkünden, dass er ohne ein persönliches Treffen mit Putin ohnehin keine Fortschritte erwarte. Er erklärt seine Unterstützung für die europäischen Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe, nur um sie dann wieder zu kassieren.
Bleibt also: Europa. Die größten europäischen Länder stehen zwar rhetorisch, anders als die USA, weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Doch in der Praxis können sie nur wenig bewirken. Stoppen die USA ihre Waffenlieferungen, können die Europäer das nicht ausgleichen. Wirksame Sanktionen können sie ohne die Vereinigten Staaten nicht durchsetzen. Und auch die Idee einer europäischen Friedenstruppe für die Ukraine, die einen künftigen Waffenstillstand sichern soll, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Europas militärisches Gewicht nicht ausreicht, um Russland wirksam abzuschrecken. Die sogenannte Koalition der Willigen ist noch lange keine Koalition der Fähigen. Und wie groß der Wille wirklich ist, zeigt sich schon daran, dass eine Truppenstationierung wenn, dann nur nach dem Krieg geplant ist. Die Auswirkungen auf die Frage, wie die Waffen schneller ruhen könnten, ist somit gleich null. Ohnehin sind die europäischen Länder mehr damit beschäftigt, sich selbst gegen die Bedrohung aus Moskau zu rüsten. Und hinken bei der Versorgung ihrer Streitkräfte der russischen Rüstungsindustrie stark hinterher.
Man sollte sich keinen Illusionen hingeben: Es gibt genau drei theoretische Auswege aus diesem Krieg. Erstens: Die Ukraine erhält so viel Unterstützung, dass sie Putins Eroberungen glaubwürdig bedrohen kann. Das ist derzeit nicht einmal am Horizont zu erkennen. Der zweite Weg: ein russischer Sieg, auf den es derzeit militärisch ebenfalls nicht hinausläuft – und dem die Ukraine politisch nicht zustimmen wird. Und der dritte: Verhandlungen.
Doch damit es eine Chance auf erfolgreiche Verhandlungen geben kann, müssen sich beide Kriegsparteien mehr von ihnen erhoffen als von der Fortsetzung der Kämpfe. Auch das ist derzeit nicht gegeben: Putin setzt die Gespräche nur als Mittel ein, seine Kriegsziele – und zwar alle – kompromisslos durchzusetzen und die Ukraine so zu schwächen, dass sie sich einem zweiten Angriff nicht mehr entgegenstellen könnte. Die Ukraine ist sich dessen bewusst und verlangt Sicherheitsgarantien, die aus ihrer Sicht das Mindeste sind, um die Existenz des Staates zu gewährleisten. Solche Garantien wird aber Putin wiederum nicht akzeptieren.
Um diesen festgefahrenen Zustand zu verändern, Verhandlungen also attraktiv zu machen, schlugen im Magazin Foreign Affairsvergangene Woche der Historiker Sergej Radtschenko und der Politologe Samuel Charap vor, die Militärhilfen an die Ukraine als Instrument einzusetzen. Die USA – der einzige dazu fähige Akteur – müssten ihre Unterstützung so "sorgfältig kalibrieren", dass sich Russland keine Hoffnungen mehr auf die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit mit den Mitteln des Krieges machen könne. Und die Ukraine dürfe ihrerseits nicht mehr darauf hoffen können, den Krieg am Ende zu gewinnen und die verlorenen Gebiete zurückzuerobern.
Neu ist diese Idee nicht. Genau diesen Effekt zu erzielen, war der Ansatz der USA und Europas der vergangenen drei Jahre, der als "As long as it takes" bezeichnet wurde. Die Ukraine sollte "so lange wie nötig" unterstützt werden. Doch: Nötig wofür? Das hatte weder der frühere US-Präsident Joe Biden noch Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz, die beiden bekanntesten Vertreter dieses Grundsatzes, je klar ausgesprochen. Beide sind nicht mehr an der Macht, doch haben auch ihre Nachfolger bislang keine neue Strategie formuliert. Ihre ersten Schritte im Amt lassen zudem nicht erwarten, dass sie es noch tun werden. Dass diese Methode, selbst falls Trump wieder auf die Taktik seines Vorgängers zurückgreifen sollte, Erfolg verspricht, ist nach drei Jahren durchaus zu bezweifeln – schließlich unterschätzte sie die irrationale Verlusttoleranz Russlands und überschätzte die Abhängigkeit der Ukraine von westlichen Waffen.
In der Hoffnung, mit einer Hinhaltetaktik davonzukommen, haben die großen westlichen Länder in den vergangenen Jahren sich selbst hingehalten. Die Leidtragende dieser strategischen Leere ist die Ukraine. Der Profiteur: Wladimir Putin. Denn der russische Präsident hat trotz der Niederlagen seines Militärs einen Vorteil, von dem Selenskyj nur träumen kann: Der Krieg wird in der Ukraine geführt, nicht in Russland. "Niemand weiß, wie lange (der Krieg) noch dauern wird. Aber nicht zehn Jahre", sagte Selenskyj kürzlich mehreren französischen Medien. "Die Ukraine würde das nicht überleben."
 © Andre Alves/Anadolu/Getty Images
© Andre Alves/Anadolu/Getty Images
1179 Tage seit Beginn der russischen Invasion
Die Zitate: Kein Tribunal für Putin
Am Donnerstag hat der Europarat formal die Vorbereitungen für ein Sondertribunal begonnen, das sich gegen die Hauptverantwortlichen des russischen Angriffs auf die Ukraine richten soll. Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, wurde von den Außenministern der Mitgliedsländer damit beauftragt. Vergangene Woche hatten sich bereits bei einem Treffen im westukrainischen Lwiw die Außenminister von fast 20 Ländern für das inoffiziell als "Tribunal für Putin" bekannte Sondergericht ausgesprochen.
Die Vorbereitungen sollen bis Anfang 2026 abgeschlossen werden. Das Tribunal soll seinen Sitz in Den Haag haben und aus 15 für neun Jahre gewählten Richterinnen und Richtern bestehen. Somit werde eine Lücke in der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs geschlossen: Russland ist kein Vertragsstaat des Gerichts und kann dort daher nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Optimistisch zeigte sich die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas angesichts der Aufgaben des Sondergerichts:
Dass sich eines Tages tatsächlich Putin vor einem internationalen Gericht verantworten muss, ist jedoch faktisch nahezu ausgeschlossen. Zwar teilte der Europarat mit, das Tribunal werde gegen konkrete "hochrangige politische und militärische Anführer" arbeiten, die "verantwortlich für die Planung, Vorbereitung, Initiation oder Ausführung des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine" seien.
Doch Staatschefs, Regierungschefinnen und Außenminister können aufgrund ihrer Immunität grundsätzlich nicht ohne Weiteres von solchen Gremien verfolgt werden. Und so räumte der Europarat ein, was ohnehin naheliegend ist: Die russische Führung könne nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht mehr an der Macht sei oder ihre Immunität aufgehoben werde. Dementsprechend unbeeindruckt zeigte sich Russland von der weitgehend symbolischen Entscheidung:
Die wichtigsten Meldungen: Sanktionen, Kampfjet, Spionage
Schattenflotte: Die EU hat das inzwischen 17. Sanktionspaket gegen Russland vereinbart. Sie richten sich vor allem gegen 200 weitere Schiffe von Russlands sogenannter Schattenflotte. Dadurch sollen fast 350 Schiffe, die Russland zur Umgehung von Ölsanktionen nutzt, auf der EU-Sanktionsliste stehen – nach Schätzungen etwa die Hälfte der Schattenflotte. Das Paket soll am Dienstag formell beschossen werden und in Kraft treten. Wegen Wladimir Putins Ablehnung einer sofortigen Waffenruhe haben mehrere EU-Staatschefs zudem noch undefinierte neue Sanktionen angekündigt, die in Zusammenarbeit mit den USA verhängt werden sollen.
Nato-Luftraum: Am Dienstag hat ein russischer Kampfjet nach Angaben Estlands für eine Minute den Luftraum des Nato-Landes verletzt. Die Maschine des modernen Typs Su-35 habe weder einen Flugplan übermittelt, noch Funkkontakt zur Flugsicherung aufgenommen und habe seine elektronische Kennung ausgeschaltet, teilte das estnische Militär am Donnerstag mit. Russland soll damit auf einen Versuch der estnischen Marine reagiert haben, ein mutmaßliches Schiff der Schattenflotte auf dem Weg nach Russland zu inspizieren.
Spionagevorwurf: Erstmals in seiner Geschichte hat der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU nach eigenen Angaben mutmaßliche Spione festgenommen, die für ein Nato-Land gearbeitet haben sollen. Die beiden ehemaligen Soldaten hätten auf Anweisung eines ungarischen Geheimdienstbeamten Militäreinrichtungen in der an Ungarn grenzenden Region Transkarpatien ausgespäht, teilte der SBU mit. Auch sollen sie angeblich die Einstellung der örtlichen Bevölkerung zu einer hypothetischen Truppenstationierung Ungarns sondiert haben.
Als Reaktion auf die Festnahmen verwies Ungarn zwei ukrainische Diplomaten des Landes – ebenfalls unter Vorwürfen der Spionage. Kurz darauf erklärte auch das ukrainische Außenministerium zwei Diplomaten aus Ungarn zu unerwünschten Personen. Das Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine ist seit Jahren angespannt: Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán blockiert regelmäßig Russlandsanktionen und EU-Hilfen für die Ukraine. Der Regierung in Kyjiw wirft er vor, die Rechte einer ungarischen Minderheit in Transkarpatien zu missachten sowie durch das Ende des Öltransits aus Russland Ungarns Wirtschaft zu schaden.

Was jetzt? - Der Nachrichtenpodcast: Spezial: Ist Russland unbesiegbar?
Waffenlieferungen und Militärhilfen: Neues deutsches Schweigen
Deutschland will künftig nicht mehr öffentlich über Waffenlieferungen an die Ukraine informieren. "Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber, Waffensysteme und und und aus der Öffentlichkeit herausgenommen", sagte am Samstag Bundeskanzler Friedrich Merz – der 2022 als Oppositionschef noch Transparenz gefordert hatte. Ziel des neuen Vorgehens sei, Russland über die Militärhilfen im Unklaren zu lassen. Dasselbe gilt künftig aber auch als Nebeneffekt für die Öffentlichkeit: Die Regierungswebsite, mit der seit 2022 regelmäßig aktualisierten Liste erfolgter und noch geplanter deutscher Waffenlieferungen, ist inzwischen nicht mehr erreichbar.
Medienberichte über Waffenlieferungen lassen sich dadurch jedoch nicht gänzlich verhindern. So berichtet die New York Times unter Berufung auf einen Beamten des US-Kongresses, die USA hätten am vergangenen Freitag eine deutsche Lieferung von 100 Flugabwehrraketen für das Patriot-Luftverteidigungssystem sowie 125 Raketen für Himars-Raketenwerfer an die Ukraine genehmigt. Die in den USA hergestellten Waffen dürfen nur mit der Erlaubnis der US-Regierung geliefert werden.
Dänemark hat angekündigt, der Ukraine in diesem Jahr 830 Millionen Euro für Waffenkäufe bei der ukrainischen Rüstungsindustrie zu überweisen. Der Methode, die ukrainische Rüstungsindustrie zu finanzieren, statt westliche Systeme zu liefern, übernehmen inzwischen auch andere europäischen Staaten. Dänemark war im vergangenen Jahr der erste Staat, der das durch Investitionen in die Produktion von Artillerie in der Ukraine getan hatte, das Vorgehen wird inzwischen als dänisches Modell bezeichnet.
Die vergangene Folge des Wochenrückblicks finden Sie hier.
Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im russischen Krieg gegen die Ukraine in unserem Liveblog.

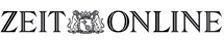 vor 4 Stunden
1
vor 4 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·