Er nutze künstliche Intelligenz manchmal für eine "zweite Meinung", sagt der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson. Kritiker äußern Sicherheitsbedenken.
6. August 2025, 9:20 Uhr Quelle: DIE ZEIT, sko

Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, können Menschen die Informationsverarbeitung erleichtern und auch mal beim Brainstormen helfen. Wie weit künstliche Intelligenz über Anwendungen wie ChatGPT in den Arbeitsalltag Einzug finden soll, ist allerdings umstritten – vor allem, wenn es dabei um sensible Daten geht. Das musste nun auch der schwedische Ministerpräsident erfahren. Nachdem Ulf Kristersson der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens industri nämlich in einem Interview gesagt hatte, dass er KI "oft" in seinem Arbeitsalltag nutze, erntete er Kritik. Boulevardjournalisten warfen ihm Fahrlässigkeit vor, Experten sahen gar eine Sicherheitslücke.
Kristersson sagte der Zeitung, er nutze auf KI basierende Dienste wie ChatGPT oder Le Chat regelmäßig in seiner Regierungsarbeit, um sie mit seinen Ideen zu konfrontieren und eine "zweite Meinung" zu bekommen. So könne er auch überlegen, ob er "genau das Gegenteil" machen solle. Auch seine Kollegen in der Regierung nutzten diese Dienste. Als Regierungschef müsse er regelmäßig große Mengen an Daten verarbeiten, dabei seien solche Dienste hilfreich.
Er kritisierte aber auch, dass es kaum Dienste gebe, die auf schwedischen Erfahrungen basierten. ChatGPT wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen OpenAI entwickelt, Le Chat von dem französischen Unternehmen Mistral AI.
Kritik an KI-Nutzung
Als Antwort auf das Interview gab es in der schwedischen Boulevardpresse einen großen Aufschrei. Die Stockholmer Boulevardzeitung Aftonbladet zitiert eine Professorin für Informatik, die zur Vorsicht bei der Nutzung von KI im Arbeitsalltag mahnt. Man könne sich nicht darauf verlassen, dass die ausgegebenen Informationen korrekt seien – und müsse zurückhaltend mit sensiblen Daten sein. Ein Pressesprecher Kristerssons versicherte der Zeitung, dass der Ministerpräsident natürlich "keine sicherheitsrelevanten Informationen" weitergebe. KI werde eher als "Resonanzboden" genutzt.
Ein Meinungsartikel der Zeitung wirft Kristersson trotzdem vor, "dem KI-Wahl der Oligarchen" zu verfallen. Und auch die Boulevardzeitung Expressen schreibt, Kristerssons Verhalten sei "amateurhaft".
Dagens industri verteidigte in einem weiteren Text dagegen die Aussagen des Ministerpräsidenten. Kristersson habe nicht gesagt, er gebe Regierungsgeheimnisse in KI-Funktionen ein und glaube den KI-Aussagen blind oder stelle sie gar über die Meinung seiner Angestellten. Im Gegenteil sei es schlimmer, hätte Schweden einen Ministerpräsidenten, der sich nie mit der Digitalisierung und neuen Anwendungen auseinandersetze, wie es viele Schweden täten.
Seit dem 2. August gilt in der EU eine neue Transparenzpflicht für KI-Anwendungen nach dem AI Act. Demnach müssen Betreiber künftig zum Beispiel offenlegen, wie ihre Systeme funktionieren und mit welchen Daten sie trainiert wurden. Kristersson kritisierte die Vorgaben Dagens industri zufolge als zu einschränkend für Unternehmen. Sie könnten die "dynamische Techszene" des Landes einschränken.

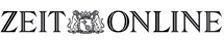 vor 22 Stunden
1
vor 22 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·