„Kaum hatte er den Pinsel mit Tusche benetzt, war das Schriftstück auch schon fertiggestellt, wobei die Wörter auf der Seide wirkten, als flössen Wolken und Nebel sich umschlingend ineinander.“ Das Zitat aus Kim Sisŭps Buch über einen schreibbegabten Scholaren trifft auch auf den Autor selbst zu. Ein am Königshof im Alter von fünf Jahren geschätztes dichtendes Wunderkind, konfuzianischer Gelehrter, Wandermönch, Dissident, Outcast, Philosoph: Kim (1435 bis 1493) war eine schillernde Figur und ein Querdenker in der koreanischen Geistesgeschichte.
Seine „Neue Erzählungen von der goldenen Schildkröte“ werden als Beginn koreanischer Prosaliteratur bezeichnet. Obgleich noch der klassischen Form chinesischer Erzählungen über wunderbare Begebenheiten („chuanqi“) wie den „Neuen Geschichten beim Putzen der Lampe“ von Qu You (1341 bis 1427) verpflichtet, unterscheidet sich das Buch davon durch seine koreanischen Schauplätze und erzählte Historie wie den Einfall japanischer Piraten oder der „Roten Turbane“. Und durch ein tragisches Ende.
Liebeszbeziehungen, die Zeit und Raum überwinden
Der in Bochum promovierte und in Boston lehrende Koreanist Dennis Würthner hat Kims Prosawerk aus dem Schriftchinesischen bereits 2020 erstmals ins Englische und nun kompetent und poetisch auch ins Deutsche übertragen. Anspielungen auf die konfuzianische, buddhistische und daoistische Geisteswelt sowie die klassische Literatur, die selbst heutigen koreanischen Lesern verborgen sein dürften, werden im Nachwort erhellt.
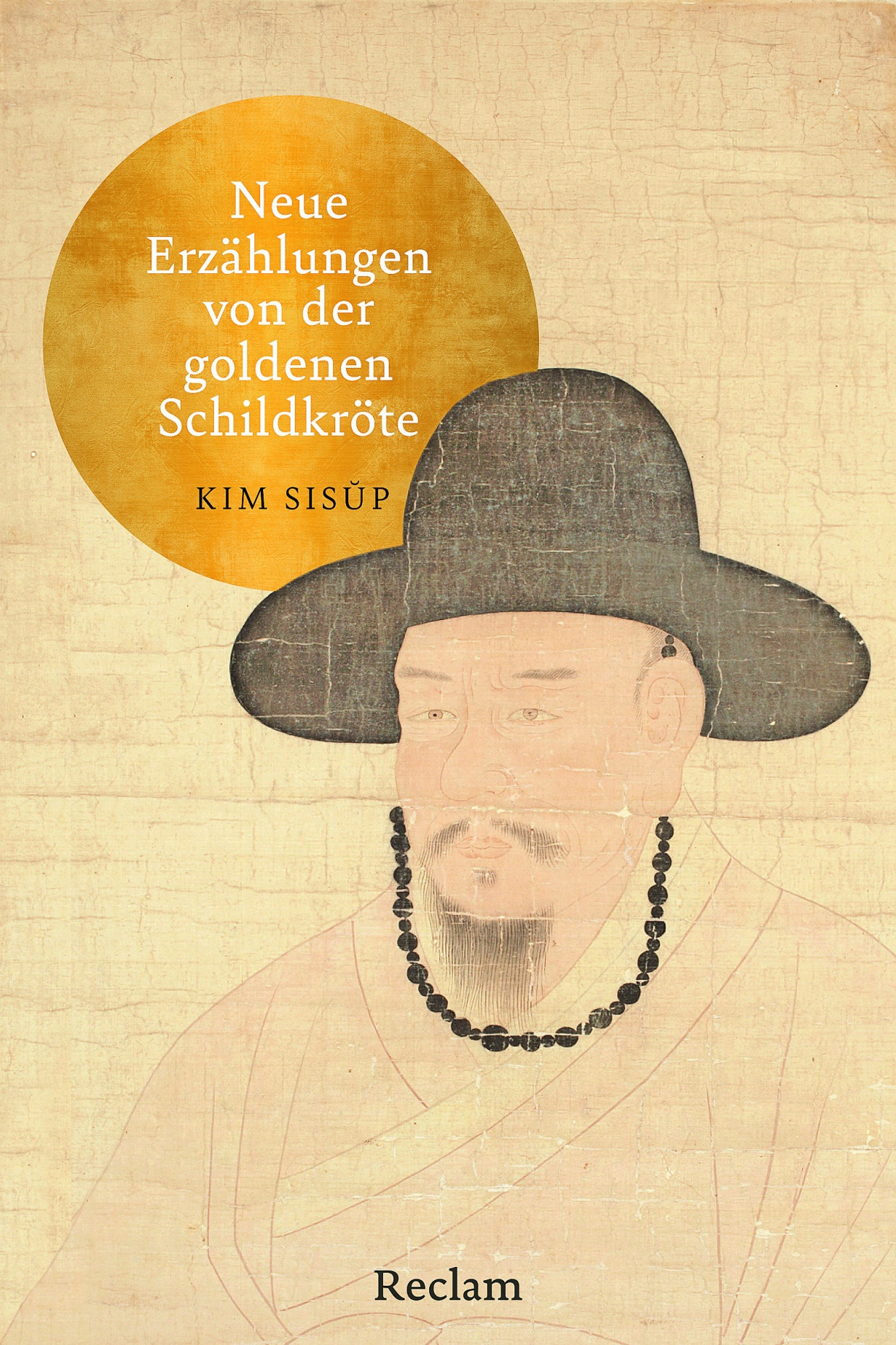 Kim Sisŭp: „Neue Erzählungen von der goldenen Schildkröte“.Reclam
Kim Sisŭp: „Neue Erzählungen von der goldenen Schildkröte“.ReclamDie ersten drei Erzählungen sind romantische Gespenstergeschichten als Zeit und Raum überwindende Liebesbeziehungen zwischen Menschen und Geistern, die letzten beiden beschwören Traumreisen: in eine buddhistisch inspirierte Unter- und Unterwasserwelt. Alle fünf haben einen biographischen Kern: Schlüsselerlebnis war die von Kim Sisŭp als Verrat an konfuzianischen Idealen empfundene Usurpation des Throns in der damals noch jungen Chosŏn-Dynastie durch Sejo 1455, der seinen Neffen Tanjong als König eliminierte. Aus Protest verzichtete Kim auf eine Karriere bei Hofe, verbrannte alle konfuzianischen Lehrbücher, mit denen er sich für die Staatsexamina präpariert hatte, schor sich den Kopf und durchstreifte fortan das Land als Wandermönch. Als er in den Sechzigerjahren des fünfzehnten Jahrhunderts am „Berg der goldenen Schildkröte“ in Kyŏngju Station machte, schrieb er wohl dieses Buch. Es übt Kritik an Heuchelei und Korruption bei Hofe und an unlauterer Ausübung des als „Mandat des Himmels“ verliehenen Regierungsauftrags.
Frustrierte Scholaren, die sich in Anderswelten stürzen
So sind Kims Helden meist mittellose, frustrierte Scholaren (der hohen Zahl an Absolventen standen wenige freie Ämter gegenüber), die sich aus dem Leid hienieden in leidenschaftliche Affären mit überirdischen Damen und Traumreisen in utopische Anderswelten und Sphären wie etwa Drachenpaläste stürzen. Dabei sind die bewundertenghost-wives nicht wie in den Geistergeschichten Chinas verführerische femmes fatales, sondern tugendhafte, um Karma-Akkumulation bemühte Wesen.
So wird in der Eingangserzählung „Eine Würfelpartie im Tempel des grenzenlosen Glücks“ der einsame Gelehrte Yang nach dem Gewinn einer Würfelpartie mit Buddha von diesem mit einer übernatürlichen Schönen als temporärer Gefährtin bedacht. Sie war ein Opfer des Krieges, und bis zur Wiederherstellung und Reinigung ihres Karmas dank der von Buddha initiierten Beziehung bleibt sie an Yangs Seite, bis sie in fernen Landen als Knabe wiedergeboren wird, woraufhin Yang sich ins Gebirge zurückzieht und Kräuter pflückt.
Einsiedelei und Ewigkeitssuche
„Reiseaufzeichnungen über trunkenes Wandeln“ erzählt von der Begegnung des Scholaren Hong mit einer daoistischen Unsterblichen in einer Mondnacht am Pubyŏk-Pavillon bei Pjöngjang. Hong wandelt sich nach deren Heimkehr ins Himmelreich selbst zum Unsterblichen. Der Rückzug seiner Helden nach dem Verlust der Geliebten auf Zeit oder gar deren Unsterblichkeitswerdung reflektieren Kims Biographie, seine Einsiedelei und Ewigkeitssuche. Als Protestpoet und spiritueller Wanderer schuf er eine in Anderswelten gekleidete Diesseitssatire. Herrschaftsanklage verbirgt sich in Parallelen zu früheren Usurpatoren – so ist im „Trunkenen Wandeln“ die Unsterbliche die Tochter des letzten Königs der legendären Kija-Dynastie, der vom Usurpator Wiman vom Thron verjagt wurde. Kims Gegenwart wird mit einer idealisierten Vergangenheit kontrastiert, wenn seine Figuren beim Ausblick vom Pavillon auf die verfallenen Prachtbauten Pjöngjangs den Untergang antiker Reiche bejammern.
Kims eigene Klagelieder über den Verrat konfuzianischer Tugend und die Gewinnmaximierung der Klöster waren eine herbe Zeitkritik: So fährt in der Traumerzählung vom „Kontinent des Feuerbrunstwallens im Süden“ ein „konfuser Konfuzianer“, der am Wahrheitsgehalt von „Geistern und Gottheiten“, also Himmel und Hölle, zweifelt, just ins Land des buddhistischen Unterweltfürsten Yama hinab. In beider Debatten über das Universum, Politik und Religion übt sich ausgerechnet Yama in Tiraden über Mönche, die „Schmiergelder von Sündern“ annehmen. Erleuchtung erfährt der Konfuzianer allein in puncto Unzulänglichkeit menschlicher Vertreter zeitgenössischer Lehrgebäude und Religionen.
Auch in Nordkorea – neben Pjöngjang ist das heutige Kaesŏng Schauplatz zweier Texte – ist Kims Buch Teil des Schulcurriculums. Wegen der Kritik am repressiven Feudalsystem wird es dort gepriesen, bei einigen subversiven Stellen allerdings auch zensiert. Einfluss übte es auf japanische Gespenstergeschichten wie die 1666 erschienenen „Otogibōko“ von Asai Ryōi aus. So ist das Buch auch ein wunderbares Beispiel für die frühe Zirkulation ostasiatischer Literatur und Geisteswelten.
Kim Sisŭp: „Neue Erzählungen von der goldenen Schildkröte“. Hrsg. und aus dem Schriftchinesischen von Dennis Würthner. Reclam Verlag, Ditzingen 2025. 172 S., geb., 38,– €.

 vor 6 Stunden
1
vor 6 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·