Es ist bezeichnend, wie Feda Abdelhady-Nasser, im Untertitel verkürzt oder vorauseilend „Stellvertretende palästinensische UN-Botschafterin“ genannt (trotz ausgeweiteter Rechte gilt Palästina bei den Vereinten Nationen immer noch als „Beobachterstaat“), über die Massaker am 7. Oktober 2023 spricht. Sie sagt dazu „Angriff der Hamas“, nicht Massenmord an israelischen Zivilisten. Oder an Juden, einfach weil sie Juden sind. Was sie gedacht habe beim Anblick der Bilder der mordenden Islamisten an diesem Tag, ist allen Ernstes Folgendes: „Wir dachten, jetzt fangen die Israelis schon wieder einen Krieg gegen Gaza an.“ Die Opfer werden zu Tätern gleich im ersten Satz.
Aussagen, die den Terror leugnen
Solche bis zur Terror-Leugnung reichenden Aussagen sind schwer zu ertragen in der zweiteiligen BBC-Dokumentation „Israel und die Palästinenser“, die Arte nun zeigt. Auch Chalid Maschal, lange Vorsitzender des Politbüros der Terrororganisation Hamas, kommt ausgiebig zu Wort. Den Mordrausch am 7. Oktober feiert er in den Worten: „Jetzt machen die palästinensischen Kämpfer mit ihren neuen Methoden der Feindbekämpfung Hoffnung. Die größten Träume erfordern die größten Opfer.“ Und sogar der vor den Augen der Welt durch einen israelischen Angriff in Teheran getötete Ismail Haniyya, Maschals Nachfolger von 2017 an, wurde einen Monat vor seinem Tod interviewt. Auch er darf Propaganda absetzen: „Die Hamas tötet keine Juden, weil sie Juden sind.“
Die Miniserie der renommierten Filmemacherin Norma Percy – Regie führten Tania Rakhmanova, Tim Stirzaker und Max Stern –, schließt an frühere, ähnlich prominent besetzte Dokumentarfilme Percys über die israelisch-palästinensische Geschichte an. Es ist das Markenzeichen der inzwischen über achtzig Jahre alten Produzentin, betont unparteiisch mit Schlüsselverantwortlichen politischer Konflikte zu reden. Für ihren Film „The Death of Yugoslavia“ hat sie 1995 Slobodan Milošević und Radovan Karadžić interviewt. Es bleibt aber dahingestellt, ob es nötig war, neben hochrangigen israelischen und US-Politikern und Beratern nicht nur Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde zu Wort kommen zu lassen, sondern auch Organisatoren des Terrors. Andererseits zeigen sie mit dem unverkennbaren Stolz auf das Massaker vom 7. Oktober ihr wahres Gesicht.
Der lange Weg in den Abgrund
In jedem Fall ist „Israel und die Palästinenser“ absolut sehenswert. Die Dokumentation, die nicht auf den gegenwärtigen Krieg blickt, sondern mit dem unvorstellbaren Angriff des 7. Oktober 2023 endet, zeichnet den langen Weg in den Abgrund nach: eine Abfolge des fatalen, aber nicht selten gewollten Scheiterns bei der Suche nach einer politischen Lösung des Nahostkonflikts. Die Darstellung beginnt nicht im Jahr 1948, mit der Gründung des Staats Israel (wie überhaupt nie das beliebte Urschuld-Narrativ gegen Israel bemüht wird), sondern im Jahr 2003, als der damalige israelische Ministerpräsident Ariel Scharon die Welt mit der Idee des Abzugs der israelischen Armee und der israelischen Siedler aus dem Gazastreifen überraschte und diesen gegen alle Widerstände im eigenen Land durchsetzte.
Im Gegenzug sollten dafür die größten jüdischen Siedlungen im Westjordanland auf Dauer gestellt werden. Die Bekämpfung der radikalen Kräfte wäre fortan Aufgabe der palästinensischen Sicherheitskräfte. Im Nachhinein darf dieser Plan als eine der größten Fehleinschätzungen der israelischen Politik gelten, denn damit war die Grundlage dafür geschaffen worden, dass die gestärkte islamistische Hamas 2007 die Herrschaft im Gazastreifen übernahm.
Es wird deutlich, was für eine Zumutung das nicht nur für die Menschen in Gaza bedeutete (zumal für Kritiker der Hamas), sondern auch für einen demokratischen Staat wie Israel. Er wurde von den engsten Nachbarn mit Terror überzogen: Bombenanschläge, Entführungen, Morde, Raketenangriffe, Tunnel tief ins eigene Land, die Ex-Hamas-Chef Maschal im Film „wichtige Waffen im Kampf gegen die Besatzung“ nennt. Niemand unter den Wohlstandslinken, die Israel heute wohlfeil Apartheid und Schlimmeres unterstellen, würde wohl unter diesen Umständen leben wollen oder können.
 Bilder von Menschen, die das Musikfestival Supernova besuchten und von Hamas-Terroristen am 7. Oktober. Die Aufnahmen gehören zu einer Erinnerungsausstellung, die an der Wall Street in New York zu sehen ist.Laif
Bilder von Menschen, die das Musikfestival Supernova besuchten und von Hamas-Terroristen am 7. Oktober. Die Aufnahmen gehören zu einer Erinnerungsausstellung, die an der Wall Street in New York zu sehen ist.LaifUnd doch trägt der erste der beiden Teile nicht ganz unbegründet den Titel „Ein möglicher Frieden“, denn es gab unter allen US-Präsidenten Versuche und Pläne, den Konflikt durch eine Zweistaatenlösung zu befrieden. Die Akteure selbst oder ihre engsten Berater berichten von diesen Verhandlungen. So zeigt der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert zum angeblich ersten Mal medienöffentlich jene Karte her, die er im September 2008 dem politisch geschwächten Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, vorgelegt hat.
Sie sah einen Rückzug aus dem größten Teil des Westjordanlands vor sowie einen Ausgleich für jene jüdischen Siedlungen, die erhalten bleiben würden, eine Weiterentwicklung von Olmerts sogenanntem „Konvergenzplan“. Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice zeigt sich im Film bis heute begeistert von dem Vorhaben. Abbas’ Stabschef Rafik Husseini wiederum gibt zu, man habe über den Vorschlag gelacht, weil man Olmert für zu schwach hielt, ihn durchzusetzen.
Dieser Teufelskreis aus gegenseitiger Geringschätzung, Misstrauen und Suche nach dem eigenen Vorteil sollte sich fortsetzen. Im September 2010 war es der neue israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich mit Abbas traf, wie die damals zuständige Vermittlerin, die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton, und ihr Stellvertreter Jeffrey Feltman im Film erzählen. Nun war Abbas bereit, multinationale Truppen unter Beteiligung Israels für bis zu fünf Jahre zu akzeptieren, aber diesmal lachte Netanjahu. Erst „in vielen Jahrzehnten“ würden die Palästinenser die Kontrolle über ihr Land erhalten. Damit waren die letzten Verhandlungen zwischen Abbas und Netanjahu über eine Zweistaatenlösung beendet. Weil von da an auf beiden Seiten die Hardliner mächtiger wurden, wurde eine gütliche Einigung immer unwahrscheinlicher. Auch wenn sich die Filmemacher mit Urteilen zurückhalten, ist zwischen den Zeilen herauszuhören, dass die sich heute unversöhnlich gegenüberstehenden Akteure den Krieg inzwischen brauchen, um innenpolitisch zu bestehen.
 Protest für Palästina: Bei der „United 4 Gaza“-Demonstration in Frankfurt nahmen mehr als 10.000 Menschen teil.Lucas Bäuml
Protest für Palästina: Bei der „United 4 Gaza“-Demonstration in Frankfurt nahmen mehr als 10.000 Menschen teil.Lucas BäumlUnd doch gab es auch unter Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden diverse Versuche, die beiden Seiten an den Verhandlungstisch zu bekommen. Sie alle sind gescheitert, das Misstrauen ist nur gewachsen. In der Dokumentation nehmen dazu Politiker wie der ehemalige US-Außenminister John Kerry, Trumps Botschafter in Israel, David Friedman (der die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem befürwortete), oder Trumps Nahost-Sondergesandter Jason Greenblatt Stellung, ebenso israelische Politiker und Sicherheitsberater sowie mehrere Mitglieder des Fatah-Zentralkomitees oder der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat.
Es ist sozusagen Geschichtsschreibung aus erster Hand, immer in die eine oder andere Richtung abgelenkt, aber durch die kluge Verschaltung der Perspektiven ergibt sich ein Eindruck von der Komplexität des Streits und von der Hartleibigkeit der beiden Parteien, die gefangen sind in ihrer weit zurückreichenden Feindschaft. So wittern sie hinter jedem Zugeständnis der Gegenseite eine Falle. Warum man eine Dokumentation dieser Güte zusammenschneiden muss – aus drei einstündigen Episoden bei der BBC wurden zwei –, erklärt sich indes nicht.
Israel und die Palästinenser läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei Arte und in der Arte-Mediathek.

 vor 18 Stunden
1
vor 18 Stunden
1



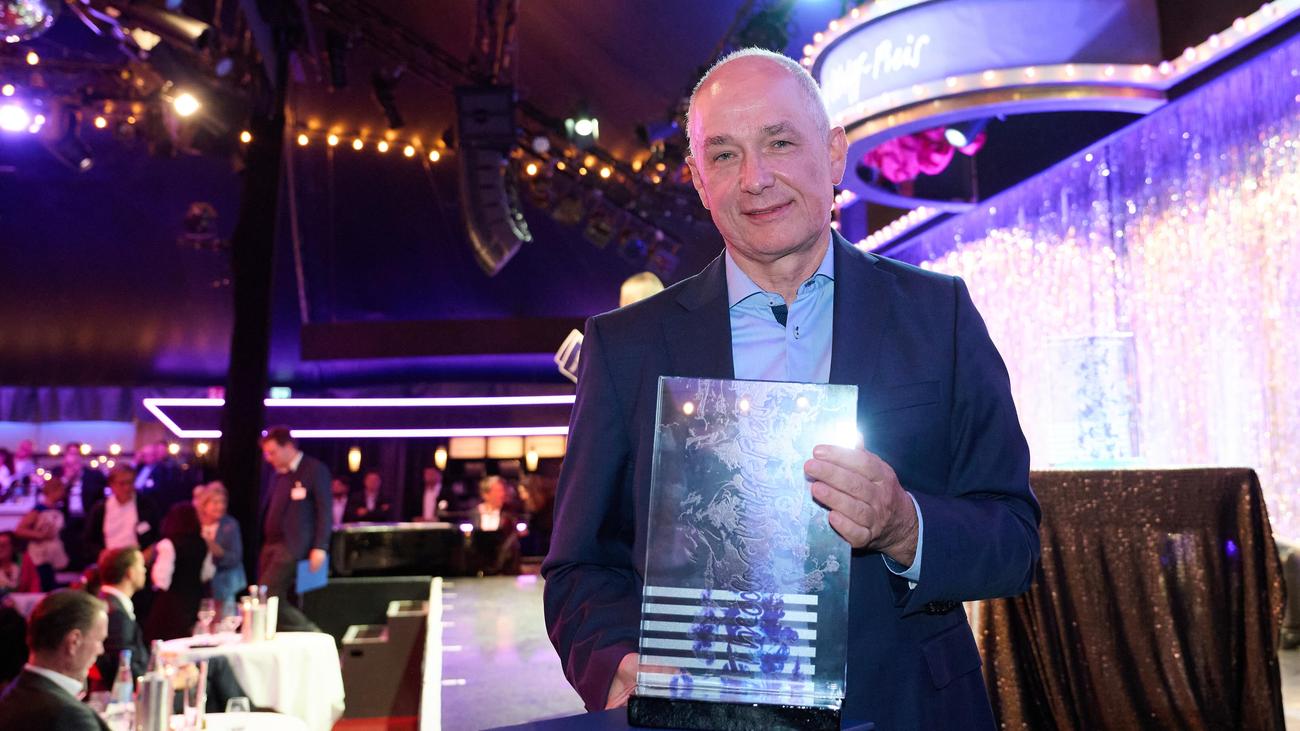







 English (US) ·
English (US) ·