Auch in der europäischen Wirtschaft wird der Ruf nach einem Moratorium bei der Anwendung der KI-Verordnung der EU lauter. Bisher betrieben vor allem große Tech-Unternehmen aus den USA Lobbying gegen das umfassende Regelwerk für Künstliche Intelligenz. Jetzt machen die Chefs von 46 großen europäischen Unternehmen, Foren und Verbänden gegen die Vorgaben mobil. In einem offenen Brief vom Donnerstag fordern sie die EU-Kommission nachdrücklich auf, den AI Act zwei Jahre lang auszusetzen, "bevor die wichtigsten Verpflichtungen in Kraft treten".
"Europa zeichnet sich seit Langem durch seine Fähigkeit aus, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Regulierung und Innovation zu finden", heißt es in dem Schreiben. Dieses "europäische Modell" sei "insbesondere im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung, deren Auswirkungen als transformative Technologie weit über den Technologiesektor hinausreichen". Leider werde dieses Gleichgewicht mit dem AI Act "derzeit durch unklare, sich überschneidende und zunehmend komplexe EU-Vorschriften gestört". Dies gefährde Europas KI-Ambitionen, da nicht nur die Entwicklung europäischer Champions unterlaufen werde. Es gehe auch um "die Fähigkeit aller Branchen, KI in dem für den globalen Wettbewerb erforderlichen Umfang einzusetzen".
Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören Manager von Airbus, ASML, Lufthansa, Mercedes-Benz, Mistral, Siemens Energy und United Internet. Sie beschäftigen nach eigenen Angaben Hunderttausende Mitarbeiter in der EU, um deren Wohlergehen sie sich sorgten. Die Kommission müsse ihre Bemühungen, die Anwendung der KI-Verordnung im Interesse kleiner wie großer etablierter Unternehmen zu vereinfachen, beschleunigen. Sie alle würden zu Innovationsförderung beitragen, "wenn sie von klaren und vorhersehbaren Regeln profitieren können".
Debatte über Moratorium
Die Beteiligten begrüßen "die jüngsten Diskussionen über die Notwendigkeit, die Durchsetzung der KI-Verordnung zu verschieben." Derzeit würden noch immer relevante Richtlinien und Standards entwickelt; verschiedene Branchen arbeiteten zusammen, "um Lösungen zu finden, die für alle funktionieren". Die verlangte Auszeit sollte sowohl für Verpflichtungen gelten, die im Zusammenhang mit Hochrisiko-KI-Systemen ab August 2026 in Kraft treten sollen, als auch für die Auflagen für allgemeine KI-Modelle. Letztere greifen prinzipiell von Anfang August 2025. Die Bundesnetzagentur hat gerade einen KI-Service-Desk in Betrieb genommen, um Firmen und Organisationen bei der Einhaltung des AI Acts zu helfen. In Österreich führt die Regulierungsbehörde RTR die vergleiche KI-Servicestelle.
Die Kommission hat – unter Protest von EU-Abgeordneten – vor Monaten angekündigt, dass die zunächst geplante zusätzliche Verordnung über die Haftung beim Einsatz und der Entwicklung von KI entfallen soll. Sie hätte vor allem zivilrechtliche Verantwortung klären sollen, die sich bei KI-Einsatz ergibt. Henna Virkkunen, Kommissionsvizepräsidentin für technische Souveränität, hat inzwischen auch durchblicken lassen, sie werde bis Ende August entscheiden, ob die weitere Umsetzung der KI-Verordnung verschoben werden soll. Das komme für sie aber nur infrage, wenn ein geplanter einschlägiger Verhaltenskodex nicht rechtzeitig fertig wird.
Über 150 Manager europäischer Unternehmen haben schon vor zwei Jahren im Vorfeld des Beschlusses des AI Acts an die EU-Gesetzgeber appelliert, den Plan zur KI-Regulierung zu überdenken. Vor allem bei Systemen generativer KI wie ChatGPT, Gemini oder Claude drohten sonst Rückschläge.
(mho)


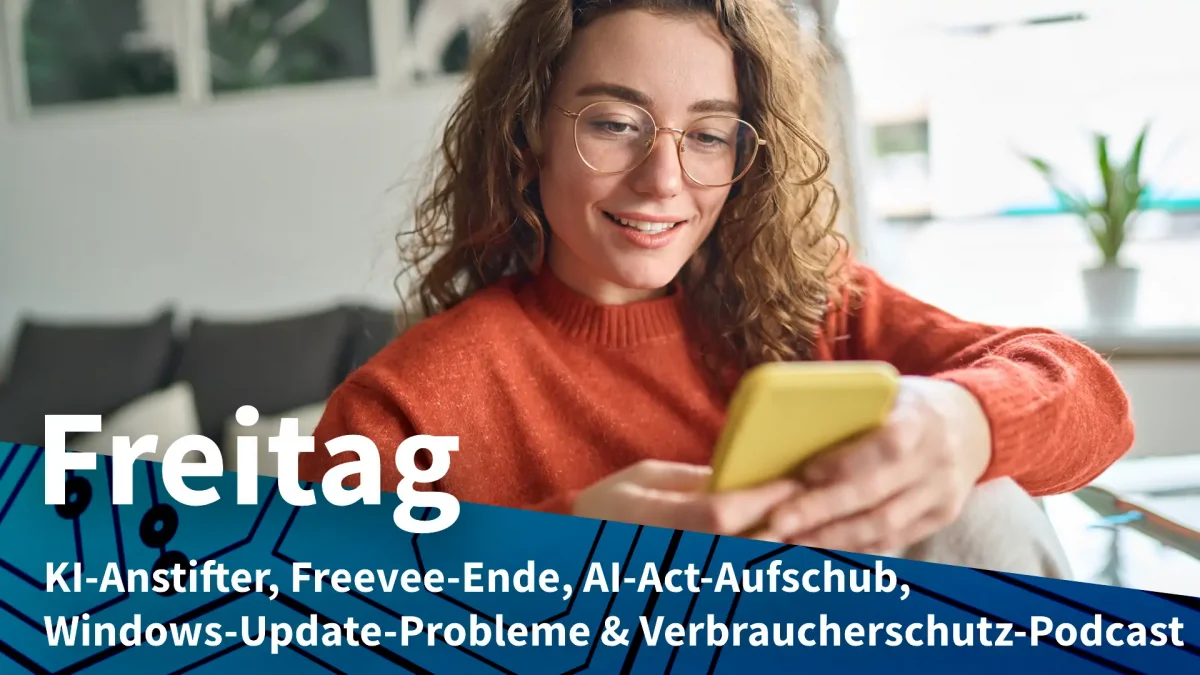








 English (US) ·
English (US) ·