In den schlesischen Bergen, bei den sieben Zwergen, dort, wo Polen und Tschechen sich heute über den Gebirgskamm hinweg gute Nacht sagen, liegt eine deutsche Ruine. Wenn die Morgensonne durch den Nadelwald bricht, leuchtet der rote Backstein, als wäre das Mauerwerk erst gestern hochgezogen worden. Aber nein: Was den Besucher hier so farbenfroh begrüßt, ist das Werk mühsamer Renovierung und Wiederaufbau. Das neogotische Gebäude mit seinem schlanken Türmchen war seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts, noch zu deutscher Zeit also, eine berühmte Lungenheilanstalt gewesen. Später wechselte der Bau mehrfach den Besitzer, bis das Sanatoriumsgebäude nach mehreren kleinen Bränden (man vermutet Brandstiftung) 2005 so richtig in Flammen aufging. Dächer und Fußböden waren großenteils weg, aber die Ziegelmauern hielten stand.
Etwas später kaufte eine kleine private Stiftung aus Warschau die Ruine für wenig Geld und begann ihr Werk. Noch ein paar Jahre vergingen, und Olga Tokarczuk, gerade erst mit dem Nobelpreis geehrt, machte den Ort zum Schauplatz ihres 1913 spielenden Romans „Empusion“, den sie selbst einmal als „ironische Paraphrase“ des „Zauberbergs“ bezeichnete. Darin gerät ein junger polnischer Patient in diesem Kurort in die Gesellschaft aggressiv-misogyner Herren; eine Frau stirbt, am Ende wird ein Mann im Wald (von Rachegöttinnen?) zerfetzt. Dem polnischen Untertitel zufolge ist das amüsant geschriebene Buch ein Horrorroman, was die deutsche Übersetzung als „Schauergeschichte“ wiedergibt.
Am kulturell produktivsten polnischen Ort
Wir sind in Sokołowsko, dem früheren Görbersdorf, fünfhundert Einwohner, kaum zwei Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Weiter nördlich, eine halbe Stunde Busfahrt entfernt, liegt Waldenburg (Wałbrzych), eine Stadt mit nach 1989 stillgelegten Steinkohlegruben und Abraumhalden. Die sozialen Verwerfungen der Nachwendezeit sind hier in vielen Gesprächen zu spüren. Im letzten Herbst forderte ein Hochwasser in diesem Teil Polens neun Todesopfer; hier und da sieht man noch von den Fluten aufgerissenes Erdreich. Manche halten Waldenburg für Polens hässlichsten und depressivsten Ort, andere jedoch für einen der interessantesten und kulturell produktivsten: Die Suhrkamp-Autorin Joanna Bator stammt aus der Stadt, der sie im Roman „Sandberg“ ein Denkmal gesetzt hat. Tokarczuk kommt aus dem Nachbarörtchen Neurode (Nowa Ruda) und lebt großenteils immer noch dort. Zwei ehemalige Bergwerke im Kreis Waldenburg sind zu Kulturstätten umgestaltet worden. Die stillgelegte Porzellanfabrik ist neuerdings Porzellanmuseum.
 Kulturaktivistinnen von GörbersdorfGerhard Gnauck
Kulturaktivistinnen von GörbersdorfGerhard GnauckDa fügt es sich gut, dass auch das kleine Görbersdorf, gleichsam von höchster Instanz, literarische Weihen bekommen hat. Jetzt hofft man hier auf Kulturtouristen; kürzlich hat sich eine Initiative zusammengefunden, die einen „Empusion-Pfad“ anlegen will, auf dem wandelnd man die Orte aus Tokarczuks Roman abschreiten kann. In Görbersdorf wurde Medizingeschichte geschrieben: 1854 begann der Breslauer Tuberkulosespezialist Hermann Brehmer hier Patienten aufzunehmen, anderthalb Jahrzehnte später baute er die Anlage zum „Schloss“ aus. Kranke reisten von weither an, zum Beispiel aus Russland. Für sie wurde eine orthodoxe Kapelle gebaut, roter Backstein mit goldenem Zwiebelturm; sie wird heute von einem Priester der polnischen orthodoxen Kirche betreut.
So erfolgreich wurde Görbersdorf, dass eines Tages eine ärmlich wirkende Delegation aus dem schweizerischen Dorf Davos angereist kam mit dem Anliegen, von den hiesigen Heilmethoden zu lernen. „Dieser Ort war das Ur-Davos“, sagte Tokarczuk einmal, „und die Schweizer haben die hiesigen Rezepte so erfolgreich angewandt und das Ganze so laut hinausposaunt, dass Davos aufblühte und sich dort heute jeden Winter die mächtigsten Leute der Welt treffen. Aber in Görbersdorf sehen wir einen Ort in den Schattierungen des Niedergangs. Ist das nicht eine Metapher für unser Mitteleuropa? Hier entstanden viele Ideen, die dann nach Westen wanderten oder sogar über den Ozean, aber hier stirbt alles ab.“ Das vom Gletscher des sowjetischen Kommunismus befreite, immer noch niedergedrückte Mitteleuropa – eine Zone der Depression, aus der nicht nur die Menschen auswandern, sondern auch geistige Güter.
Die schlesischen Berge sind wieder attraktiv
Dabei hat in den letzten Jahrzehnten eine gegenläufige Wanderung eingesetzt: hinein in die schlesischen Berge. Dutzende Polen aus den Metropolen haben in diesem Tal Wohneigentum erworben, auch einige Ausländer sich niedergelassen. Suchen wir also nach „In situ“ (lateinisch für: am Ort), jener Organisation mit sechs Mitarbeitern, die sich die Herkulesarbeit vorgenommen hat, aus der Ruine von Görbersdorf ein „internationales Kulturlabor“ zu machen.
Zuzanna Fogtt, eine resolute Frau von Mitte dreißig, und ihre Mutter Bożenna Biskupska leiten diese Stiftung, und sie wohnen inzwischen auch hier, in der Villa Rosa, die zugleich als Künstlerresidenz dient. Das Abenteuer der beiden – und des inzwischen verstorbenen Lebensgefährten Biskupskas, Zygmunt Rytka, Warschauer Künstler wie sie – hatte mit der Stiftungsgründung 2004 begonnen, zufällig im Jahr von Polens EU-Beitritt. Lange suchten sie nach einem Ort, an dem sie wirken konnten. Sie fanden ihn in Görbersdorf. Sie kauften die Ruine.
 Im Einsatz für Kieślowsk: Zusanna Fogtt mit einer Kamera aus dem nachlass des FilmregisseursGerhard Gnauck
Im Einsatz für Kieślowsk: Zusanna Fogtt mit einer Kamera aus dem nachlass des FilmregisseursGerhard GnauckFrau Biskupska, ganz in Schwarz gekleidet, führt durch das Gemäuer. In den Räumen des Backsteinbaus sind Installationen polnischer und ausländischer Künstler zu sehen, auch einige ihrer eigenen Werke. In der lichtdurchfluteten einstigen Orangerie des Sanatoriums steht das „Mysterium der Zeit“, eine Gruppe wuchtiger, mehr als mannshoher, zumeist kopfloser Figuren. Sie bestehen im Wesentlichen aus in Harz getränkten Sägespänen und Leinenstoff und erinnern entfernt an die „Abakane“, die berühmten Skulpturen der Bildhauerin Magdalena Abakanowicz. An einer Wand steht eine Reihe kleinerer verkohlt wirkender Holzfiguren. Dieser Zyklus trägt als Namen einen den horazischen Oden entnommenen Satz, „non omnis moriar“ (Ich werde nicht ganz sterben), den, christlich gedeutet, in Polen fast jeder kennt.
Der Einsatz für den bedeutendsten polnischen Filmregisseur
„Ich bin kurz nach 1945 geboren“, sagt Biskupska, „wir lebten im Odium der Kriegszeit. Ich wagte nicht, so direkt daran anzuknüpfen. Aber ich wollte in schlichten Formen ausdrücken, dass der Mensch, dieser Menschheitsgeschichte zum Trotz, weiter besteht, sich verändert, ausharrt. So wollte ich ihn zeigen.“ Der erste Zyklus war 1984 auf der Biennale in Venedig zu sehen; der zweite ist nach 25 Jahren in der Gedenkstätte Auschwitz kürzlich zur Künstlerin zurückgekehrt. In einem anderen Raum schließlich ist in verschiedenen Konstellationen der „jednonogi“ zu sehen, der deutlich als Mensch zu erkennende „Einbeiner“. Er ist, in sehr verschiedenen Größen auftretend, das Markenzeichen dieser Künstlerin; vielleicht verkörpert er, stabil auf einem starken, mittig angesetzten Bein ruhend, Stehvermögen, Widerstandskraft trotz seiner überdeutlichen Behinderung.
Olga Tokarczuk ist nicht die einzige Schutzpatronin des Sokołowsko-Projekts. Der andere Patron war schon vor ihr ins Blickfeld der beiden Aktivistinnen getreten: der Filmregisseur Krzysztof Kieślowski (1941 bis 1996). Dessen Vater war lungenkrank, weswegen die Familie nach 1945, im neu besiedelten Schlesien, mehrere Jahre in Görbersdorf lebte. Jetzt übernimmt Tochter Zuzanna die Führung. Sie führt in einem Nebengebäude in einen Raum, für den ein strenges Rauchverbot gilt, und öffnet Kartons und Aktenordner. „Das ist das Archiv des Werks von Kieślowski, das ich leite. Schauen Sie, das ist die Kamera, mit der Kieślowski die sogenannte ‚Farben‘-Trilogie zu den Themen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gedreht hat.“ Sie zeigt ein Foto, auf dem der Regisseur, todernst, neben seinem aus vollem Hals lachenden Kollegen Wim Wenders zu sehen ist. „Jetzt organisieren wir hier in den Sommermonaten jedes Jahr drei Festivals, das größte ist unser Filmfestival, da kommen etwa tausend Gäste. Wir werben um interessante Personen; leider kann Wenders dieses Jahr nicht kommen.“
Die Stiftung hat inzwischen alle Drehbücher Kieślowskis digitalisiert. Zuzanna Fogtt nennt ihn den heute weltweit bekanntesten polnischen Filmemacher, womit sie recht haben könnte: Zwar hat er nicht, wie sein Zeitgenosse Andrzej Wajda, einen Oscar gewonnen, doch seine späten Filme, insbesondere der „Dekalog“ mit den Studien über das Töten und über das Lieben sowie die „Farben“-Trilogie sprachen ein Publikum auf allen Kontinenten an.
Wie finanziert sich dieser Wiederaufbau?
Neben dem Filmfestival, das neue Kinoproduktionen in den Ort holt und „mit Kieślowski in einen Kontext setzen will“, organisiert die Stiftung jeden Sommer auch eine Veranstaltung zu Neuer Musik („Sanatorium of Sound“) sowie das Festival „Kontexte“ für Performance und andere ephemere Kunstformen. Auf ein Massenpublikum kann man da kaum zählen, doch dafür auf spezialisierte Besucher aus vieler Herren Ländern. Hinzu kommen Ereignisse wie eine zwei Tage währende Rund-um-die-Uhr-Lesung aus dem „Zauberberg“, an der sich jeder Besucher beteiligen konnte.
Irgendwann fragt sich der westlich sozialisierte Homo oeconomicus, woher die mutmaßlich brotlosen Künstler die Mittel nehmen für diesen schlesischen Wiederaufbau, dazu für die Gestaltung von etwas ganz Neuem. Zuzanna überschlägt: Nach dem Kauf habe man bisher an die zwanzig Millionen Złoty in die Wiederherstellung des Gebäudes gesteckt (knapp fünf Millionen Euro). „EU-Fördermittel haben wir wohl nur einmal bekommen, für die Renovierung eines 600 Quadratmeter großen Saals, das waren etwa zwei Millionen Złoty. Und die Mittel für Denkmalpflege, wie sie die Gebietskörperschaft auf Niederschlesien verteilt, betragen nur zwei Millionen im Jahr. Die Region um Warschau, Masowien, bekommt das Zehnfache. Dabei haben wir mehr Baudenkmäler!“
Leider hat das Hochwasser auch das einstige Sanatorium getroffen. Zuzanna zeigt Fotos der verschlammten Kellerräume. „Aber die EU-Programme für Hochwasserhilfe gelten für uns nicht. Überhaupt: Die meisten Nichtregierungsorganisationen, die hier verfallene Schlösser renovieren, kommen in viele große Förderprogramme gar nicht rein, die Hürden sind zu hoch“, beklagt sie. Das gelte etwa für den von Brüssel 2022 genehmigten „Europäischen Fonds für Infrastruktur, Klima und Umwelt“, dessen polnische Abkürzung sinnigerweise „Feniks“ (Phoenix) lautet.
Die Lösung für Görbersdorf? „Meine Mutter und ihr Partner haben einige Millionen Złoty aus dem Verkauf ihrer Kunstwerke hier reingesteckt. Sie will, dass hier ein Raum, von Künstlern für Künstler geschaffen, sich erweitert, blüht und gedeiht.“ Wie viel wird man dafür noch brauchen? Am einstigen Sanatorium ist noch einiges zu tun. „Wir schauen mal. Hauptsache ist: Stein auf Stein, es geht voran.“
Das Treffen mit Ooga Tokarczuk
Szenenwechsel: Ein Treffen mit Olga Tokarczuk im Café. Die Schriftstellerin kommt mit ihrem Hund Timi, einem Münsterländer, weil der allein zu Hause die Wände hochgehen würde. Ein Interview hatte sie abgelehnt, auch die Themen markiert, zu denen sie sich jetzt nicht äußern wolle: Politik im engeren Sinne, Trump, die im Mai anstehende Präsidentenwahl in Polen. Wir erinnern uns: Die letzten Jahre hatten ihr und ihren Angehörigen zugesetzt; erst die Pandemie, dann Russlands Krieg gegen ein friedliches Nachbarland. Und die ganze Zeit über der Macht- und Kulturkampf in Polen, bei dem auch sie, wenn sie einen aus Sicht des rechten Lagers falschen Satz sagte, in den sozialen Medien zur Zielscheibe wurde.
Daran gemessen, scheint sie jetzt doch recht gut aufgelegt zu sein. Und sie schreibt gerade, weitgehend abgekapselt, an etwas Neuem. „Es wird ein Roman, mein letzter großer Roman, denke ich. Und zugleich eine Hommage an alle, die in Niederschlesien gelebt haben, und über dieses Phänomen der Entvölkerung und dann Bevölkerung einer Region, vor und nach 1945. Das wollte ich schon immer schreiben.“ Da darf nicht mal ihr Mann sie stören, allenfalls Timi. Nur hin und wieder ein öffentlicher Termin: im Februar in Brüssel, aus Anlass der polnischen EU-Ratspräsidentschaft, da diskutierte sie vor 1500 Zuhörern über „Empusion“. Im März dann, für sie zum neunten Mal, eine Ehrenpromotion, diesmal an der Sorbonne. Dann zwei Lesungen in Sachsen, wiederum mit „Empusion“ und ihrem nach dreißig Jahren jetzt erstmals ins Deutsche übersetzten psychologischen Roman „E. E.“, der im deutschen Breslau der vorigen Jahrhundertwende spielt. Als Nächstes stehen Kiew und Lemberg auf dem Programm.
Tokarczuk freut sich über die Aktivitäten in Görbersdorf. „Der Empusion-Pfad ist ein schönes Kompliment: Das Buch wird zu Materie.“ Und wie den Aktivistinnen am Schauplatz des Romans, so ist es auch ihr nicht genug, nur Kunst um der Kunst willen zu betreiben. So hat sie die „Stiftung der Olga Tokarczuk“ gegründet: Die Nobelpreissumme floss dort hinein; der Staat kam ihr entgegen, denn – sie lacht – „Nobelpreisgelder sind in Polen laut Gesetz steuerfrei“. In Breslau, wo sie einen Teil ihrer Zeit verbringt, hat die Stadt eine kleine Villa renoviert und ihr zur Verfügung gestellt als Sitz der Stiftung und zugleich Residenz für jeweils zwei Schriftsteller, die zuletzt vor allem aus der Ukraine und Belarus kamen. Außerdem organisiert die Stiftung jeweils im Juli in Neurode und Umgebung ein Literaturfestival (Thema in diesem Jahr: „Manipulation und Hassrede“) und in Berlin und anderen Hauptstädten Übersetzerwerkstätten.
Vernetzung ist angesagt. „Wir knüpfen viele Allianzen, um transnational zu wirken. International, das ist überholt. Transnational, denn es gibt nur eine Kultur Europas, wenn auch in verschiedenen Sprachen.“ Dabei hat Tokarczuk vom mächtigen Deutschland kein unkritisches Bild. Schließlich hätten die westlichen Nachbarn ihre Heimat Polen, wie sie halb diplomatisch, halb flapsig formuliert, mehrfach in der Geschichte „aus Europa hinausgekickt“. Eine „leichte Arroganz“ habe sie von Deutschen sehr oft zu spüren bekommen. Sie seufzt: „Als wir in den Neunzigern als junge Leute nach Deutschland fuhren, hat man uns schon etwas als Wilde betrachtet. Das sind sehr subtile Eindrücke, ich kann da jetzt kein Beispiel nennen, das müsste man über mehrere Seiten beschreiben.“ Aber damals war Deutschland, war Westeuropa für viele noch der goldene Westen. Eine gewisse Ernüchterung über das Nachbarland scheint heute unter polnischen Intellektuellen verbreitet zu sein. Zwei ihrer Freunde, sagt sie, seien aus Berlin kürzlich zurück nach Polen gezogen.
Lob der deutschen Sensibilität
Aber Tokarczuk – da ist sie ganz die einfühlsame oder „zärtliche Erzählerin“, von der sie in ihrer Nobelpreisrede gesprochen hatte – mag über Berlin nicht lästern. Im Jahr 2000 war sie für ein Jahr als DAAD-Stipendiatin in die gerade zur vollwertigen Hauptstadt gemauserte Metropole gekommen. „Berlin ist für mich nach wie vor“ – sie sagt es mit allem Nachdruck – „eine mythische Stadt. Ich verdanke ihr sehr viel, und ich liebe sie irgendwie. Sollte Berlin in trüber Stimmung sein, wäre ich sehr besorgt.“ Ihre Lesereisen hätten ihr gezeigt: „Die deutsche Sensibilität beim Lesen ist super, die Leute dort sind genau, sind empfindsam, sie nehmen sich zu Herzen, was sie lesen. Ach, ich habe den Eindruck, die polnische und die deutsche Kultur sind sich außerordentlich ähnlich. Nur will sich niemand dazu bekennen.“
Kaum zu vermeiden, an dieser Stelle Marcel Reich-Ranicki zu erwähnen. Tokarczuk reagiert auf diesen Namen – wie viele polnische Literaten – geradezu unwirsch. Sie denkt dabei offenbar an ein „Literarisches Quartett“ im Jahr 2000, in dem der Kritiker den polnischen Schriftstellern der Gegenwart deren angebliche Sehnsucht nach dem Dörflichen, dem Primitiven und Provinziellen, ja sogar eine „Abwendung von der Zivilisation“ vorgeworfen hatte. Er nannte die Namen Magdalena Tulli, Andrzej Stasiuk und Olga Tokarczuk. Das könne doch nicht die Zukunft der polnischen Literatur sein, hatte Reich-Ranicki damals geschlossen – „aber vielleicht irre ich mich“.
Die Autorin hat ihre eigene Vision: Deutsche und polnische Kultur seien im Grunde „zwei Versionen von ein und demselben. Aber die Deutschen wollen nicht zugeben, dass sie mit diesem slawischen Tohuwabohu etwas gemein haben, dass es sie anzieht. Die Polen wiederum wollen keine Gemeinsamkeit mit jenen eingestehen, die am Krieg beteiligt waren, die den Krieg ausgelöst haben und die, Sie wissen schon, dieses Stereotyp . . .“ Plötzlich meldet sich Timi zu Wort, der Münsterländer. Er braucht Bewegung. Die Sitzung ist beendet. Nur ein versöhnlicher Satz noch zum Ende, von der polnischen Nobelpreisträgerin aus Schlesien: „Aber wenn ich aus der Ferne nach Europa zurückkehre, ist die deutsch-polnische Grenze wirklich nur noch symbolisch.“

 vor 15 Stunden
5
vor 15 Stunden
5



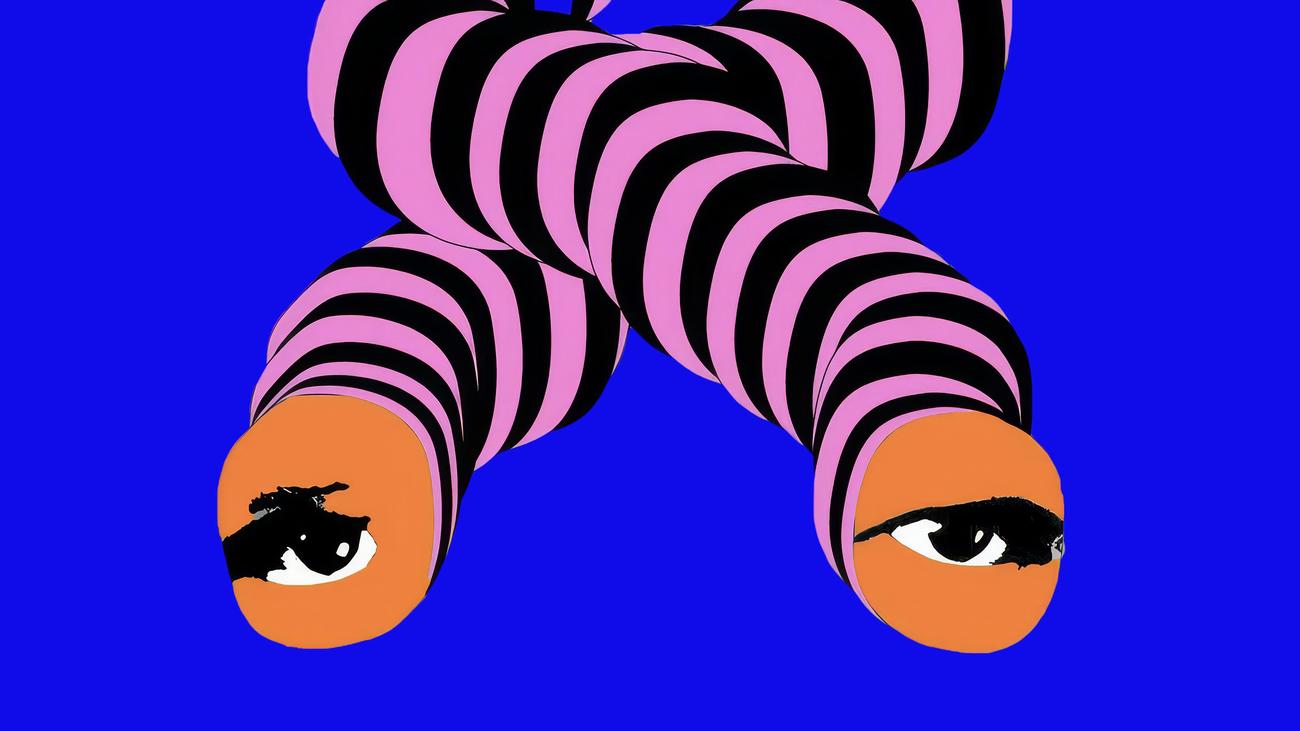







 English (US) ·
English (US) ·