Wer Anton Corbijn auf Instagram folgt, ist nicht allein. 282 Tausend Menschen haben seinen Account abonniert. Was bekommen sie zu sehen? Zuletzt vor allem Bilder von gerade Verstorbenen: David Lynch, Marianne Faithfull, Clem Burke von Blondie. Lauter Prominenz aus Punk, Pop und der Avantgarde-Kunst. Von dort also, wo Corbijn seit so langer Zeit ein und aus geht, dass er nicht mehr nur Chronist mit dem Fotoapparat ist, sondern längst zum Freund vieler Künstler wurde – und in manchen Fällen zugleich zuständig für deren Marketing ist. E
Anton Corbijn fotografiert Schallplatten-Cover, dreht Musikvideos und entwirft Bühnenshows wie für Depeche Mode. Die Liste derer, mit denen er seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, ist lang und reicht von Tom Waits über U2 bis zu den Rolling Stones. Jetzt wird die Liste derer, die er überlebt hat, immer länger. Nicht wenige seiner Arbeiten stehen ikonengleich für beide.
Kunst als Religion
Und da ist es schon, dieses Wort, das Corbijn nicht hören mag, aber ohne das kein Beitrag über ihn auszukommen scheint: Ikone, das Kult- und Heiligenbild. Begreift man die Kunst als die Religion unserer Tage und den Museumsbesuch als spirituelles Erlebnis, dann ist dieser Begriff so schlecht nicht. Er beschreibt auch, was in seiner aktuellen Ausstellung im Kunstforum Wien los war, als zur Eröffnung die Türen wegen zu großen Andrangs geschlossen wurden.
Corbijn lehnt den Begriff ab, weil er keine Aufnahmen von Stars mache, sondern von Menschen. Er wolle Gesichter zeigen und Porträts schaffen, die auch denen etwas mitteilen, die von der Person noch nie gehört haben. In Wien hat er deshalb für den ersten Raum zwei Aufnahmen von Künstlern mit Downsyndrom sowie einer Stripperin ausgewählt. Sein Gesamtwerk aber ist ein Who’s who der Populärkultur und mit Malern und Bildhauern von Gerhard Richter über Anselm Kiefer bis Ai Weiwei längst auch der hohen Kunst. Es ist ein Archiv, wie es vermutlich kein zweiter Fotograf geschaffen hat. Wer fehlt? Die Vertreter einer Glitzerwelt. Madonna, Britney Spears und Cher. Womöglich sind sie ihm zu glatt.
 Selfies kann er auch: Anton Corbijn mit der italienischen Schauspielerin Alessandra Mastronardidpa
Selfies kann er auch: Anton Corbijn mit der italienischen Schauspielerin Alessandra MastronardidpaWer heute eine Liste der Stars zusammenstellte, käme kaum umhin, Corbijn mit daraufzusetzen. Wenn er sie trifft, begegnet er ihnen auf Augenhöhe. Manches sind Freundschaftsdienste, vieles kommerzielle Aufträge, Etliches entsteht als freie Arbeit. Einen Unterschied hat er nie gemacht. Und alle Arbeiten dieses Corbijn-Universums umkreisen die immer selbe Frage: Wie wahr kann ein Foto sein? Dem Missverständnis, dass eine Fotografie die Seele eines Menschen bloßlegen könne, ist er nie erlegen. Pop ist Pose.
Wer versucht, sie zu durchkreuzen, erweitert nur den ikonographischen Vorrat des subkulturellen Glamours. Keine Weise, sich der Prominenz zu nähern, ist der Gefahr enthoben, innerhalb des medialen Spiels selbst zur Konvention zu erstarren. Und wenn Corbijn nach Spuren der Brüchigkeit im Showgeschäft sucht, nach Narben in den Gesichtern, dann ist das nur eine andere Art der Stilisierung: die Anti-Pose.
David Bowie als Messias
Doch was ist ihm nicht alles gelungen! Marianne Faithfull am Morgen nach einer durchzechten Nacht, Zigarette in der Hand, Kaffeetasse vor sich, gekleidet im Spitzen-BH, wird ihm zur Verkörperung der Seeräuberjenny. David Bowie mit einem Tuch um die Lende, sonst nackt, der Blick seltsam leer, wird zur Darstellung des Messias. Ausgerechnet die Grunge-Schlampe Courtney Love dient ihm als Modell für Botticellis schaumgeborene Venus. Es sind Aufnahmen, die das Image der Künstler maßgeblich prägen. Corbijn spricht vom „Abenteuer“ des Fotografierens und Fotografiertwerdens. Es sei ein gemeinsames Experimentieren, manches ist düster-dramatisch, manches heiter-verspielt.
Die Fragilität des Menschen nennt er sein Lebensthema. Trotz des formal augenfälligen Dreisprungs von grobkörnigen, düsteren Schwarz-Weiß-Fotografien mit Kleinbild in den Achtzigerjahren über braungetönte Porträts mit Mittelformat in den Neunzigern zu den wandfüllend vergrößerten Polaroids in stechendem Blau steht hinter diesen Bildern allerdings auch diese Frage: Was eigentlich soll unwahr an der Maske sein?
Auf einen Höhepunkt trieb Corbijn seine Auseinandersetzung mit der Darstellung von Stars und der Frage nach der Fassade mit der Serie „A. Somebody“ – zu gut Deutsch: Anton Irgendwer. Corbijn hat sich dafür den Physiognomien verstorbener Rockmusiker anverwandelt, so überzeugend, dass man ihn tatsächlich für John Lennon und Frank Zappa, Bob Marley und sogar Janis Joplin hält. Jedes Mal ein neues, berühmtes, gefälschtes Gesicht – doch meist derselbe nachdenkliche Blick.
Es sind Augenblicke der Selbstverlorenheit, bisweilen des Zweifels, und es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, wie er – gleich einem viel zu frühen Alterswerk – mit dieser Serie das Resümee seiner Arbeit zu ziehen schien. Mit den Toten kommentiert er den Kult um die Stars und damit auch die Rolle der Fotografie. Es ist, als habe er hier die Motive von jener vollkommenen Intimität schaffen können, die den Fotografen gewöhnlich vorenthalten bleibt. Heute wird er siebzig.

 vor 10 Stunden
1
vor 10 Stunden
1









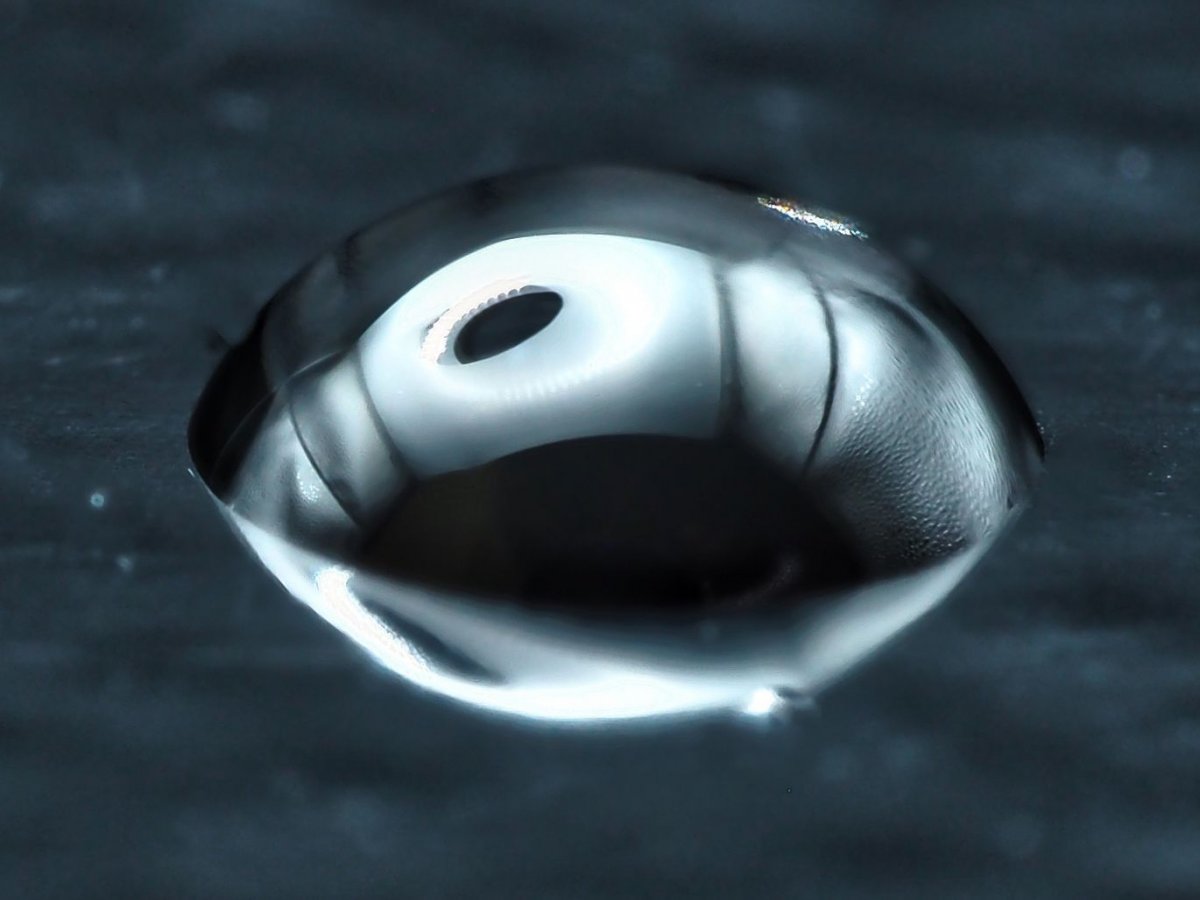

 English (US) ·
English (US) ·