Mit Gesetzen will die Europäische Union das Internet besser machen. Aber jetzt sind die Milliardenstrafen gegen Meta und Apple Teil des Handelsstreits mit den USA.
23. April 2025, 19:57 Uhr

Als vor etwas mehr als einem Jahr, im März 2024, der Digital Markets Act (DMA) nach einer anderthalbjährigen Übergangsfrist verpflichtend in Kraft getreten ist, war der Anspruch an das Gesetz über digitale Märkte klar: Zusammen mit dem Digital Services Act (DSA) sollte es den EU-Mitgliedsstaaten neue Möglichkeiten bieten, die Marktmacht großer Internetplattformen und Techkonzerne zu regulieren, um einen fairen und offenen Wettbewerb im Netz zu garantieren. Manche sprachen von einem "Grundgesetz für das Internet" – von dessen Geist sich möglicherweise sogar die Gesetzgeber in den USA etwas abschauen könnten.
Damals war allerdings Donald Trump noch nicht US-Präsident, und es gab keinen Handelsstreit zwischen Europa und den USA. Anders als jetzt, wo erstmals Geldbußen im Rahmen des DMA verhängt wurden. Ob gewollt oder nicht: Diese Strafen werden nun im Kontext dieses Konflikts bewertet.
Apple muss 500 Millionen Euro zahlen, Meta 200 Millionen Euro, da sie gegen die Regeln des DMA verstoßen. Zu dieser Einschätzung kamen die Verantwortlichen der EU-Kommission am Mittwoch nach dem Ende von Untersuchungen, die im vergangenen Sommer begannen. Die beiden Firmen haben angekündigt, die Entscheidung anzufechten.
Apple wirft die EU-Kommission vor, App-Entwickler daran zu hindern, ihre Nutzerinnen und Nutzer auf günstigere Angebote außerhalb des App-Stores zu lenken. Würden sie etwa auf einer Website ein Abo abschließen, dann könnte dieses günstiger sein als im App-Store, wo Apple zwischen 15 und 30 Prozent Provision verlangt. Apple untersagt Entwicklern deshalb, Preisinformationen innerhalb der App anzuzeigen, was der EU-Kommission zufolge den DMA-Vorgaben widerspricht.
Im Fall von Meta kritisiert die Kommission, dass der Facebook-Mutterkonzern die kostenlose Nutzung seiner Dienste nur dann anbietet, wenn Nutzer personalisierten Anzeigen zustimmen. Wer das nicht möchte, muss eine monatliche Gebühr bezahlen. Dieses "Pay or consent"-Modell sei nicht mit dem Digital Markets Act vereinbar, da es Nutzerinnen nicht erlaube, ihr Recht auf freie Zustimmung zur Kombination ihrer personenbezogenen Daten auszuüben.
Keine Entscheidung gegen die USA, sagt die EU
Medienberichten zufolge sei die Untersuchung schon länger beendet. Doch die EU-Kommission habe die Verkündung der Maßnahmen bewusst aufgeschoben und dabei sogar die eigene Frist, die man sich eigentlich für Ende März gesetzt hatte, verstreichen lassen. Wie das Handelsblatt berichtet, habe die Kommission unter dem Vorsitz von Präsidentin Ursula von der Leyen in den vergangenen Monaten überlegt, wann wohl der beste Zeitpunkt sei, um die Entscheidung zu verkünden.
Jetzt ist der Zeitpunkt offenbar gekommen – und das zwei Wochen, nachdem die US-Regierung um Donald Trump die angekündigten Sonderzölle gegen die EU für 90 Tage ausgesetzt hat. Ist das nun Zufall? Oder steckt dahinter nicht doch politisches Kalkül, die Entscheidung zu einem Zeitpunkt zu verkünden, an dem sie, anders als etwa die Idee einer Digitalsteuer, nicht als direkte Antwort auf Zölle gewertet werden können?
Ranghohe EU-Vertreterinnen und Vertreter haben in den vergangenen Wochen jedenfalls immer wieder betont, dass mögliche Strafen, die im Zuge des DMA oder DSA verhängt werden, weder eine politische Entscheidung noch Verhandlungsmasse im aktuellen Handelsstreit seien. Die Europäische Union werde im Rahmen der Debatte keine Zugeständnisse bei ihren Regeln für digitale und technologische Anwendungen machen, ließ die EU am 8. April verlauten.
"Bei den Beschlüssen handelt es sich nicht um Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den USA", bekräftigte Kommissionssprecher Thomas Regnier am Mittwoch auf Anfrage von ZEIT ONLINE. Die Geldbußen seien keine Zölle im Sinne des Handelsrechts und können daher auch nicht als solche betrachtet werden. "Der DMA gilt gleichermaßen für alle großen digitalen Akteure, die in der EU tätig sind und die entsprechenden Schwellenwerte für die Benennung erfüllen, unabhängig von ihrem Herkunftsland", schreibt Regnier. Ähnlich äußerte sich unlängst auch die
EU-Digitalkommissarin
Henna Virkkunen im
Gespräch mit ZEIT ONLINE.
Vertreter der US-Regierung sehen das anders. Eine Analyse mit dem Titel Schranken für den Außenhandel (PDF) des Weißen Hauses erwähnt den Digital Markets Act als eine solche Schranke: Dieser betreffe US-Firmen im Vergleich zu ihren Konkurrenten in der EU unverhältnismäßig stark, da es zumeist US-Firmen seien, die als sogenannte Gatekeeper definiert werden und deshalb starken Vorgaben unterliegen. Trump-Berater Peter Navarro schrieb Anfang April in einem Gastbeitrag für die Financial Times, dass die EU juristische Mittel einsetze, um gezielt der US-Techbranche zu schaden.

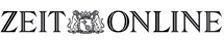 vor 5 Stunden
2
vor 5 Stunden
2











 English (US) ·
English (US) ·